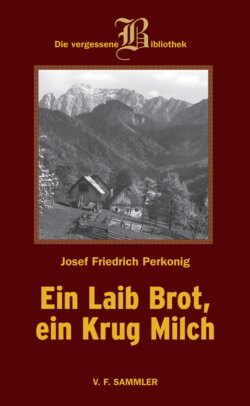Читать книгу Ein Laib Brot, ein Krug Milch - Josef F Perkonig - Страница 13
Das Liebespaar
ОглавлениеDer Wind riß die gelben Nadeln von den Lärchen und trug sie weit hinunter in die Tiefe; er lief wie ein unsichtbares Tier um den einschichtigen Hof auf dem Berge. Da sah der uralte Großvater nach der Sonne und spannte den Ochsen vor den leichten Wagen; es war hohe Zeit, er mußte sich beeilen, der Wind blies den Herbst von den Bergen fort, der erste Schnee hing schon in der Luft.
Drunten im Dorfe wartete der Tischler auf den alten Türkh, er hatte an einem Sonntag im vergangenen Sommer Maß von ihm genommen und nun einen Sommer, einen Herbst lang Zeit gehabt, die Totentruhe für ihn zu tischlern. Es war soweit, daß man sie vorrätig haben mußte, der Tod konnte jeden Tag an die Türe klopfen. Im Frühjahr, Sommer und Herbst, da gelüstete es einen Bauern nicht zu sterben, jetzt aber kam der Winter, seine kurzen Tage waren unendlich lang, da konnte man sich wohl für die große Reise zurechtmachen. Wenn man sich dann eines Tages hinlegte, mußte die Totentruhe im Hause sein.
Der alte Türkh hatte es ohnedies lange anstehen lassen, siebenundachtzig Jahre hatte er alt werden müssen, um sich endlich darauf zu besinnen, daß er ein letztes kleines Haus brauchte und daß die Fichtenbretter dafür beim Tischler schon auf den Hobel warteten.
Der Vater der Türkhbäuerin, der andere Großvater, der auf dem Hofe gelebt hatte, wie war der ängstlich gewesen. Von seinem achtzigsten Jahre an stand die schwarze Truhe mit dem silbernen Kreuz auf dem Dachboden, zehn Jahre lang, bis er sie im letzten Winter endlich gebraucht hatte.
So holte denn der alte Türkh seinen Sarg ab und ging dann neben dem holpernden Wagen her. Die schwarze Truhe war notdürftig mit hellbraunen Kornsäcken bedeckt, aber es waren tiefer im Gebirge keine neugierigen Augen unterwegs.
Ein paar Tage später fiel der erste Schnee, und es schneite schon drei Tage und drei Nächte, als der alte Türkh die geisterhaften Tritte überall im Hause zu hören vermeinte, bald kamen sie aus dem Keller herauf, bald vom Dachboden herunter, aber es knarrte keine Türangel, und es knackte kein Türschloß. Der Mann lag völlig angekleidet in seinen schweren Schuhen auf dem Bett, als sei er für einen Gang in den Schnee hinaus gerüstet; seine Augen blickten unverwandt in das Flockengestöber hinaus.
Es ging mit ihm nun wahrhaftig zu Ende, in der ungewohnten Ruhe waren die Glieder innerhalb weniger Tage müde und steif geworden.
Der Totenwurm bohrte in dem Uhrkasten, das leise Schaben und Klopfen war deutlich zu hören.
Die Schwiegertochter hatte den Wachsstock entzündet und neben den Alten gestellt. Wenn man allein in der Stube verblieb, mußte man für das Sterben gerichtet sein. Seit einer Stunde waren alle Hausleute im Stall: Sohn, Schwiegertochter, Enkel, Enkelin, Knecht und Magd.
Manchmal zitterte das Licht neben ihm; das geschah dann, wenn draußen in dem Flur jemand fest auftrat. Niemand hatte ihm verraten, was geschehen war, vielleicht wollten sie ihn nicht erschrecken. Doch er war lange genug als Bauer auf dieser Hube gesessen und wußte, wie tückisch manchmal ein Unglück in den Stall einbrach. Sie bannten draußen wahrscheinlich ein Unheil, eine Tierkrankheit war gekommen oder war im Anzug.
Er versuchte zu beten, aber seine Gedanken verwirrten sich, er mußte immer an die elende Seuche denken.
Es schmerzte ihn, daß er seinen Leuten nicht beistehen durfte; er sah sich als Sterbender ausgeschlossen aus der Familie. Sie konnten freilich nicht bei ihm wachen, während draußen das Vieh verkam, doch er mußte wenigstens wissen, was sich begeben hatte; es litt ihn nicht auf dem Bette. Langsam und ungeheuer mühsam rutschte er herunter, es wurde ihm schwarz vor den Augen. Dann tastete er längs der Mauer dahin bis zur Tür. Als er sie öffnete, stand davor der Enkel, selber schon ein Mann, der die Magd in den Armen hielt. Jedes von ihnen trug in der einen Hand einen Holzeimer, wahrscheinlich waren sie in das Haus gekommen, um heißes Wasser zu holen. Der Großvater sah sie starren Auges an und verstand ihren kurzen Aufenthalt im Flure wohl; es war ihnen, als hätte er genickt. Ehe er aber noch eine Frage tun konnte, fiel er in der Tür um, wie ein Baum des Waldes umsinkt.
Das erschreckte Paar trug ihn auf sein Bett, und dort drückten sie ihm die halboffenen Augen zu. Dann brachte der Sohn den Leuten im Stalle die trübselige Botschaft.
Was der Großvater, der nun tot da drinnen auf der Bahre lag, in den letzten Augenblicken seines Lebens gesehen hatte, war nur ein halbes Geheimnis der beiden Menschen; denn die übrigen ahnten es alle, und jeder zürnte dem Paare auf seine Weise.
Der Vater wollte den Sohn im Frühjahr auf Brautschau schikken, die Mutter war eben die Mutter, noch keine hat sich im letzten heimlichen Herzenswinkel gefreut, wenn ihr der Sohn von einer fremden Frau genommen wurde; der Schwester hatte Bitternis der Untreue das Herz verhärtet, und sie zankte häufig mit der Magd, und der junge Knecht wollte etwas, was nach seiner Meinung ihm gebührte, nicht dem Herrn überlassen. So war das Paar von lauernden Menschen umgeben, und sie mußten sich vor ihnen hüten und ihr Herz verbergen. Sie gingen stumm aneinander vorüber, weil immer wieder ein Auge durch eine Lücke oder ein Fenster nach ihnen spähen konnte; wie die andern hielten sie beim Mahle die Augen in die Schüssel gesenkt, die in der Mitte des Tisches stand. Sie redeten wenig miteinander, aber sie suchten heimlich Gelegenheiten, um einige Augenblicke gemeinsam zu haben.
Wenn sie sich zufällig am Brunnen trafen oder sich auf einem der kurzen Wege begegneten, den alle Hausleute vom Haus zu Stall und Tenne ausgeschaufelt hatten und auch jetzt beinahe stündlich von dem neuen Schnee befreiten, dann verharrten sie keinen Augenblick länger, als es unbedingt notwendig war.
Doch es gab manche Zeiten am Tage, so dachten sie anfangs, da sie an gewissen Orten unbemerkt beisammen sein konnten.
Etwa am frühesten Morgen in der Küche, wenn die Magd das Frühstück kochte; aber da kam bald die Mutter, und der Sohn mußte tun, als habe er eben Holz zum gemauerten Herde gebracht.
Dann beim Melken, aber der Vater ließ sich auch schon im Stall vernehmen, und der Sohn mußte sich in einem dunklen, feuchten Winkel verstecken.
Auf der Tenne hatte er sich einmal in das Heu verkrochen, und ein anderes Mal war er in den hohen Schnee hinabgesprungen; er hatte Stimme und Schritte des Knechtes gehört.
Verschneiter Zaun
(Mein Herz ist im Hochland)
Nicht zu reden von der Schwester, die war die ärgste. Ein Bräutigam hatte sie verlassen, nun neidete sie jedem Weibsbild den Mann.
Und der Schnee hielt sie alle auf dem Hofe gefangen, es gab keinen weiteren Weg, auf dem man sich hätte ein wenig entfernen können, nirgendshin. Immer noch fielen die Flocken, der Himmel war grau, und es regte sich keine Luft.
Der Tote lag drei Tage hindurch aufgebahrt, wie es der Brauch verlangte.
Das Bett war in die Mitte der Stube gerückt und mit Brettern bedeckt worden, daß es eine hohe Liegestatt war. Darauf stand der Sarg, und darin streckte sich der tote Großvater aus, in seinem grauen lodenen Gewande, das er sich vor einem Menschenalter angeschafft hatte. Zwischen die Finger der wächsernen Hände war der Rosenkranz geflochten.
Fremde Leute konnten nicht zu dem Gestorbenen kommen, denn auch die Nachbarn waren eingeschneit. Immer einer der Menschen des Hofes hielt bei dem Toten Wache, aber die anderen feierten deshalb nicht, die Arbeit hatte ihren sonstigen Gang, wenn es auch stiller in dem Hause war. Sie dämpften die Geräusche und sprachen um einen Ton leiser, sie grauten sich vor der Leiche nicht, aber sie blickten doch nur mit ein paar schnellen scheuen Blicken zu dem Toten hin.
Neben ihm brannte der vielgewundene Wachsstock. Wer am Tage bei ihm saß, schaute durch die Fenster hinaus in den Schneefall, in der Nacht aber war jeder sich selbst überlassen; die Frauen beteten, die Männer grübelten.
Am dritten Tage dann wäre zu anderen Zeiten das Begräbnis gewesen. Da wäre der Pfarrer aus dem Kirchdorfe heraufgekommen oder hätte weiter unten bei einem Wegkreuz gewartet, bis sie den Toten auf dem niederen Berglerwagen brachten. Doch in diesem Schnee gab es keine Wege.
Der Vater vernagelte die Totentruhe seines Vaters, die Bäuerin besprengte sie mit Weihwasser, und alle beteten gemeinsam einige Vaterunser. Dann trugen Sohn und Knecht den Sarg aus der Stube; nicht auf den Schultern, denn die Türe war zu niedrig.
Über die Stiege hinauf mußten sie langsam und vorsichtig gehen. Es war auch nicht leicht, mit dem langen Sarg um die Ecken zu biegen, sie mußten ihn mehrmals halb aufstellen und so weitertragen. Auf dem Dachboden legten sie ihn behutsam auf den Estrich hin.
Hier unter den Schindeln, zwiefach erstarrt in Tod und Kälte, sollte der Tote warten, bis der Weg in den Friedhof hinab gangbar geworden war.
So blieb der Ahn auch nach seinem Tode noch unter einem Dache mit den Hausleuten; zum Abschied auf immer war ihm noch eine Gnadenfrist gegeben.
Zehn Tage später war Weihnachten. Am Heiligen Abend hielten sich die Leute vom frühen Nachmittag an in der Stube auf.
Es hatte zu schneien aufgehört, und eine kalte Sonne lag auf dem Schnee; die Stube war übermäßig hell davon.
Nur langsam kam die Dämmerung; des Feierns ungewohnt, schien es den Menschen am Hofe, die Zeit wäre stehengeblieben.
Die Bäuerin hatte alle Dinge für die Räucherung bereitgestellt. Als es dunkel wurde, legte sie Herdglut auf die zwei Kehrichtschaufeln und warf ein paar Harzbrocken hinein.
Einer der Hausleute räucherte in die Räume, der andere hinter ihm sprengte das Weihwasser mit einer dünnen kornlosen Ähre aus der Kaffeeschale. Die Tochter und der Knecht sollten es im Stall und auf der Tenne tun. Der Sohn und die Magd im Hause, also immer einer der Familie mit einem der Dienstboten.
Als sie aus dem dämmrigen Zimmer, in dem der leuchtende Schnee auch noch am Abend einen sanften Schimmer zurückließ, in den Flur traten und sich hier trennten, setzten sich der Bauer und die Bäuerin zum Tisch und beteten.
Die jungen Leute aber stießen die Türen auf; sie räucherten und sprengten den Segen für das künftige Jahr überallhin.
Der Sohn und die Magd stiegen auch auf den Dachboden hinauf, wo der tote Großvater lag. Im trüben Schein der Glut sahen sie die unheimlich große Truhe, und da fuhr ein Gedanke wie ein Pfeil durch sie beide. An diesem Orte würde sie niemand stören, denn solange der Ahn auf dem Dachboden ruhte, führte hierher kein Weg zu irgendeiner Arbeit.
Schon am nächsten Tag schlichen sie nacheinander die Stiege empor, zuerst der Sohn, dann die Magd. Das Dach war dort, wo der Sarg hingestellt worden war, ganz nahe, und der Mann stieß mit dem Kopf an die Schindeln. Die zwei jungen Menschen sahen sich in dem Halbdämmern zunächst ratlos an, dann zog der Sohn die Magd neben sich nieder auf die Totentruhe.
So saßen sie über dem toten Großvater und redeten vom Leben. Sie glaubten sich rein von Schuld, denn der Alte hatte ihnen ja freundlich zugenickt, ehe er starb.
Eines Tages erschraken sie wohl sehr, doch das seltsame Geräusch dort in der tiefdunkeln Ecke war entstanden, weil der Nußhaufen plötzlich auseinanderrieselte.
Mitten im Jänner fiel ein ungewöhnliches Tauwetter ein, der Jauk, der warme Wind, fraß den Schnee.
Eines Tages war es dann soweit, daß die Bauern von den einschichtigen Höfen einen schmalen Steig in das Tal hinab auspflügen konnten. Sie vollbrachten es gemeinsam, und unten bei dem Wegkreuz, wo ein anderer, schon betretener Weg vorüberführte, atmeten sie erleichtert auf; jetzt hatten sie wieder ihren Auslauf in die Welt hinaus. In der Sternennacht stiegen sie wie erlöst wieder zu ihren Huben hinauf.
Nun war auch der Tag gekommen, an dem sie den toten Großvater in die Erde legen konnten. Sohn und Knecht holten den Sarg vom Dachboden und hoben ihn auf den Schlitten in das Stroh. Dann banden sie ihn mit Stricken fest, damit er auf dem abschüssigen Wege nicht nach vorwärts ins Gleiten käme, und so brachten sie ihn zum Wegkreuz, wo der bestellte Pfarrer wartete und den Toten einsegnete. Sie hatten dann immer noch einige Stunden zu gehen, bis sie zum Friedhof hinab kamen.
Als die Hausleute am Abend dieses Tages um den Tisch beisammensaßen, war es ihnen, als seien sie nicht mehr vollzählig, als habe sie jemand verlassen.
Am Tage nach dem Begräbnis erwartete der Sohn die Magd wieder auf dem Dachboden, aber er war ihnen auf einmal fremd und unheimlich geworden. Plötzlich hörten sie Schritte auf der Stiege. Sie drängten sich dicht in den finstersten Winkel zwischen Hausmauer und Dach.
Der Bauer kam, um nach dem Nußhaufen zu sehen; die zwei Versteckten vernahmen, wie er die Nüsse aus dem kleinen Hügel schöpfte und sie dann wieder niederfallen ließ. Zwei Tage später zur nämlichen Stunde kam die Bäuerin und spannte einige Stricke im Dachgestühl, um die Wäsche aufzuhängen. Sohn und Magd mußten in ihrem engen Versteck lange lautlos verharren.
Es war den beiden plötzlich gewiß, daß nun einmal der Knecht kommen würde, um irgend etwas zu tun, und ein anderes Mal die Tochter, um nach der Wäsche zu sehen. Sohn und Magd wagten es nicht mehr, sich auch von diesen stören zu lassen; sie verrichteten schweigend nebeneinander die Arbeit. Nur einmal am Brunnen, als sie die Wäsche auswand und er das Pferd tränkte, sagte die Magd:
„Es ist nur schad, daß der Vater der Bäuerin schon im vorigen Jahr gestorben ist. Es wird wieder schneien.“