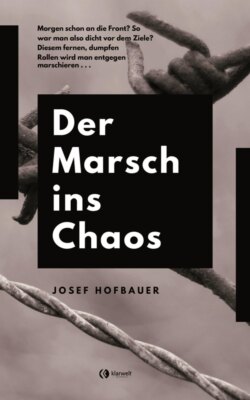Читать книгу Der Marsch ins Chaos - Josef Hofbauer - Страница 5
II.
ОглавлениеDurch schmale, winkelige Gässchen, in denen alte, behäbige Bürgerhäuser träumen, noch manches alte Handwerkszeichen und kunstvolle Schild den Vorübergehenden freundlich grüßt, war Dorniger geschlendert. In diesen verlorenen Gassen gab es weniger Offiziere, da musste man nicht so oft salutieren. Und sie waren so anheimelnd, so vertraut, diese Gasseln, in denen der Schritt Widerhall gab, weil sie so stillegefüllt waren — Wege einer den Sonntagnachmittag verträumenden Stadt. — Nun durchwanderte er den Stadtpark.
Hier war es nicht mehr so still wie in der alten Stadt. Kinder lachten und schrien — sie tummelten sich auf den breiten Wegen, freuten sich der vielen schwarzbraunen Eichhörnchen, die von Baum zu Baum huschten, wie Schatten über die Wege glitten, verfolgt von glänzenden Kinderaugen. Alte Damen und Herren fütterten die Vögel, die sie schwirrend umdrängten. Auf den Banken saßen Soldaten mit ihren Mädchen. Würdige Weißbärte erörterten, wie Dorniger aufgeschnappten Gesprächsbrocken entnahm, die Kriegslage.
Rascher schritt Dorniger aus, den Weg zum Schlossberg hinan. Oben wimmelte es von Soldaten. Den ersten freien Sonntagnachmittag nützten hunderte Wiener zu einem Besuch des Schlossberges. Dort hatte man nicht nur einen bezaubernden Rundblick auf Graz — dort gab es auch ein Kaffeehaus, in dem man köstlichen Kaffee bekam und Gugelhupf —, Gottseidank, Mehlspeisen erhielt man noch ohne Brotkarten!
Überfüllt war der Kaffeehausgarten. An allen Tischen drängten sich lachende, schwatzende Soldaten. Willkommensrufe begrüßten Dorniger. Der Kirschenbauer, Prochaska, Molitor, Doleschal, der Strasser, der Heinzelmeier — alle waren sie da.
Dorniger schlürfte den Kaffee. Das war doch etwas anderes als die schwarze Brühe, mit der zweimal täglich in den Baracken die Bäuche gefüllt wurden! Er erzählte den fragenden Kameraden bereitwillig von seiner Wanderung durch die Grazer Gassen. Darauf berichtete Kirschenbauer:
„Ich war drüben am Lend — das ist der Stadtteil grad uns gegenüber — und dort bin ich im Volksgarten gewesen. Dort hab ich was Symbolisches entdeckt. Im Volksgarten hat der Dichter Morre ein Denkmal. Hast von dem schon was g’hört?“
„Nein.“
„Ich weiß von ihm auch nicht mehr, als dass er ein Volksstück geschrieben hat, das früher oft gespielt worden ist. „‘s Nuller!“ heißt’s. Da kommt ein alter Einleger vor, verstehst? Und der singt ein Lied, das könnt jeder von uns singen, so gut passt es auf uns — wenigstens der Refrain: A Nullerl, a Nullerl, a Nullerl bin i!“
„Verfluchter Kerl! Du musst einem jede Stimmung versauen!“
„Aber recht hat er,“ meinte Prochaska, „mi sein me wirkli alle arme Nullerl, nix wie arme Nullerl!“
„Aber muss man denn immer davon reden! Wird’s denn dadurch anders?“
„Na, so reden wir halt von was anderem“, meinte begütigend Kirschenbauer, der Setzer. „Hast d’ schon deine Latrinenscheu überwunden?“
Wieder wurde Dorniger verlegen. Da hatte er geglaubt, seine Schwäche sei den Kameraden verborgen geblieben — und nun lachten und spotteten sie darüber! Aber tapfer verteidigte er sich:
„Das ist nicht so zu verwundern! Wenn man daheim sein Wasserklosett hat . . . ich hab’ einen schrecklichen Ekel vor der Latrine gehabt. Ich hab’ jedes Mal gemeint, ich muss mich erbrechen. Das hab’ ich nicht verstehen können, dass das möglich ist – zu Dutzenden auf der Stange zu sitzen, dabei gemütlich miteinander zu plaudern, gar zu rauchen, Witze zu machen, zu schweinigeln, zu lachen, wenn einer recht geräuschvoll ist, als wär das ein wunderbarer Scherz — dann fragt wieder einer den andern, ob er Papier hat — nein, das war mir zu grauslich! Da hab’ ich mich halt bezwungen, hab’ immer bis mittags gewartet, dann bin ich in ein Kaffeehaus gegangen. Aber jetzt — von den Andritzer Baracken bis in die Stadt ist’s zu weit, man kann gar nicht an jedem Abend hinein — da hab’ ich mich halt auch dran gewöhnen müssen.“
„So wie man sich halt an alles gewöhnt. Daran, dass man sich nicht baden kann, dass man die Wäsche nicht mehr so oft wechseln kann wie früher — dass man auf einem dreckigen Strohsack schläft mit hundert Fremden zusammengesperrt — dass man sich von einem blöden Zugsführer schikanieren lassen, jeden Trottel grüßen muss, wenn er ein paar Sterndeln aufgenäht hat — ach ja, man gewöhnt sich schon an den Krieg und ans Soldatsein!“
„Und dabei wissen wir noch gar nichts vom Krieg!“
Leise und stockend sagte es Dorniger. „An was werden wir uns noch gewöhnen müssen?“
„An was Besseres gewiss nicht!“
Nachdenklich sogen die Männer an ihren Pfeifen und an den billigen Sonntagszigarren. Das Gespräch zerbröckelte. Jeder hing seinen Gedanken nach, die der gespenstischen Zukunft entgegeneilten.
„Geh’n ma, geh’n ma! ‘s ist Zeit! Mir haben no an weiten Weg bis Andritz!“
Die Soldaten zahlten und erhoben sich. Dorniger und Kirschenbauer traten nochmals an die Brüstung der Mauer, die das Schlossbergplateau umsäumt, ließen nochmals die Blicke hinweggleiten über die liebe, schöne Stadt. Kupferne Kirchenkuppeln und Türme leuchteten, von der scheidenden Sonne umschmeichelt, triumphierend auf. Rotgoldenes Licht lag auf der Mur. Tausend kleine Fenster glühten.
„Ich glaub’, nirgends kann der Herbst so schön sein wie in der Steiermark!“
Kirschenbauer sagte die Worte leise, andächtig vor sich hin, und sie klangen wie Worte eines Gebetes. Seine Hände ruhten auf dem Mauerrand, sein Oberkörper war weit darüber vorgebeugt, seine Blicke streiften hinaus in das farbenprunkende Land.
Und Dorniger sagte:
„Wie schön müsst sich’s in Graz leben lassen, wenn kein Krieg wär!“
„Wenn kein Krieg wär!“
*
„Hob i kan Regenschirm mit,
Dann scheint ganz g’wiss ka Sunn!
Setz i in d’ Lotterie,
Da kumman d’ Numm’ra g’fehlt —
I hob holt gor ka Glück
Auf dera Welt!“
Der Chorgesang der Soldaten widerhallte von den Wänden der „Schwechater Bierhalle“. Wer nicht grad sang, der soff, und war eine Strophe beendet, tranken auch die Sänger. Wenn das Trinken nichts kostete! Freundliche Bürger saßen in der großen Gaststube, stolz darauf, den tapferen Soldaten zahlen zu können.
„Trinkt’s! Trinkt’s! Wer waß, wann ‘s wieder so saufen könnt’s! Vur an so an Weg muaß ma si stärk’n! — Aber singa müaßt’s a. Dos is soviel scheen, wann die Soldaten singan!“
Und die Soldaten sangen und tranken, tranken und sangen — und fühlten ihre Bedeutung wachsen, weideten sich an der tragischen Größe ihres Schicksals — waren stolz darauf, nicht solche dicke Wasteln zu sein, wie die weinseligen und zahlungsfreudigen Bürgersleute, die keine andere Kriegshilfe mehr leisten konnten als die, abmarschbereite Frontsoldaten zu bewirten. Und so stiegen die Wogen der Stimmung, schmolzen die Herzen vor Rührung und Stolz, je mehr die Bäuche sich füllten mit Wein und Bier.
Dorniger, in dessen Kopf es rumorte und wirbelte, wollte sich immer wieder von Kirschenbauer losreißen, der ihn mühsam zurückhielt.
„Lass mich! Ich muss dem Kerl meine Meinung sagen! Wenn er schon nicht mit hinausgeht, dann soll er wenigstens nicht hierherkonımen. Das ist eine Provokation! Wem verdankt’s denn der Müller, dass er ein Kanzleifuchs geworden ist? Wem denn? Der Frau vom Dienstführenden! Man weiß nicht, hat er sie aufgegabelt oder hat sie sich ihn aufgezwickt . . . und weil der Herr Dienstführende unter ihrem Kommando steht, hat er den Müller in die Kanzlei abgeschoben . . . Bei ihr liegt er im Bett und ihm zahlt er . . . und deswegen braucht er nicht an die Front zu gehen! Ist das eine Gerechtigkeit?“
„Eine Gerechtigkeit ist’s nicht . . . aber die darfst d’ doch auch nicht beim Militär suchen . . . Aber machen kannst nichts. Geh’, sei g’scheit! Verdirb dir nicht den letzten Abend! Sing lieber mit! Hast doch einen so schönen Bariton!“
„Da hast d’ recht! Ich hab’ auch immer bei uns mitgesungen bei der Liedertafel . . . und weißt, wir haben eine Vereinigung gegründet gehabt, bei uns in Komotau, die hat in den Spitälern gesungen, damit die armen Soldaten eine Freud haben. Ja, und bei Soldatenbegräbnissen haben wir auch gesungen. Freilich, später nicht mehr — da sind zu viele Begräbnisse gewesen . . . Und jetzt weiß ich nicht . . . weiß ich nicht . . . wer einmal bei meinem Begräbnis singen wird . . . “
Dorniger kam jetzt in eine weinerliche Stimmung, in der er am liebsten aufgeheult hätte.
„Trink einen Schwarzen, dann wird dir gleich besser werden!“ Und Kirschenbauer rief nach der Kellnerin.
Toller, übermütiger, wilder wurden die Soldaten. Zotiger wurden ihre Gesänge, derber ihre Scherze, herausfordernder ihre Gebärden. Mit Faustschlägen, die wuchtig auf die Tische niedersausten, und mit taktmäßigen Schlägen der Bajonette begleiteten sie ihre Lieder. Ein paar hatten sich taumelnd erhoben und versuchten miteinander zu tanzen. Die Kellnerin flüchtete. Kopfschüttelnd stand der Wirt in der Türe und sah dem wüsten, wirbligen Treiben, dem hemmungslosen Toben zu. Die Bürger bekamen Angst, zahlten und verschwanden. Ein Rausch war etwas ganz Schönes — aber die Soldaten trieben es doch gar zu bunt. Da war es besser, nun, da man doch schon genug hatte, heimzugehen und ins Bett zu kriechen.
Aber der turbulente Ausbruch weinerzeugter und angstgeborener Lust war nur Höhepunkt eines Sturmes, dem rasches Abflauen folgte. Nach dem Aufbruch der Bürger standen auch einige Soldaten auf, die nicht so besoffen waren wie die anderen, und mahnten ans Heimgehen. Heimgehen! Das war ein Heimgehen, um fortzugehen! Fast alle begriffen. Die paar Übervollen wurden von den anderen mit aufgerissen und hinausgezerrt ins Freie. Wer nicht allein gehen konnte, wurde von den Kameraden untergefasst und mitgeschleift.
Dorniger, der nicht mehr fest auf den Beinen war, klammerte sich an den fast nüchternen Kirschenbauer. Und er schwatzte, glücklich lallend, auf den Kameraden ein:
„So ein schöner Rausch! So ein schöner Rausch! Ich hab doch manche gute Turnerkneipe mitgemacht — aber so ein schöner Rausch — so ein schöner Rausch . . .!“
Kirschenbauer nahm die Kappe ab und ließ seine Stirne von der kühlen Nachtluft erfrischen. Wie gerne hätte er sich jetzt der Stille hingegeben! Aber wenn schon Dorniger einmal aufhörte, seinen Rausch zu preisen, dann hörte man einen andern singen, immer dieselben Worte, immer die gleiche Melodie: „Do geh’n ma holt zum Maschkeraball, zum Maschkeraball!“ So kam Kirschenbauer zu keinem klaren Denken, zerbrachen alle Versuche zu geordnetem Überlegen an dem trunkenen Lärm der Kameraden, und er war froh, als der Trupp endlich, nach stundenlangem Herumtorkeln, bei den Baracken ankam.
Lachend empfing sie die Lagerwache:
„Ui jö! Ös habt’s schwer g’laden! Ös seid’s von der Marschkompagnie? Na, da seid’s froh, dass ‘s euch no amol habt’s ansaufen können! Schaut’s nur, dass ‘s eini kummts! Lang wird’ts eh nimmer schlafen können!“
Kirschenbauer schleppte seinen Gefährten in die Baracke und warf ihn auf den Strohsack. Jetzt aber wurde dem Dorniger übel. Über schreckliches Kopfweh begann er zu jammern. Die anderen, die schlafen wollten, fluchten und schimpften, so dass Dorniger nichts mehr zu sagen wagte. Wimmernd barg er das Gesicht auf der Decke. Plötzlich stieg ein Würgen in seinem Halse hoch — es war ihm, als drängten alle Eingeweide sich im Körper nach oben – mit letzter Anstrengung riss er den Strohsack beiseite — und in gurgelndem Strome entleerte er seinen Mageninhalt auf die Bretter . . .
*
Der übliche Morgenruf des Korporals vom Tage brachte heute die Soldaten nicht wie sonst auf die Beine. Und unterstrich er seine Worte durch Püffe und Stöße, so antwortete nur unwilliges Gebrumm. Packte er einen der Schnarcher und schüttelte ihn, so kräftig, wie er auf dem Kirchweihfest einen Nebenbuhler gebeutelt, so stöhnte der nur ein wenig auf und wälzte sich auf die andere Seite, ohne seinen Schlaf zu unterbrechen. Da wusste sich der Arme keinen anderen Rat, als den Feldwebel Kleinmichel gehorsamst davon zu verständigen, dass die Leute nicht wachzukriegen, dass sie dalägen wie Baumklötze.
Kleinmichel flog in die Baracke, Schaum vor dem Munde, den Kopf gerötet, zitternd vor Wut. In einer Stunde sollte die Mannschaft gestellt sein! Und noch waren die Schweine nicht auf! Das könnt’ ihnen so passen, die ganze Militärzeit und den ganzen Krieg auf den Strohsäcken zu verfaulenzen! Aber schon wurde der Einfall verjagt von boshafter Freude: Wartet nur, ihr Saukerle! Heut’ habt ihr das letzte Mal auf einem Strohsack geschlafen! Denen gönn’ ich’s, den Tachinierern, die einen noch am letzten Tag so ärgern! Aber mit jeder „Marsch“ hat man den gleichen Ärger. Gottseidank, ich hab schon manche Marschkompagnie zusammengestellt und abmarschieren gesehen — ich hab das Meine geleistet — aber die Saubeuteln werden immer disziplinloser, immer widerborstiger. So was hätt’s während der aktiven Dienstzeit nicht gegeben – da hätt’ man die Leut’ einfach reihenweise angebunden! — Aber in einer Stund soll doch die „Marsch“ gestellt sein! Herrgottnocheinmal . . .
Seine Entrüstung hatte den Feldwebel nicht gehindert, gleich beim Eintritt in die Baracke nach einem Verständigungsmittel zu schauen. Am liebsten hätte er die verschlafene Bande mit einem Bajonett wachgekitzelt. Das war nun freilich nicht möglich — bei aller Strenge vergaß er nie, dass gewisse Methoden nicht anwendbar waren. Aber ein Gewehr riss er an sich und boxte mit dem Kolben die wie im Starrkrampf liegenden Schläfer, und jeden Stoß begleitete ein wütend ausgespucktes Schimpfwort — und da mussten die noch immer Rauschbefangenen doch erwachen — und wenn erst ihr Blick auf den tobenden Feldwebel gefallen, schüttelten sie rasch den Schlaf ab, wankten sie hinaus zu den Wasserhähnen und ließen kalte Ströme über die schmerzenden Schädel laufen . . .
Um sieben Uhr war die Marschkompagnie gestellt. Neben ihr waren auf dem weiten Platze, den die Baracken umsäumten, noch andere Abteilungen aufmarschiert. Wie viele — wer, der im Glied stand, hätte es feststellen können? Man sah nur, soweit man die Blicke wandern ließ, graue Mauern, und hob man sie, dann glitten sie über einen Wald blaugrauer Mützen hinweg. Tausende mochten hier versammelt sein, zum Abmarsch bereit. Bereit gemacht zum Abmarsch. Denn wär es auf die innere Bereitschaft angekommen, dann wäre der Platz wohl leer geblieben, läge jeder Krieger noch schnarchend auf seinem Strohsack und würde morgen und die folgenden Tage zur selben Stunde noch ebenso vergnügt darauf liegen.
Habt Acht! Richt’ euch!
Leises scharrendes Rücken. Vor — zurück – ein wenig seitwärts — wieder vor . . . es dauerte lange, bis der Feldwebel zufrieden war. Aber endlich sah er, von welchem Mann aus er auch spähte, nur lange, unbewegliche Säulen. Da kommandierte er „Ruht!“ und nun durchschritt Zugsführer Lemmerl die Reihen seines Zuges, blieb bei jedem Mann stehen, rückte an jedem herum — schob am Rucksack, am Überschwung, am Brotsack — und so wie er, bemühte sich bei jedem Zuge ein Unteroffizier um die letzte, äußerste militärische Schönheit. Nach den Zugsführern kam der Feldwebel, nochmals mit noch strengerem Auge prüfend — später noch ein Leutnant — und dann endlich war die Truppe abmarschfertig.
Von sieben bis neun!
Jeder hatte genügend Zeit, im Geiste den Inhalt seines Rucksackes, seines Brotsackes, seiner Blusen- und Manteltaschen zu überzählen. Jeder glaubte, jedes Ausrüstungsstück besonders zu spüren. Wie schwer die Rucksäcke waren! Von Minute zu Minute wurden sie gewichtiger. Und wie die gefüllten Patronentaschen niederzogen! Und wie die Schultern schmerzten unter der Last des Gewehres! Und wie schwer die Herzen wurden! Denn wenn auch in den Köpfen der Leute noch immer Hämmer dröhnten und Nadeln bohrten, und wenn auch ihre Augen brannten, Schlafsucht jeden bedrängte und Sammeln der Gedanken vereitelte, so hing doch über ihnen die dunkle Wolke eines schrecklich ungewissen Geschicks, fühlten sie das Grauen des bevorstehenden Marsches in eine gefahrvolle Zukunft, schien ihnen schon dieses Warten im Hofe des Barackenlagers nichts anderes denn Warten auf das nahe Ende . . .
Von sieben bis neun!
Zwei Stunden des Wartens in voller Feldausrüstung genügen, um kräftige Männer zu ermatten, müde und verdrossen zu machen, sie körperlich zu erschöpfen, seelisch zu zermürben. Sie genügten, um in den Landsturmleuten eine lähmende Stimmung der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit zu erzeugen, sie so stumpf zu machen, dass sie nur noch wie eine Schar seelenloser Automaten standen . . .
Habt Acht! Rechts schaut!
Ein Major kam, beritten, stolze Kriegergestalt, farbige und glitzernde Streifen an der Brust, zufriedenen Blickes von seiner Höhe die regungslosen Quadrate und Linien musternd. Soweit es an ihm lag, hatte er die Mannschaft diszipliniert. Kein aktiver Truppenkörper konnte ein schöneres Bild völliger Erstarrung unter dem Willen des Kommandeurs bieten. Und das war erreicht worden in ein paar Wochen! Keine Kunst, eine Truppe kriegsfertig zu machen, wenn man ein paar Jahre Zeit hatte. Und wenn es junge Leute waren, die noch nicht verdorben waren durch Berufs- und Familienleben! Aber das sollte ihm einer nachmachen — ein solches Ausbildungsziel in so kurzer Zeit zu erreichen! Ha, nicht umsonst hatte er einen so guten Ruf als vorbildlicher Ausbildungsoffizier!
„Ruht!“
Der Major selber gab das Kommando.
Ein kräftiges Räuspern. Er rüstete zu einer Ansprache. Darauf tat er sich auch was zugute, dass er es verstand, mit den Leuten zu reden. Markig, kernig. Nach Soldatenart. Und als Soldatenvater.
„Kameraden!“
Wütend dachte Dorniger: Jetzt sagt er Kameraden zu uns — und die ganze Zeit über haben wir ihn kaum gesehen — Kameraden! Ob der Kamerad Major mit uns an die Front geht?
Den Soldaten war es verflucht gleichgültig, was der Major sprach. Sie behielten zwar die eherne Starre ihrer Gesichter bei, aber ihre Gedanken sprangen weit weg vom Major und von der Barackenstadt und nur hie und da bohrte sich ein besonders schneidig hinausgeschleudertes Wort des Redners in ihre Ohren, kam ihnen ein Satz wegen seiner Absonderlichkeit zum Bewusstsein
„Treubruch Italiens . . . tückischer Verrat . . . Rache, Vergeltung . . . Für den Kaiser den eidbrüchigen Bundesbruder bestrafen . . . Mit Gott! . . . Bis zum letzten Atemzug . . . Und ist das Bajonett zerbrochen, ist der Kolben zerschmettert und habt ihr keine Messer mehr, dann springt ihnen mit den Zähnen an die Gurgel . . .“
„Du, der hält uns für Wilde!“ flüsterte Kirschenbauer dem Dorniger zu. Aber weiter floss die Rede des Majors — sofern man den Vergleich des Fließens anwenden konnte, wenn jeder Satz für sich hinausgestoßen wurde.
Mit jener Ahnungslosigkeit vom Fühlen und Denken des Soldaten, die den höheren Offizier auszeichnet, fest überzeugt von der aufwühlenden Wirkung seiner Ansprache, führte nun der Major seine Rede dem Höhepunkt und dem Ende entgegen:
„Wie gerne ginge ich mit euch, Kinder! Aber noch hält mich meine Pflicht zurück! Ich komme euch nach . . .!“
„Den Schmäh (Schwindel) da zählt er jed’smal, wenn er so eine Abschiedsred’ halt“, flüsterte der Kadlec. „I hör’s jetzt scho zum zweiten Mal. —
Wia i ‘s erstemal do g’stand’n bin, hot er’s a g’sogt — und seitdem bin i schon wieder verwundet z’ruckkumma und geh schon wieder aussi — und der Kerl kummt no immer net mit!“
Habt Acht! Marsch!
Während er den Erklärungen des Kadlec lauschte, hatte Dorniger gar nicht wahrgenommen, dass der Major mit einem Hoch auf den obersten Kriegsherrn geschlossen hatte. Jetzt ließ der Kommandant sein Pferd voran tänzeln, gleich hinter der Musikkapelle, die mit einem kräftigen Marsch einsetzte. Kolonne auf Kolonne löste sich los vom Platze, setzte sich in Bewegung, schloss sich den Voranmarschierenden an.
Marsch nach Graz. Marsch durch die Leonhardgasse, vorbei an der Reiterkaserne, am Kadergebäude, von dessen Fenstern aus fette Feldwebel — unentbehrliche Kanzleimenschen — vergnügt auf die Vorbeiziehenden herabschauten, wohlig das Bewusstsein des Daheimbleibenkönnens genießend — Marsch über die Glacisstraße, durch die Herrengasse, über den Hauptplatz, über die Murbrücke, durch die Annenstraße . . .
Fahnen wallten von den Häusern nieder. An allen Fenstern blitzten Mädchenaugen, dichte Menschenmassen säumten den Weg. Tücher wehten, Hände winkten, Blumen sanken, von verzückten Mädchen und berauschten Frauen geschleudert, auf die Marschierenden nieder. Heil!-Rufe umbrausten den Zug. Kinder umjauchzten ihn. Begeisterung begleitete ihn.
Die Offiziere, leicht und flott ausschreitend, blitzende Säbel in behandschuhten Fäusten, schienen beglückt wie unter Triumphpforten zu gehen. Die Soldaten aber schritten wie durch einen Nebel. Stumpf und gleichgültig. Die Zurufe waren ihnen zuwider. Dargereichte Zigaretten nahmen sie in Empfang wie einen selbstverständlichen Tribut. An nichts anderes dachten sie als an die Lasten, die sie schleppten, nichts anderes ersehnten sie, als die verdammten Rucksäcke und die Gewehre abwerfen zu können. Hie und da schwankte einer der Schwächeren. Saftige Flüche und aufmunternde Püffe der Chargen gaben ihm wieder Haltung.
Schweigend, in dumpfer Resignation, schritt Dorniger dahin, gedankenlos fast, ächzend unter dem Drucke des Rucksackes, schwer atmend, voll dunkler Hassgefühle. Die Schultern schmerzten, der Rücken schmerzte, der Hals brannte, der Mund war trocken, über die Stirne und den Nacken rannen Schweißbäche. Die Lippen presste er zusammen, um die aufquellenden Flüche zurückzuhalten und wie eine Erlösung empfand er es, als plötzlich aller Zwang der Wohlerzogenheit und der Gesittung von ihm abfiel und er nur noch einen Gedanken denken konnte: Ihr könnt’s mich alle! Alle könnt’s ihr mich! — und er in diesen Wunsch den Krieg, die Italiener, die schreienden Zuschauer, die Offiziere und Unteroffiziere, die ganze Welt einschloss. Das war wie ein Abschluss einer Lebensepoche, wie ein Schlusspunkt, wie Bekräftigung der Erkenntnis einer Wandlung.
„Jetzt sind wir in der richtigen Stimmung,“ stellte sachlich der neben ihm schreitende Kirschenbauer fest, „in der Leckmiamarsch-Stimmung . . . !“ Endlich am Bahnhof. Wieder Paradeaufstellung. Wieder prüfendes Durchschreiten der Reihen durch die Unteroffiziere. Irgendwo, weiter vorne, musste eine Feldmesse zelebriert werden. Dorniger sah nichts davon, aber es musste wohl so sein, denn es gab das Kommando: „Zum Gebet!“ und die Kapelle spielte „Vater ich rufe Dich!“ Dann folgte das „Gott erhalte!“ — wieder „Habt acht!“ – Marschbefehl – Defilierung . . .
Feldwebel Kleinmichel und Zugsführer Lemmerl traten beiseite, zu anderen Unteroffizieren, die nicht mitmarschierten. Die Soldaten schenkten den freundlich Salutierenden keinen Blick. ]a, sie konnten auch gar nicht — jetzt mussten sie doch die Hälse wenden und die Augen verdrehen — jetzt, da sie vorbeimarschierten, mit letzter Kraftanstrengung, von einer rätselhaften Gewalt dazu gezwungen, stramm sich reckten und die Beine streckten und warfen im Parademarsch. Generäle standen dort, starr, ununterbrochen salutierend, kühlen Blickes die Soldaten musternd. Und daneben die Kapelle, die kräftig spielte.
Blechinstrumente sah Dorniger glitzern, den Mann behielt er in Erinnerung, der wuchtig auf die große Trommel schlug, und den, der den Arm mit dem Taktstock hob und senkte . . . und alle Musik, alle Bewegung, aller Takt der Schritte — alles schrie, schrie Marsch! Marsch! Und er selber sagte es mit, in seinem Schädel brummte es mit: Marsch! Marsch!
Eine willenlose Puppe, ein automatisierter Mensch, eine Maschine aus Knochen und Fleisch und disziplinierten Nervenfasern — so marschierte er, marschierte Zug um Zug, marschierte die Kompagnie hinein in den Rangierbahnhof, hinein in die Viehwagen.