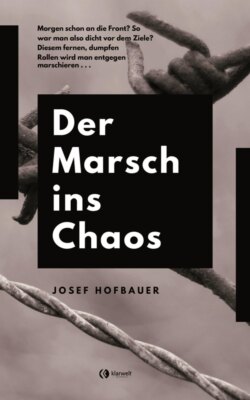Читать книгу Der Marsch ins Chaos - Josef Hofbauer - Страница 7
IV.
ОглавлениеDorniger und der Einjährige Tuller wurden in die Bataillonskanzlei kommandiert. Dorniger bekam den Auftrag, die Post zu zensurieren. Oberleutnant Stümmerl befahl ihm, vor allem darauf zu achten, dass keine Karte und kein Brief eine Ortsbezeichnung trage. Aber auch den Inhalt der Soldatenbriefe solle man nach Möglichkeit prüfen, alles Bedenkliche zurückhalten. Jedes Poststück musste mit einem Stempel bedruckt werden.
„Schau her, i wer’ da zeig’n, wia’s d’ es machen musst“, sagte Kerscheck, der zweite Postler. „I bin scho länger da bei dem G’schäftel und kenn den ganzen Schwindel. Wannst d’ die Brief alle lesen wolltest, würdest nia net ferti. Des macht ma a so: Do guckt ma hie und da an Briaf an oder a Feldpostkarten und schaut, ob net draufsteht „Slavina, am soundsovielten“, und wann’s draufsteht, streicht ma’s halt durch — aber sonsten druckst d’ anfoch die Stampiglie drauf und ferti.“
Zunächst wollte sich’s Dorniger doch nicht gar so leicht machen; er las viele Karten und Briefe durch, merkte aber bald, dass sie alle ganz harmlos waren. Die meisten Soldaten konnten nicht einmal schildern, was sie erlebten, wollten es vielleicht auch nicht. Sie beschränkten sich auf kurze, knappe Mitteilungen und auf Fragen nach der Gesundheit ihrer Angehörigen. Rührend plumpe Schreiben waren es zumeist, die der Zensor in die Hände bekam. Die Mehrzahl begann mit dem fast immer gleichen Satz:
„Liebe Anna (oder Marie oder Grete oder Resi)! Im Anfange meines Schreibens begrüße ich Dich herzlich. Ich bin soweit gesund und hoffe von Dir dasselbe . . .“ Und dann folgten ein paar dürre, nüchterne Worte, Gestammel des Schreibens Ungewohnter, vergeblicher Versuch, von Gefühlen zu sprechen.
Nein, da gab es nichts Gefährliches; diese harmlosen Soldatenbriefe brauchte man wirklich nicht zu zensurieren. Nach einer Stunde war Dornigers Rechte zu einer Maschine geworden, die hurtig Briefe und Karten abstempelte, die von der Linken zugeschoben wurden.
Das war doch eine schöne Abwechslung, in einer Kanzlei zu sitzen, und war’s auch die denkbar primitivste Kanzlei, eine Kanzlei ohne Schreibtisch, ohne Regale, untergebracht in einer niedrigen Bauernstube, aus der alles Mobiliar weggeräumt worden war. Man saß schön im Trockenen, während draußen der Regen niederstürzte, und man brauchte nicht teilzunehmen an der langweiligen Schule, an diesen kindhaften Versuchen junger Kadetten und Fähnriche, den Soldaten die Bedeutung des Dienstreglements klarzumachen. Behaglich streckte sich Dorniger, während er nach den kleinen Fenstern schaute, an deren Scheiben der Regen prasselte. „Was, des g’fallt dir, so a schöner Schwindel? A Spülerei is des Ganze. Und ‘s is net nur wegen dem,“ mit geheimnisvoller Miene näherte Kerscheck sein gutmütiges, dickes, etwas schwammiges Gesicht dem seines ein wenig verwunderten Stubengefährten, „‘s is net nur wegen dem! Mir hab’n a gewisse Vorteile. Uns von da Kanzlei gibt der Koch eher an Brocken Fleisch und an Patzen Zuaspeis mehr. Und an Rum — kannst ma’s glaub’n, Alter — an Rum hab’n ma allerweil! Willst d’ a Maulvoll?“
„Hörst d’ net auf! Rum werd’ i trinken! I bin do ka Branntweiner!“
Unwillkürlich war Dorniger ins Wienerische geraten.
„Bin i vielleicht a Branntweiner? Aber a Bier kriagst net — der Wein is so sauer, dass, a an in Magen z’sammziagt — und da Rum wärmt wenigstens. Den gespürst d’ im ganzen Körper!“ Da zögerte Dorniger nicht länger und griff nach der Feldflasche, die ihm Kerscheck hinhielt.
Zutraulich rückte Kerscheck mit seinem Sessel näher.
„Jetzt könn’n ma a Wengerl plaudern. Der Alte kommt vor elfc net. — Wo bist denn du her, weilst d’ allerweil hochdeitsch spritzt?“
„Ich bin auch ein Wiener, sonst hätt ich doch nicht nach Wien einrücken müssen. Aber ich leb’ schon seit ein paar jahren in Komotau in Böhmen und da hab ich so nach und nach das Wienerische ganz verlernt. Im Zivil bin ich Buchhalter.“ „Und i bin a Telegraphenbeamter. Deswegen hat mi der Alte wahrscheinlich zu da Post g’steckt. Du, gelt, in Komotau, da seid’s lauter Deutschnationale, was? Waßt d’, i bin a guat deutsch gesinnt, aber österreichisch. Guat deutsch, aber österreichisch!“
Und nach einer Weile: „Bist d’ verheirat’, ja? — Zwa Buab’n hast d’? I hab, la klans Maderl, is erst vier Wochen alt, i hab’s no net amol g’seh’n. Mei Alte hat ma’s g’schrieb’n — soll a fester Kerl sein. No ja, wann’s ihr nachg’rat’! Da schau her! Was — de is g’stellt? Do is a Holz bei da Hütten!“ Auch Tuller, der mit allerlei Schreibereien beschäftigt war, mit dem Kopieren von Befehlen, dem Anlegen von Listen und ähnlichen anregenden Arbeiten, und Koppe, der die Rechnungen des Bataillons führte, traten näher, betrachteten das Bild der Frau Kerscheck, nahmen am Gespräch der beiden Hofbauer, Postzensoren teil und Tuller belobte den Kerscheck wegen seiner gesunden Anschauungen.
„Man sieht doch, dass man unter gebildeten Leuten ist. Erinnerst du dich, Dorniger, wie’s mir ergangen ist, als ich den Leuten die Berechtigung unseres Krieges erklären wollte? Mit diesen Menschen ist nicht zu reden. Aber zum Glück kommt’s nicht darauf an, was sie über den Krieg denken. Wenn sie erst draußen in der Feuerlinie sind, werden sie schon ihre Pflicht erfüllen, wie’s die österreichischen Soldaten seit jeher getan haben! — Gib mir einen Schluck Rum, Kerscheck!“ „Da hast, Bruada! Aber du red’st ja wia a Büachel — oder wia a Zeitung! Da muaß ma ja direkt staunen!“ „Ich bin ja auch von der Zeitung. Früher war ich in Mähren und dann bin ich nach Deutschland gegangen. Ich war bis jetzt enthoben und weil mein Chef versäumt hat, rechtzeitig um Verlängerung der Enthebung anzusuchen, hab’ ich einrücken müssen. Aber was will denn mein Chef ohne mich machen! Da verkommt ja die Zeitung, wenn ich nicht da bin. Er hat ja auch schon wieder angesucht um meine Enthebung. Ich wart’ jeden Tag auf meine Abberufung. Mein Lieber, die Zeitungen sind für den Fortgang des Krieges so wichtig wie die Frontsoldaten, drum kann man auch die Redakteure nicht so mir nichts dir nichts in den Schützengraben stecken. — Gib mir noch einen Schluck, Kerscheck!“
*
In der Küche des Bauern, dessen Haus der Bataillonskanzlei Obdach gibt, sitzen die Leute aus der Kanzlei und ein paar Kameraden vom Zug Dornigers mit dem alten, weißbärtigen Bauern, seiner greisen Frau und einem Mädchen – oder war sie schon eine Frau? — um das große offene Feuer, dessen Rauch durch die breite Esse abzieht.
Der Alte stochert manchmal mit einer langen eisernen Gabel im Feuer herum, rückt damit die knorrigen Holzstücke zurecht, legt auch gelegentlich neues Holz nach. Dann sitzt er wieder lange schweigend, in sich versunken, versponnen in seine Gedanken. Nie kommt die Pfeife mit dem zersaugten und zerbissenen Mundstück von den dünnen, zusammengekniffenen Lippen. Langt er mit den harten, hornhautüberkrusteten Fingern nach einem Stückchen glühender Kohle, um die erloschene Pfeife neu in Brand zu setzen, so ist auch das eine von keinem Worte begleitete Zeremonie.
Gesellschafterin seines Schweigens ist die Alte, die mit gefalteten Händen auf einem niederen Schemel hockt. Und die Tochter — auch die Tochter sagt nicht viel. Was gäbe es auch zu reden, wenn man angesprochen wird mit fremden, unverständlichen Lauten? Nur wenn ihr einer der Soldaten ein derbes Wort zuruft, das von einer deutlichen Gebärde unterstrichen Wird, gibt sie irgendeine unmutige Antwort.
Die Augen der Männer hingen an der „Gospoditschna“, an dem Fräulein. Wenn sie so nahe einem jungen Weibe sind, so ganz nahe, dass die Röcke sie streifen — ja, wie sollen sie da noch ruhig sein können! Ihre Blicke umkreisen, betasten, umlauern und umspinnen das Mädchen, gieren nach ihm, schreien nach dem Weibe. Weiß Gott, das war auch nicht leicht, so lange ohne Weib zu leben!
„Wieviel Wochen mögen ‘s jetzt her sein, seit wir aus Graz fort sind? Wart einmal: Das war am dreiundzwanzigsten Oktober — heut ist der sechste November — sollt man’s glauben — zwei Wochen erst? Mir kommt ‘s schon wie eine Ewigkeit vor! Am letzten Tag, da war i no bei an Madel – und seither nix mehr — mein Gott, wenn man halt an sein regelmäßiges Leben g’wöhnt is . . .!“
„Do kannst nix machen, mei Liawa! Die Sloveninnen, die schau’n unseran’ net an — und ‘s is ja auch verboten — waßt d’ net, dass im Befehl g’sagt worden is, dass jede Annäherung an die weibliche Bevölkerung, jede Belästigung streng geahndet wird?“
„Und warum? Weil die Offiziere die paar jungen Weiber, die ‘s da gibt, für sich haben wollen! Wir sind halt immer die Tupferln!“
„]a, de san ma, de san ma immer — beim Schlafen, beim Essen, bei die Übungen und wann’s um die Weiber geht, san ma’s a! Aber da kannst d’ nix machen! Kumm, kriach’n ma in unser Flohtücherl aus Stroh! Um neune is Sperrstund!“
Koppe und Tuller schliefen in einem anderen Raum. Dorniger und Kerscheck aber hatten sich ihr Lager in einem Winkel der Kanzlei zurecht gemacht. Dort lagen sie freilich härter als auf dem Stroh, denn sie hatten nur die Bretter des Stubenbodens unter sich — aber sie waren schön allein, litten weniger unter der Ausdünstung der Masse, die auf dem Heuboden in dichtem Gedränge lag – und Kerscheck meinte, man könne sich auch, was in Gegenwart der anderen unmöglich wäre, noch einen kräftigen Schluck Rum genehmigen.
Dorniger war schon eingeschlafen, als ihn ein monotones Gestammel weckte und ein Scharren und Kratzen und Drücken an der Tür. Wer wollte denn jetzt noch herein? Nein, niemand, aber an der Türe, die zum Zimmer der jungen Frau führte sie musste allabendlich durch die Kanzlei, wenn sie schlafen ging —, an dieser Türe stand der halbentkleidete Kerscheck, drückte unermüdlich an der Klinke herum, klopfte und trommelte an der Täfelung und rief, als bete er eine Litanei, mit heiserer Stimme:
„Gospoditscherl! Gospoditscherl!“
Nichts rührte sich im Nebenzimmer. Kein Lachen wurde laut, kein Schimpfen. Kerscheck aber wurde nicht müde, seine brünstigen Schreie zu wiederholen. Dorniger schaute lächelnd nach dem Mann mit den verfetteten Schultern und dem kugeligen Bäuchlein, das über die Unterhose sich vordrängte, und er lachte noch inniger, als er sah, wie Kerscheck die Augen geschlossen hatte, wie er, schon im Halbschlaf, doch noch mit der Zähigkeit des Betrunkenen an der Klinke drückte und lallend sein Sprüchlein wiederholte:
„Gospoditscherl! Gospoditscherl!“
Lachend drehte sich Dorniger auf die andere Seite, wickelte seine steifen Beine wieder sorgfältig in die Decken ein und ließ Kerschecks Liebesgestöhn auf sich wirken wie irgendein einschläferndes Lied.
„Gospoditscherl! Gospoditscherl!“
„Warum kommt ihr denn heut so spät?“ fragte Koppe.
„Wegen aner Riesenschweinerei, was Dorniger? Wia ma heut’ um die Post g’fahren san, do hab’n ma uns natürli auf’n Wagen g’setzt, denn mia war’n do blöd g’wesen, wann ma neben die Rösser g’rennt war’n. Na, alles schön und guat, aber wie ma nach Dingskirchen kumman, na, halt nach dem Nest, wo die Feldpost is, siecht uns a Oberst. Der schnauzt uns a wia klane Buab’n, weil ma auf’n Wagen g’sessen san, und dann hat er uns extra no a Stund anbinden lassen. Kannst dir vorstell’n — des is ka Klanigkeit, so z’hängen, dass d’ grad no mit die Zechenspitzeln am Boden ankommst. Und da Kutscher, der auf uns hat warten miassen, is derweilen in aner Hostilna g’sessen und hat g’soffen. Beim Heimfahr’n hab’n ma no miass’n auf’n Kutscher aufpassen, dass er uns net vom Bock owig’fallen is. — Waßt Kappe, i hab allerweil g’sagt: guat deutsch und Österreichisch! Aber wann an’ so was passiert, da scheißt ma schon auf alles! — Gib ma jetzt wenigstens a Schluckerl Rum auf den Schrocken auffi!“
„Da hast, trink! Und dann setz dich nieder, dass d’ nicht umfällst! Der Tuller war heut beim Gruppenkommando in St. Peter und da hat er zwei Marschbefehle mitgebracht, einen für sich — seine Enthebung, und einen für uns. Da heißt’s heut noch packen. Alle Truppen, die in Slavina liegen, marschieren morgen früh ab. Wohin, Weiß ich nicht, halt in irgendein anderes Nest. Oder an die Front. Wir müssen Platz machen für andere Marschabteilungen. Und unser Bataillon wird zerlegt in lauter Halbkompagnien, jede kriegt einen Fähnrich oder Kadetten als Kommandanten. — So, da hast d’ einen ganzen Sack voll Neuigkeiten. Und wenn d’ sie verdaut hast, dann teil’ die Post an die Züge aus und dann richt dein Zeug zusammen. Morgen wirst nicht viel Zeit haben dazu. Und nachher, da machen wir uns einen richtigen Abschiedstee, einen kräftigen, mit recht viel Rum.“
Kerscheck nahm die überraschenden Nachrichten, mit denen Koppe ihn und den Dorniger begrüßte, ziemlich gleichmütig auf. Ihn bewegte mehr der Gedanke an das bevorstehende Gelage als die Sorge um den Abmarsch. Dorniger aber war verstimmt, war mehr als verstimmt, war wütend, geladen mit Ärger. Das Anbinden empfand er als drückende Schmach, als einen Flecken auf seiner Ehre. So behandelte man einen Krieger! Und wegen einer Kleinigkeit! Weil ein Oberst die Pferde höher schätzte als die Menschen, lieber die Tiere als die Soldaten vor Überanstrengung bewahren wollte. Und mit dem schönen Posten in der Kanzlei war’s auch aus. Er musste wieder fleißig mit ausrücken – und der Tuller, der Zeitungsschmierer, wurde enthoben. Wozu brauchte man denn die Zeitungsleute? Damit sie allerlei Lügen zusammenschreiben. Das machte sie unentbehrlich, dass man die Lügen brauchte. Bittere Empfindungen durchwogten den Verärgerten. Am liebsten hätte er etwas ganz Tolles, Unerwartetes getan, um „denen da droben“ zu zeigen, dass er sie durchschaute. Doch seine Rachegelüste und revolutionären Pläne wurden nicht offenbar, es wäre denn, seine Kameraden hätten sie an seinem mürrischen Wesen erkannt. Aber sie hatten zu viel mit sich selber zu tun, mit dem Abschluss ihrer Arbeiten und den Vorbereitungen zum Abmarsch, und als sie später beim Tee saßen, dessen Aroma vom Rumgeruch verdrängt war, da verflog Dornigers Unmut rasch und über der Freude des Zusammenseins mit gebildeten Menschen, mit Kameraden, von denen doch jeder ein paar Jahre in einer Mittelschule gesessen, vergaß er alle Kränkungen und frohgemut stimmte er mit ein, als alte Studentenlieder, Volksgesänge und schließlich auch nationale Lieder gesungen wurden. Nachdem der Tee ausgetrunken war, entschloss man sich, keinen mehr zu kochen. Wozu solche Plage, wenn man Rum hatte? Die Feldflaschen kreisten, die Stimmung stieg, schwoll an zu überströmender Begeisterung, ebbte ab zu weher Sentimentalität, die zum Gelöbnis zwang, einander nie zu vergessen, erklomm aber neue Höhen, als man sich von alten Burschenliedern, die Koppe Tränen in die Augen pressten, hinübertastete zur „Wacht am Rhein“.
In die Festlichkeit platzten ein paar Kameraden hinein, die des Zugsführers Befehl brachten, das Maul zu halten, weil es schon neun Uhr vorbei sei.
Jäh brach der stolze Gesang ab. Dorniger glotzte wie durch trüben Nebel nach seinem Kameraden Kirschenbauer, den er in den letzten Tagen fast vergessen hatte. Unklar kam ihm zum Bewusstsein, dass er schon morgen wieder neben ihm marschieren werde, und in einer Aufwallung freundschaftlicher Zuneigung und im dunklen Gefühle, die Vernachlässigung des Gefährten wieder gutmachen zu müssen, reichte er ihm die Feldflasche hin.
Kirschenbauer lehnte ab.
„Ich will morgen nicht mit einem blöden Schädel marschieren. Aber ‘s freut mich, dass du so gut aufgelegt bist, in einer so patriotischen Stimmung. Du hast Wohl alle Heldenlieder ausprobiert, die du morgen auf dem Marsche singen wirst?“