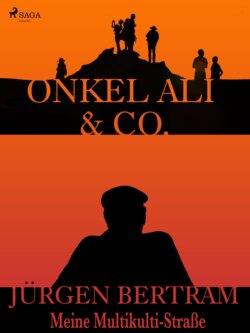Читать книгу Onkel Ali & Co. - Meine Multikulti-Straße - Jürgen Bertram - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 »Hier bin ich, Mölln!« Hüseyins Traum
ОглавлениеWovon träumt ein Hirte, der auf den Höhen Ostanatoliens für einen Hungerlohn Schafe hütet? Von einem Trecker träumt er, von einem dieser bulligen Gefährte, die, den Pflug im Schlepp und in eine Wolke aus Staub gehüllt, unten im Tale des Euphrat über die Äcker tuckern. Wie Musik, Zukunftsmusik, klingt das monotone Geräusch der Maschine in seinen Ohren. Denn einen Trecker zu besitzen, bedeutet: sein eigener Herr sein.
Aber wer sich Ende der sechziger Jahre selbständig machen will in dem Provinznest Erzincan, der muss seiner türkischen Heimat erst einmal den Rücken kehren und sich in das ferne Land begeben, in dem die Schlote rauchen, die jungen Frauen Minirock tragen und die Studenten einen Revolutionär namens Ho Chi Minh hochleben lassen.
Von Erzincan juckelt der Sohn, Ehemann, Bruder, Vater und Onkel mit dem Bus ins knapp zweitausend Kilometer entfernte Istanbul. Dort steigt er in den Zug nach München und anschließend in den nach Hamburg. Mit dem Lastwagen geht es noch einmal in Richtung Norden.
Vier Tage und vier Nächte dauert die Reise in die kleine Stadt in Schleswig-Holstein, in die eine Agentur in Istanbul den anatolischen Gastarbeiter vermittelte und für deren Finanzierung er sich bei seiner Verwandtschaft hoch verschuldete. Hier bin ich, Mölln! Ich, der Hirte Hüseyin Yldirim aus Erzincan – Ende zwanzig, acht Geschwister, drei Kinder, fünf Jahre Grundschule, kein Wort Deutsch, nichts gelernt, aber strotzend vor Kraft, Arbeitskraft.
Am liebsten würde sich Hüseyin Yldirim gleich nach seiner Ankunft, einem Freitag im Frühling, seinen Platz in der Gießerei ansehen, die ihn für zunächst zwei Jahre unter Vertrag nimmt. Aber der Betrieb ruht. Wie? Freitags arbeiten die Deutschen nicht? Hieß es in der Türkei nicht, sie seien so fleißig? Am Montag darauf regt sich immer noch nichts in der Firma. Und auch die Bäckereien, die er, mit seinen zwanzig Mark Begrüßungsgeld in der Tasche, in der Fußgängerzone des Kurortes abklappert, bleiben geschlossen. Was der Moslem nicht weiß: In der Bundesrepublik begeht man gerade eines der wichtigsten christlichen Feste. Von Karfreitag bis Ostermontag dauert es.
So häufig hat der Hirte, der auszog, um sich in Deutschland den Traum vom eigenen Trecker zu erfüllen, seiner Tochter Fetiye über seine ersten Tage in Mölln berichtet, dass es ihr nicht schwer fällt, uns die Geschichte bei türkischem Gebäck und Tee in allen Einzelheiten weiter zu erzählen. Fetiye gehört zu unseren Nachbarn in der Gustav-Falke-Straße in Hamburg-Eimsbüttel, einem Bezirk, der weder zu den sozialen Brennpunkten noch zu den Flaniermeilen der Schickeria gehört. In der gesellschaftlichen Mitte ankert er.
Mit ihrer Liebe zum Detail erweist sich unsere Nachbarin vom Haus Nummer 10 als Glücksfall für die Erkundungen in unserer Straße und ihrer unmittelbaren Umgebung. Denn vor allem im Alltag, in den Irritationen und Frustrationen, Erfolgen und Misserfolgen, Brüchen und Durchbrüchen, spiegelt sich eine Migranten-Existenz und nicht in Statistiken, Verordnungen oder gar biologistischen Thesen.
Am Dienstag nach Ostern wird also wieder gearbeitet in der Möllner Gießerei. Und als seine deutschen Kollegen ihm »Mahlzeit« zurufen, bedeutet das für den Arbeiter aus dem Osten Anatoliens: Endlich gibt’s wieder etwas Handfestes zu essen. Aber was ist das für Fleisch, das in der kleinen Kantine serviert wird? Lamm? Huhn? Kalb? Es könnte, da sich eine undefinierbare Masse auf dem Teller häuft, auch Schweinefleisch dabei sein. Und Allah, der Gott und Richter am Jüngsten Tag, verbietet dessen Genuss. Also: Finger davon lassen! »In seiner ersten Woche in Mölln«, berichtet Fetiye, die Tochter, »hat mein Vater aus Angst, er könnte gegen den Koran verstoßen, fast nur Brot gegessen – Brot und manchmal ein Ei dazu.«
Mit seiner Unterkunft, einem Raum mit sechs Betten, kommt der ostanatolische Gastarbeiter besser klar. Weil er mit leichtem Gepäck anreiste, benötigt er nicht viel Platz. »Sein Koffer«, erzählt seine Tochter, »war so klein, dass er gerade für ein wenig Proviant und die Unterwäsche ausreichte. Die Hose, die mein Vater an hatte, war die einzige, die er besaß. Und seine beiden einzigen Hemden trug er übereinander am Körper. Es herrschte eben extreme Armut bei uns auf dem Land.«
Zwischen fünfzig und sechzig Mark in der Woche zahlt die Gießerei ihrem türkischen Mitarbeiter. Das ist eine Menge Geld für einen Hirten, der vor seinem Aufbruch nach Deutschland heiratete und einen Sohn und zwei Töchter zu versorgen hat. Eines der Mädchen ist Fetiye, unsere heutige Nachbarin. Für sich selbst gibt Hüseyin Yldirim so gut wie nichts aus in Mölln. Umso mehr schmerzt es ihn, dass für jede Nutzung des gemeinschaftlichen Waschraums eine Mark fällig wird. Seine Überweisungen in die Türkei beschränkt er auf wenige Male im Jahr. Auf diese Weise reduziert er die Gebühren auf ein Minimum.
Die Nachrichten, die Hüseyin Yldirim aus der Heimat erreichen, werden immer dramatischer. Zunächst stirbt sein kleiner Sohn an einer Lungenentzündung. Ihm folgt die jüngere der beiden Töchter – plötzlicher Herztod. Und dann lässt sich seine Mutter, die weder lesen noch schreiben kann, einen Brief aufsetzen, in dem sie verkündet, dass auch Fetiye, die mittlere Tochter, immer kränker werde und kaum Überlebenschancen habe. In der Nachbarschaft raune man schon: eine Mutter, die so schwache Kinder zur Welt bringt, taugt wohl nichts. Der Brief schließt mit einem Hilferuf: Komm nach Erzincan! Komm sofort.
Als der Vater in seiner Heimat eintrifft, ist die kranke Tochter anderthalb Jahre alt – und, wie man ihr später berichtet, »schon halbtot«. Was ihrem Körper so zusetzt, weiß man nicht. In der medizinisch unterversorgten ostanatolischen Provinz hat der sozialdarwinistische Lehrsatz damals eine erschreckende Gültigkeit: Weil du arm bist, musst du früher sterben. Doch der frühere Hirte ersinnt einen Ausweg: eine Behandlung in Deutschland. Also verfügt der Patriarch vor seiner Rückreise: Fetiye kommt mit!
Den Traum vom eigenen Trecker gibt Hüseyin Yldirim keineswegs auf. Aber nun rückt erst einmal das schwerkranke Mädchen in den Mittelpunkt seiner Gedanken und Aktivitäten. Von einem türkischen Freund weiß er, dass die Bundesbahn in Hamburg dringend Personal für die Reinigung von Gleisen und Waggons sucht, und da es im Stadtteil Eppendorf ein bestens ausgestattetes Universitätskrankenhaus gibt, wechselt er den Arbeitgeber und den Wohnsitz. Im Zentrum der Hansestadt mietet er eine Einzimmer-Behausung. Im UKE, einem der renommiertesten Hospitäler der Bundesrepublik, stellen die Ärzte bei seiner Tochter endlich eine Diagnose: verschleppte Kinderlähmung. Acht, höchstens neun Monate war sie alt, als der erste Schub sie heimsuchte.
Jeden Tag besucht der Vater das Mädchen im UKE. Im Sommer 1971 kommt auch die Mutter nach Hamburg. Sie verdingt sich zunächst als Hilfskraft in einer Fischfabrik und später in einer Bäckerei. Im Leben der Tochter Fetiye, der in der ostanatolischen Heimat das Schicksal ihrer beiden Geschwister drohte, ist dieser Sommer ein Wendepunkt.