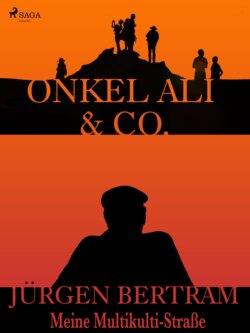Читать книгу Onkel Ali & Co. - Meine Multikulti-Straße - Jürgen Bertram - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 »Ich liebe meinen Beruf« Fetiye und Önder
ОглавлениеVerliebt, verlobt ... aber auch: verheiratet? Als Fetiye und Önder verkünden, jene Gemeinschaft anzustreben, die man den Bund fürs Leben nennt, kommt plötzlich Skepsis auf im ostanatolischen Clan: Passen die 18 Jahre alte Abiturientin aus Hamburg und ihr zwei Jahre älterer Jugendfreund, der seine Heimat nie verließ, so die heiß diskutierte Frage, denn überhaupt zusammen?
Ginge es nach dem in Deutschland gängigen und auch nicht gänzlich unbegründeten Klischee, müsste Fetiyes Vater sagen: Dein Bräutigam hat eine gute schulische Ausbildung und als Besitzer einer kleinen Lederfabrik eine vielversprechende berufliche Zukunft. Also: nimm ihn! In Wahrheit aber sagt er: Als türkischer Mann wird er dich unterdrücken, an den Herd binden und die Unabhängigkeit, die du dir mühsam erkämpft hast, als Bedrohung empfinden. Also: lass es.
Es siegt – welch eine seltene Fügung – ein Bündnis aus Liebe, Pragmatismus und Einsicht. Fetiye und Önder lassen sich von der Ehe nicht abbringen, heiraten aber, aus Verbundenheit mit ihrer Heimat und im Einklang mit den traditionellen Bedürfnissen ihrer Verwandtschaft, in dem Städtchen Erzincan. Nachdem die auch von einem üppigen Mahl gespeiste Euphorie verklungen ist, analysiert der Bräutigam die Perspektive. »Fetiye«, erinnert er sich, »konnte ja kaum noch Türkisch. Und ich bekam mit, dass sie sich nicht zu Hause fühlte in dem Ort, in dem sie geboren wurde. Ich wusste, dass ich es in Deutschland schwer haben würde, aber für Fetiye wäre es unmöglich gewesen, sich in Erzincan zurechtzufinden.«
Das liegt auch an den archaischen Vorurteilen, die Fetiye bei ihrem Besuch nicht verborgen bleiben und die auch ihre Mutter bereits zu spüren bekam. »Ich merkte, dass die Menschen mich wegen meiner Behinderung als nicht vollwertig einstuften. Und ich hatte das Gefühl, dass sie von meinem physischen Zustand auf meine geistigen Fähigkeiten schlossen. Außerdem gab es genügend abschreckende Beispiele von türkischen Frauen, die in Deutschland aufgewachsen waren, nach ihrer Rückkehr in die Türkei heirateten und dort unglücklich waren. Nein: Ich wollte mich nicht sehenden Auges in einen Käfig begeben.«
Fetiye und Önder, noch ein ungleiches Paar, richten sich in Hamburg ein. Die Tochter des Hirten beginnt an der Universität der Hansestadt ein Studium der Erziehungswissenschaften. Nebenbei jobbt sie in der Verwaltung der Imbiss-Kette »Burger King«. Önder hilft, bevor auch er in dieser Firma anfängt, einem Cousin auf dem Großmarkt aus. Dabei vertieft er nicht nur seine Deutschkenntnisse, sondern lernt auch, wie man professionell mit Obst und Gemüse umgeht. Träumte sein Schwiegervater vom eigenen Trecker, so teilen Fetiye und Önder nun den Traum vom eigenen Laden.
Sich selbständig machen, gemeinsam etwas aufbauen, keinem Vorgesetzten verantwortlich sein – so stark beseelt sind auch die Eheleute aus dem Osten Anatoliens von diesem urmenschlichen, über allen Kulturen stehenden Impuls, dass die beiden die Karriere-Offerte ihres Arbeitgebers ablehnen. Stattdessen greifen sie 1994 sofort zu, als ihnen ein Verwandter anbietet, sein Geschäft im bürgerlichen Hamburger Stadtteil Alsterdorf zu übernehmen. In der multikulturell ausgerichteten Himmelstraße befindet sich der Laden.
Auf die Hilfsbereitschaft, die sie in Hamburg schon während ihrer von gesundheitlichen Rückschlägen geprägten Jugend erfuhr, kann sich Fetiye auch verlassen, als es darum geht, Studium und Beruf einigermaßen in Einklang zu bringen. So lösen sich nach der Geburt ihres Sohnes Beritan die Nachbarn in der Aufsicht des Kindes ab. »Die haben«, berichtet Fetiye, »einen regelrechten Dienstplan ausgearbeitet. Als Gegenleistung habe ich mir geduldig die Sorgen meiner Kunden angehört. Einer hat mal gesagt: ›Das geht hier zu wie in der psychotherapeutischen Praxis. Demnächst stelle ich dir eine Couch in den Laden‹.«
Die Uni, das Geschäft, das Kind – irgendwann wird die Dreifachbelastung für Fetiye trotz der nachbarschaftlichen Hilfe zu viel. Sie macht Abstriche beim Studium und verlagert ihre Forschungen auf den komplexen Alltag in ihrer Umgebung. Dabei stößt sie auch auf ein Phänomen, das zu den Schattenseiten der Absetzbewegung in Richtung Bundesrepublik gehört. »In einem der Eingänge neben unserem Geschäft flackerten auch tagsüber rote Lämpchen. Junge Frauen aus Osteuropa empfingen dort ihre männlichen Kunden. Ich habe mich oft mit diesen bildhübschen Frauen unterhalten und war erstaunt, dass sie alle einen akademischen Abschluss besaßen. Sie berichteten mir, dass sich ihre Eltern, um das Studium der Töchter finanzieren zu können, hoch verschuldet hatten und dass sie in Hamburg als Edelprostituierte in vier Monaten mehr verdienten als in Polen oder in der Ukraine in einigen Jahren. Ihren Familien haben sie erzählt, in deutschen Krankenhäusern ein Praktikum zu absolvieren.«
Nach zehn Jahren in der Himmelstraße ziehen Fetiye und Önder in den Bezirk Eimsbüttel um. Am Anfang der Gustav-Falke-Straße, unmittelbar vor dem Eingang einer belebten U-Bahn-Station, mieten sie eine frei gewordene Fläche, die sich ideal für den Verkauf von Obst, Gemüse und Getränken eignet. Auch der Kiosk mit Süßigkeiten, der Zeitungsladen und der Schnellimbiss in ihrer Nachbarschaft befinden sich in türkischer Hand. Eine deutsche Bäckerei und ein pakistanisches Blumengeschäft runden den multikulturellen Charakter der Zeile ab.
Als Fetiye 2005 ihr zweites Kind, die Tochter Belen, bekommt, nimmt die gesamte Nachbarschaft Anteil an diesem Ereignis. Die Stammkundin Ranghild Flechsig, Gustav-Falke-Straße 4, gratuliert mit einem Strampelhöschen und einer Biografie des türkischen Reformers Atatürk, für dessen Lebenswerk sich der Vater Önder besonders interessiert.
Die Oberschulrätin, die seit viereinhalb Jahrzehnten in diesem Quartier wohnt, versteht ihre Präsente auch als Dank dafür, dass Migranten wie das anatolische Ehepaar eine Lücke füllen, die ein schleichender, aber folgenschwerer gesellschaftlicher Wandel hinterließ. »Als ich hier in den sechziger Jahren zusammen mit meiner Mutter einzog«, erinnert sich die Kundin, »gab es in unserer unmittelbaren Umgebung eine ganze Reihe deutscher Einzelhändler und Handwerksbetriebe: Läden für Gemüse, Obst, Lebensmittel und Fisch, einen Uhrmacher, eine Laufmaschenreparatur, eine Heißmangel, eine Apotheke, eine Gaststätte mit deutscher Hausmannskost. Davon ist heute keiner mehr da, keiner. Als die Besitzer aus Altersgründen aufgeben mussten, fand sich unter den Einheimischen niemand, der diese aufreibenden Jobs übernehmen wollte. Hätten wir die Migranten nicht, würde unsere Gegend vollends veröden.«
Dabei gehört die mittlerweile pensionierte Beamtin keineswegs zu den Romantikern, die das aus der Immigration resultierende Problempotential verdrängen. Aus ihrer Erfahrung im Schuldienst weiß sie, dass zum Beispiel »Jungen mit islamischem Hintergrund häufiger negativ auffallen als Mädchen gleichen Glaubens«. Aber im Gegensatz zum per se von Ängsten und Ablehnung gesteuerten Reaktionär wägt sie ab, differenziert sie: »Natürlich fällt die Bilanz trotz mancher Probleme insgesamt positiv aus.«
Als Vorsitzende der Hamburger Goethe-Gesellschaft untermauert die Pensionärin ihr Plädoyer für mehr Offenheit sogar mit dem Wirken des genialen Dichters. Dem Schöpfer des Werkes »Der west-östliche Divan« sei das in deutschen Landen »weit verbreitete kleine Karo zutiefst zuwider« gewesen. Und der Weltbürger aus Weimar habe immer den Kontakt zu internationalen Geistesgrößen gesucht und zum Beispiel die persische Lyrik bewundert.
Ein Dienstagnachmittag im Februar. Der eisige Sturm, der in der Nacht zuvor die Wahlplakate der Hamburger Parteien über das Pflaster schurren ließ und vor unserer Haustür in der Gustav-Falke-Straße sogar eines dieser blechernen Toilettenhäuschen umwarf, wirbelt nun vor dem Laden von Fetiye und Önder den Staub eines von keinerlei Niederschlag gemilderten Wintertages auf. Atemfahnen wehen den Menschen voran, die sich auf den Rolltreppen zum U-Bahn-Schacht drängen. Allein der Rauch, der aus den von Önder mit Tee gefüllten Gläsern steigt, vermittelt das Gefühl, dass es noch Wärme gibt zu dieser frostigen Stunde.
Ich nehme auf dem Hocker neben der Kasse Platz und komme mir vor, als säße ich auf einem Regiestuhl. Aber die Alltagshelden, die unmittelbar vor meinen Augen agieren, bedürfen keiner ordnenden Hand. Ihre Dialoge und Monologe fügen sich von selbst zu einem spannenden, bisweilen absurden, auf jeden Fall aber von multikultureller Vielfalt geprägten Stück.
Als habe ihn ein Anfall von Hospitalismus gepackt, rennt ein Mann mittleren Alters vor dem Laden hin und her. Es sind arabische Laute, die er, wie wild mit der freien Hand fuchtelnd, in sein Handy schreit. Ständig wiederholt er einen Satz, der offenbar mit einem Fragezeichen endet und nach einer Antwort verlangt. Ein Blick auf das Telefon, ein Kopfschütteln, ein Fluch, eine wegwerfende Bewegung.
Der Anrufer stürzt auf Önder zu und stammelt: »Kairo, Kairo ... Batterie leer.« Ob er sie in dem Geschäft aufladen könne. Natürlich kann er das. Er lebe in Hamburg, klärt uns der Ägypter auf, und mache sich große Sorgen um das Schicksal seiner Verwandten. Seit dem Beginn der Demonstrationen gegen das Mubarak-Regime habe er nichts mehr von ihnen gehört.
Stecker raus, neuer Versuch. Dem Satz mit dem Fragezeichen folgt eine Antwort, der Antwort ein Lächeln, dem Lächeln ein in die Höhe gereckter Daumen. Alles okay in Kairo.
»Sind die Weintrauben süß?«, erkundigt sich die ältere Dame.
»Ja ... Weintrauben sind immer süß«, antwortet Önder leicht verlegen.
»Ich möchte wissen, ob sie sehr süß sind.«
»Sie sind süß, aber nicht sehr süß.«
»Wichtig ist, dass sie nicht zu süß sind.«
»Warum ist das wichtig?«
»Sie sind für meine 96-jährige Mutter – und die ist Diabetikerin.«
»Probieren Sie doch einfach mal eine Weintraube!«
»Ja, sie sind süß, aber nicht zu süß. Ein halbes Pfund, bitte.«
Der aus Polen stammende Physiotherapeut, der im Gebäude um die Ecke seine Praxis betreibt, bestellt, wie jeden Nachmittag zu dieser Zeit, einen »Kaffee to go«. Aber er geht nicht. Er bleibt. So lange bleibt er, bis er Önder und mir die Geschichte von seinem Besuch beim König von Malaysia erzählt hat.
Zusammen mit der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, die er auf einer Tour nach Südostasien begleitete, wurde er dort eingeladen. »Dieser Palast ... ein Prunk war das – unfassbar.« Wir erfahren, dass der Blick von den Twintowers in Kuala Lumpur zu den grandiosesten Eindrücken seines Lebens gehörte und dass die pingeligen Kontrollen an der Grenze zu Singapur ihn an »die schlimmsten Zeiten der DDR« erinnert hätten.
Ein letzter Schluck, eine letzte Geschichte. Von Boris Becker handelt sie, der sich, als er vor Schmerzen nicht mehr weiterwusste, in seine Obhut begab. Unter einem Dehn-Defekt habe der Tennisstar gelitten.
Fröhlich vor sich hin pfeifend, fegt ein Bediensteter der Stadtreinigung zwischen dem U-Bahn-Schacht und dem Laden den Staub zusammen. »Ein Landsmann von mir«, sagt Önder. »Der war mal ganz oben, hat als Geschäftsmann sehr viel Geld gemacht. Dann hat er sich verspekuliert – und nun ist er ganz unten. Aber er steckt das weg, beklagt sich nicht. Davon könnten die Deutschen einiges lernen.«
»Sind die Deutschen zu pessimistisch?«
»Ja. Das sind sie. Die Deutschen könnten stolz sein auf ihren Staat, der zu den besten der Welt gehört. Aber stattdessen beklagen sie sich darüber, dass sie zu viel Steuern bezahlen müssen. Als der Lehrer merkte, dass unser Sohn sehr musikalisch ist, empfahl er ihn zur staatlichen Musikschule. Auch seine Schwester wird da unterrichtet. Uns kostet das so gut wie nichts. Wo gibt’s denn das sonst auf der Welt? Und sehen Sie sich diese Bürgersteige und Straßen da draußen an: alles ist gepflastert, geordnet, geregelt.«
»Welche Kunden sind eigentlich freundlicher: die Deutschen oder die Türken?«
»Eindeutig: die Deutschen. Sie sind einfach zivilisierter – jedenfalls die Menschen in der Stadt. Wenn ich zum Beispiel einem Jungen oder einem Mädchen Süßigkeiten zustecke und das Kind nimmt das einfach hin, dann sagt jede deutsche Mutter: ›Du musst dich aber dafür bedanken!‹ Wirklich, jede Mutter sagt das. Bei uns in Anatolien, wo die Leute jeden Tag ums Überleben kämpfen, gibt es so etwas nicht. Man kann das niemandem vorwerfen.«
Der Nachbarschaftspolizist vom Revier 17, dessen gütiger Gestus dem amerikanischen Klischee vom fürsorglichen, dem Wohle der rechtschaffenen Bürger verpflichteten Sheriff nahe kommt, erkundigt sich nach dem Wohlbefinden der Familie. Die Afrikanerin, die ihre Kinderkarre mit den Zwillingen vor dem Laden parkt, skizziert, nachdem sie eine Dose »Pizzatomaten« in ihrer Tasche verstaut hat, die katastrophale Lage in ihrer somalischen Heimat.
Mit dem heiteren Überschwang eines von seiner Kunst und seinem Können überzeugten Jongleurs befördert Önder die Zwei-Euro-Münze, mit der die junge Frau bezahlte, in den offenen Rachen der Registrierkasse. »Ich liebe meinen Beruf«, sagt er.