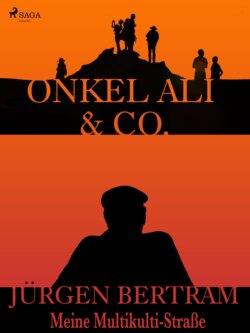Читать книгу Onkel Ali & Co. - Meine Multikulti-Straße - Jürgen Bertram - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 »Den Ball eng führen!« Beritans Zukunft
ОглавлениеDreizehn Fächer umfasst das Zeugnis, das die katholische Grundschule »Sankt Bonifatius« in Eimsbüttel ihren vierten Klassen ausstellt. Bei dem Schüler Beritan Öylü, dem Sohn der Obst- und Gemüsehändler Fetiye und Önder, schlägt neunmal eine »Zwei« und zweimal eine »Eins« zu Buche.
»In den Gruppenarbeitsphasen«, so heißt es in einem Kommentar des Klassenlehrers, »bringt er eigene Ideen ein und trägt seine Vorschläge verständlich und interessant vor.« Und: »Durch gezielte Antworten trägt er zur Lösung eines Problems bei.« In einem Zusatzbogen wird Beritan attestiert, sich »in besonderem Maße an den Regeln der Gemeinschaft zu orientieren«. Die verheißungsvolle Prognose: »Aufgrund der bisher gezeigten Lern- und Leistungsentwicklung und den überfachlichen Kompetenzen, ist Ihr Sohn geeignet, das Gymnasium zu besuchen.«
Aber welches Gymnasium? »Ist doch klar: das katholische«, sagt Fetiye, die Mutter.
Katholische Grundschule, katholisches Gymnasium ... Ich frage Fetiye, warum islamische Eheleute ihr Kind ausgerechnet der Obhut kirchlicher Schulen anvertrauen.
»Weil dort, im Gegensatz zu vielen anderen Schulen, konsequent Werte vermittelt werden – Werte wie die Hilfsbereitschaft zum Beispiel, die ich während meiner Krankheit in christlichen Institutionen erfahren habe. Und außerdem genießt dieses Gymnasium wegen seines hohen Leistungsanspruchs einen hervorragenden Ruf.«
»In Beritans Zeugnis fällt auf, dass er im Fach ›Herkunftssprachlicher Unterricht: türkisch‹ die Höchstnote erzielte. Ihr Sohn ist in der Bundesrepublik geboren, und sein bester Freund ist das, was man einen echten Hamburger Jungen nennt. Warum dann noch die zusätzliche Fixierung auf die türkische Sprache?«
»Wir wollen, dass er in beiden Kulturen zu Hause ist. Wenn das gelingt, ist das doch das Beste, was einem Kind passieren kann. Aber auf gar keinen Fall darf man, wenn man in Deutschland lebt, dessen Sprache und Kultur vernachlässigen.«
»Kennen Sie Familien, die gegen diesen Grundsatz verstoßen?«
»Oh, ja. Und einer der wichtigsten Gründe dafür, dass sie so schlecht Deutsch sprechen, liegt im Fernsehkonsum. Seit man in der Bundesrepublik türkische Sender empfangen kann, hocken viele Familien, wann immer sie können, vor der Mattscheibe und sehen sich türkische Trashserien an. Ich kenne Kinder, die sprechen schon genauso wie so wie Stars dieser Programme.«
Der hervorragende Ruf des Sankt-Ansgar-Gymnasiums löst in Hamburg jedes Jahr einen Ansturm an Bewerbungen aus. Hat der Sohn einer sich zu einem Zweig des Islam bekennenden Familie angesichts einer solchen Konkurrenz überhaupt eine Chance? Mit der persönlichen Vorstellung von Mutter und Kind beginnt am Nachmittag des 25. Januar 2011 das Drama des Werbens und des Wartens.
Dienstag, 25. Januar, abends. Auf der von Flutlicht beschienenen Sportanlage des Eimsbütteler Turnverbandes (ETV) trifft sich die E-Jugend zum Fußballtraining. Ich bin dort mit Fetiye und ihrem Sohn, dem Stürmer Beritan, verabredet.
Da sich die beiden wegen ihrer Präsentation im Gymnasium verspäten, sehe ich mich auf dem Gelände des Hamburger Traditionsvereins erst einmal nach Symptomen multikultureller Einflüsse um. Bereits im Schaukasten am Eingang, wo die Werbung von Sponsoren die Ankündigung der nächsten Spiele umrahmt, entdecke ich welche. Die Firma »Adi shakti fashion« bietet in unmittelbarer Nachbarschaft mit bodenständigen deutschen Handwerksmeistern »Mode für Yoga, Wellness und Freizeit« an. Das asiatisch orientierte Unternehmen »Aurasya« wirbt für »diverse Öle aus aller Welt«.
Die in Eigenarbeit gezimmerte Klubhütte heißt »Zum Wilden Sizilianer«. Francesco, der Wirt, verbringt, wie ich den Gesprächen an der Theke entnehme, fast jede freie Stunde in seinem Schrebergarten am Rande einer Autobahn. Sollte die Stadt ihren Plan wahr machen, das Refugium einer neuen Trasse zu opfern, will er sich mit seinen deutschen Nachbarn zusammentun, um dagegen zu protestieren.
»Den Ball eng führen!« – »Dranbleiben!« – »Nicht von der Strecke abkommen!« Von den elf Jungen, die auf das Kommando ihres Trainers Pattrick Dietz auf dem mit rotweißen Plastikhütchen gespickten Kunstrasen Slalom laufen, stammen vier aus der Türkei. Einer von ihnen ist Beritan, der von einer Profikarriere beim Bundesligaverein HSV träumt wie einst sein Großvater von einem Trecker und seine Eltern vom eigenen Laden. Einen »schnellen Antritt«, »Laufstärke« und »viel Herz« bescheinigt ihm sein Übungsleiter, ein Abiturient, der in der A-Jugend des ETV spielt.
»Ist es schwer für Sie«, frage ich den jungen Mann zwischen zwei Trainingseinheiten, »sich auf die türkische Mentalität einzustellen?«
»Überhaupt nicht. Der Vater meiner Freundin ist Türke. Und auf einer Reise nach Istanbul hat sie mir die türkische Kultur nahe gebracht. Auch mit einer meiner Jugendmannschaften war ich schon in der Türkei. Deutsche und Türken – das ist bei uns eine Einheit.«
»Es gibt wirklich keinerlei Unterschiede?«
»Doch. Bei den türkischen Spielern in meinem Team gibt es gewisse Unterschiede. Ich erkenne sofort, wer von ihnen in einem Haushalt mit einem Macho-Vater aufwächst. Die hauen ganz anders dazwischen als ihre Mitspieler.«
»Und Beritan?«
»Der ist immer höflich und freundlich. Ein ganz lieber Junge ist das!«
Passt die Violine, die ihm seine Eltern schenkten, also besser zu ihm, als der vom Schnee durchweichte Lederball, den er, das Gesicht gerötet von Kälte und Anstrengung, gerade seinem Gegner abgrätscht? Fetiye, seiner Mutter, kann ich diese, dem rauen Ambiente eines Trainingsgeländes angemessene Frage nicht stellen. Sie ist noch immer nicht erschienen. Beren, ihre Tochter, klärt mich auf. Ihre Mutter suche seit einer halben Stunde einen Parkplatz. Deswegen verspäte sie sich. Nur deswegen. Wirklich.
Mir ist klar, was Fetiye, unserer aus Ostanatolien stammenden Nachbarin, in diesem Moment durch den Kopf geht: Die Deutschen gelten als die pünktlichsten Menschen der Welt. Wenn wir von ihnen anerkannt werden wollen, müssen wir Türken besonders pünktlich sein. Und wenn wir es mal nicht sind, bedarf es einer plausiblen Begründung.
Nicht unangenehm auffallen, sich anpassen, das Vorurteil durch die Praxis widerlegen – es ist nicht das erste Mal, dass ich bei einer beruflichen Begegnung mit Bürgern türkischer Herkunft auf diese Haltung stoße. Als ich in den siebziger Jahren mit einem TV-Team des Norddeutschen Rundfunks ein niedersächsisches Dorf porträtiere, in dem bereits mehr Türken als Deutsche leben, lassen uns die deutschstämmigen Bewohner häufig warten, während uns die Gastarbeiter mit ihrer Überpünktlichkeit beeindrucken. Das gilt auch für den Zustand ihrer Wohnungen, den Türken bis heute gern mit einem Begriff bezeichnen, den sie der italienischen Sprache entliehen: picobello.
Natürlich kann man aus solchen Beobachtungen keine repräsentativen Schlussfolgerungen ziehen. Doch belegen sie einmal mehr, in welchem Maße sich die Realität von der im Unterbewusstsein gespeicherten Erwartung unterscheiden kann.
Fetiye sucht noch immer einen Parkplatz, ihr Sohn, der ihr mit seiner Schwester Beren vorauseilte, sprintet im Trikot seines Lieblingsvereins HSV über den Trainingsplatz: Es bleibt mir in diesem Recherchen-Vakuum nichts anderes übrig, als mich mit Beren zu unterhalten, die mit sichtlicher Erleichterung registriert, dass ich Verständnis habe für die Verspätung ihrer Mutter. Was, um Himmels willen, soll man ein gerade mal sechsjähriges, in der Abendkälte bibberndes türkisches Mädchen fragen? Wie es ihm in Deutschland gefällt? Was es vergangenen Sommer bei seinem Besuch im Osten Anatoliens empfunden hat? Nicht kindgerecht genug, sage ich mir – und stelle in meiner Verlegenheit eine Frage, die so linkisch klingt, dass ich erschrecke: »Hast Du schon einen Berufswunsch?«
Beren erlöst mich, indem sie mit fester Stimme antwortet: »Ja.«
»Und was willst du werden?«
»Bundesliga-Schiedsrichterin.«
»Wie kommst du denn da drauf?«
»Neulich hat Beritan mit anderen Jungen auf der Wiese am Weiher Fußball gespielt. Weil sie keinen Schiedsrichter hatten, haben sie mich gefragt, ob ich das machen will. Na, ja: Und als das Spiel aus war, haben sie gesagt: Du warst gerecht.«
»Hattest du denn eine Pfeife?«
»Nein. Wenn mir etwas nicht gefiel, dann habe ich Laute von mir gegeben – bei Abseits: ›Huuuu‹, bei einem Foul: ›Heeee‹.«
Berens Mutter spürt man, als sie endlich auf dem ETV-Gelände eintrifft, noch die Anspannung an, die das Bewerbungsgespräch im katholischen Gymnasium mit sich brachte und die nun in den Stress der Ungewissheit mündet. Nach dem Taufschein ihres Sohnes habe man sie gefragt. War das ernst gemeint? War es Ironie?
Ein aus einer deutschen Familie stammenden Anwärter hat auf die Frage, warum er unbedingt nach Sankt Ansgar wolle, geantwortet: »Weil ich mit Beritan zusammenbleiben will. Beritan ist mein bester Freund.« – Könnte das als Kumpanei ausgelegt werden, die an einer auf Höchstleistung gepolten Schule unerwünscht ist? Gehört, andererseits, der Zusammenhalt nicht zu den christlichen Werten?
»Vergiss den Teig nicht!«, ermahnt Fetiye eine die Dribblings ihres Sohnes beobachtende deutsche Mutter. »Und denk du an das Waffeleisen!«, erwidert die junge Frau. »Auch das Backpulver dürfen wir nicht vergessen«, fügt sie hinzu.
Plötzlich erfasst mich eine irritierende Überlegung: Du hast während deiner Jahre als Fernsehkorrespondent über Bürgerkriege, Volksaufstände, Erdbeben und Feuersbrünste berichtet. Du hast Präsidenten interviewt, Kanzler und Künstler. Du hast Dokumentationen auf dem Himalaya gedreht, auf den südpazifischen Atollen, im australischen Outback, am Gelben Meer. Und nun notierst du dir auf diesem Trainingsgelände in Hamburg-Eimsbüttel hektisch, fast schon übereifrig, die banalsten Dialoge. Hast du die journalistischen Maßstäbe verloren? Keineswegs, beruhige ich mich. Denn indem die beiden aus so unterschiedlichen Verhältnissen stammenden Frauen sich völlig unverkrampft über Alltägliches verständigen, verkörpern sie nichts Geringeres als den Idealzustand interkulturellen Zusammenlebens: die Normalität. Und sie ist ein Wert, den auch ich als Journalist häufig unterschätzt und ignoriert habe.
Spätestens am kommenden Freitag, also in vier Tagen, trifft das Elitegymnasium, wie man Fetiye mitteilte, seine Entscheidungen. Eltern, deren Kind den Sprung nach Sankt Ansgar nicht schafft, erhalten bis zum Abend dieses Tages telefonisch Auskunft. Die Auserwählten werden in der Woche danach per Brief informiert. Es ist ein Verfahren, das an den Nerven zerrt – auch an meinen.
Freitag, 28. Februar, vormittags. Fetiye schüttelt den Kopf, als ich sie an ihrem Stand frage, ob sich das Direktorium von Sankt Ansgar schon gemeldet hat. »Gott sei Dank, nicht. Normalerweise freut man sich ja über einen Anruf. Aber heute schrecke ich jedes Mal zusammen, wenn das Telefon klingelt.«
Freitagnachmittags. Das Telefon klingelt. Wenn das Sankt Ansgar ist, bedeutet das: Es wird nichts mit der Eliteschule. Bevor sie den Hörer abnimmt, beruhigt Fetiye sich (und mich) mit vorauseilendem Trost: »Bei diesem Zeugnis gibt es für Beritan genügend Alternativen. Es muss ja nicht eines der besten Gymnasien Hamburgs sein.« Aber nicht Sankt Ansgar ruft an, sondern eine Kundin, die eine Bestellung aufgibt.
Freitag, früher Abend: das Telefon ruht, gleichzeitig Hoffnung und Ängste verbreitend, in seiner Fassung. Zwei, maximal drei Stunden noch – dann wird Feierabend sein in Sankt Ansgar. Aber kann man denn automatisch mit einer Zusage rechnen, wenn bis heute Abend keine Absage eintrifft? Ich lenke Fetiye ab, indem ich eine Informationslücke fülle. Was ist eigentlich aus ihrem Vater geworden, dem Hirten, der auszog, um seinen Traum vom eigenen Trecker zu verwirklichen?
Hüseyin Yldirim kehrt Ende der neunziger Jahre, also drei Dekaden nach seinem Aufbruch nach Deutschland und sechs Jahre nach einem verheerenden Brandanschlag auf ein von Türken bewohntes Haus in Mölln, zurück in den Osten Anatoliens. In seinem Heimatstädtchen Erzincan bezieht er mit seiner Frau eine kleine Wohnung und holt, aus reiner Freude am Lernen, die Realschulreife nach. Als er an Leberkrebs erkrankt, entschließt er sich zu einer Transplantation. Im Hamburger Universitätskrankenhaus, wo man auch seiner Tochter das Leben rettete, begibt er sich in die Obhut der Ärzte. Seine Verwandtschaft beruhigt er mit einer schlichten Gleichung: Ich war in Deutschland immer fleißig und ehrlich, nun wird Deutschland gut zu mir sein. Der Chirurg, der ihn erfolgreich behandelt, sagt: Es ist auch dieser Optimismus, der ihn geheilt hat.
Und der Trecker? Was wurde aus dem Trecker?
»So richtig benutzt«, sagt Fetiye, die noch immer auf das Telefon starrt, »hat mein Vater ihn nie. Aber weggeben wollte er ihn auf keinen Fall. Als mein Onkel den Trecker mal im Sommer benutzte, hat er ihm den Schlüssel wieder weggenommen. ›Du behandelst ihn nicht gut genug‹, hat er ihm vorgeworfen.«
»Und wo steht der Trecker jetzt?«
»In einer Hütte, die mein Vater extra für ihn gebaut hat. Manchmal macht er die Tür auf, sieht sich den Trecker an und macht die Tür wieder zu.«
»Wird er ihn eines Tages verkaufen?«
»Nie. Wir überlegen jetzt schon, wer in unserer Familie würdig genug ist, um ihn eines Tages zu erben.«
Dienstag, 1. Februar, Fetiyes Geburtstag. Gegen zwölf Uhr mittags – high noon in der Gustav-Falke-Straße – parkt der Briefträger sein Fahrrad vor dem Obst- und Gemüseladen. Beim Offnen des Umschlags, den er ihr überreicht, zittern Fetiye die Hände. Gymnasium Sankt Ansgar steht auf dem Briefkopf. Fetiye liest, liest, liest – und hebt den Daumen. Beritan hat es geschafft.
Freitag, 13. Mai 2011. Fetiye und ihr Mann Önder bitten mich, als ich, voll bepackt mit Tüten und Taschen, aus dem U-Bahnschacht meiner Wohnung zustrebe, in ihren Laden. »Wir haben ein Problem«, sagt meine Nachbarin. »Vielleicht können Sie uns helfen.«
Ist den Kindern etwas passiert? Wollen sich die türkischen Eheleute, was für mich zumindest eine inhaltliche Katastrophe wäre, zurückziehen aus meinem Buchprojekt? Brauchen die beiden einen Kredit für ihr Geschäft? Bevor ich mich der nächsten Hiobs-Variante ausliefere, erlöst mich Fetiye, indem sie ihrer Erklärung ein Lächeln vorausschickt, das mütterlichen Stolz signalisiert. »Vor wenigen Minuten«, sagt sie, »hat ein Jugendtrainer des HSV bei uns angerufen.«
»Und was wollte er?«
»Er hat gesagt, dass er Beritan schon seit längerer Zeit beobachte und dass er vor allem von seiner Laufstärke beeindruckt sei. Aus diesem Potential könne man etwas machen.«
»Und werden Sie darauf eingehen?«
»Wenn wir das tun, bedeutet das: Beritan muss dreimal die Woche jeweils zwei Stunden draußen am Stadtrand trainieren und sich fast jedes Wochenende für ein Turnier bereithalten. Na ja, und die katholische Schule, auf die er nun wechselt, stellt auch höchste Anforderungen an ihn. Wir wissen nicht, wie wir uns entscheiden sollen ...«
»Was glauben Sie: Wie würde er sich selbst entscheiden?«
Fetiye, die ins Zentrum eines Hochleistungs-Konfliktes geratene türkische Mutter, gibt ihre Antwort mit den Augen. Natürlich würde Beritan sofort bei seinem Lieblingsverein trainieren, sagt ihr Blick. Und mit der Ratlosigkeit, die danach aus ihren Gesichtszügen spricht, nimmt sie mich, den Nachbarn, Kunden, Autor und Fußballfan, in die Pflicht.
Eingerahmt von Apfelsinenkisten, Flaschenbatterien und Gemüsezwiebeln philosophiere ich an diesem lauen Nachmittag im Mai mit deutscher Tiefgründigkeit vor mich hin: »Wem der Schöpfer, sei es Allah, Buddha oder der Zufall, ein ganz besonderes künstlerisches oder sportliches Talent in die Wiege legte, der ist verpflichtet, es zu nutzen – und zwar nicht nur zur eigenen Erbauung, sondern auch zum Segen der Gesellschaft.«
»Haben Sie einen konkreten Vorschlag?«, fragt mich Fetiye mit spürbarer Ungeduld.
»Versuchen Sie es! Versuchen Sie, herauszufinden, ob sich Schule und Fußball miteinander vereinbaren lassen.«
Samstag, 14. Mai 2011. Es ist der letzte Spieltag einer Bundesliga-Saison, die der große HSV mit einem enttäuschenden Platz im Mittelfeld und der Erkenntnis beendet, die Nachwuchsarbeit zu intensivieren und den Fokus verstärkt auf die ehrgeizigen Söhne von Migranten zu richten. »Na, haben Sie sich entschieden?«, frage ich Önder, den Vater des laufstarken Fußballers.
»Gestern Abend hat sich noch mal der Trainer vom HSV bei uns gemeldet und uns dringend gebeten, unseren Sohn zum Training zu schicken. Wir haben zugesagt.«
Und wie ist das mit der Violine? Wird Beritan unter den neuen Bedingungen auf diesem Instrument weiter üben?«
»Nein, damit wird er aufhören. Aber ...«
»Aber?«
»Er wird Klavierunterricht erhalten – wie seine Schwester Beren.«
Montag, 30. Mai. Als ich am frühen Abend auf dem Mittelstreifen der Gustav-Falke-Straße meine Walking-Übung absolviere, stoppt Fetiye, unsere Nachbarin von der Hausnummer 10, ihren VW-Bus neben mir. Sie kurbelt das Fenster herunter und sagt: »Ich habe einen Anschlag auf Sie vor.«
»Nur zu.«
»Ich komme gerade mit Beritan vom Konditionscheck zurück. Der Trainer beim HSV meint, was die Ausdauer betrifft, müsse er noch einiges zulegen. Sie walken doch fast jeden Tag. Hätten Sie etwas dagegen, wenn er in Zukunft neben Ihnen herläuft?«
Ich sage zu. Schließlich war der HSV während meiner Kindheit auch mein Lieblingsverein.