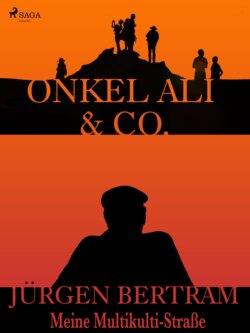Читать книгу Onkel Ali & Co. - Meine Multikulti-Straße - Jürgen Bertram - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 »Das Mädchen gehört aufs Gymnasium« Fetiyes Aufstieg
ОглавлениеWie gut, dass es Fatma gibt. Fatma, benannt nach der jüngsten Tochter des Propheten Mohammed, ist zwanzig Jahre alt und gehört zu den Nachbarn der Familie Yldirim. Da auch sie unter einer Körperbehinderung leidet, die sie ans Haus bindet, hat sie genügend Zeit, sich gegen einen kleinen Lohn um die physisch und psychisch noch immer angeschlagene Fetiye zu kümmern. Deren Eltern, die ja beide arbeiten, nimmt sie damit eine große Last ab.
Die Existenz der jungen Frau bekommt durch die neue Aufgabe einen Sinn, und Fetiye geht es unter ihren Fittichen von Tag zu Tag besser. In einem Quartier direkt über dem Hamburger Obdachlosenasyl »Pik As« findet sich eine anrührende Schicksalsgemeinschaft, der auch jener kämpferische Pragmatismus innewohnt, den man sich in Überlebensgesellschaften aneignet und ohne den Behinderte ihren Alltag kaum meistern könnten.
Als Fetiye einen Bruder bekommt, ihre Familie also auf vier Personen anwächst, wird es zu eng in der Einzimmerwohnung. Diesmal ist es zunächst der Hamburger Kinderarzt, der die Initiative ergreift. Er schaltet eine städtische Sozialberaterin ein, die prompt eine größere Wohnung besorgt. »Zweieinhalb Zimmer«, schwärmt Fetiye noch heute, »das war für uns Luxus pur. Traurig war nur, dass wir unsere Fatma zurücklassen mussten.«
Auf jeden Fall werden sich Fetiyes Eltern so ganz allmählich eines der größten gesellschaftlichen Unterschiede zwischen ihrer alten und ihrer zweiten Heimat bewusst. Im Tale des Euphrat war es ausschließlich der Familienclan, der, wenn auch mehr schlecht als recht, für eine Absicherung sorgte. Im Sozialstaat Deutschland aber kann man sich, ohne sich als Bettler fühlen zu müssen, auch an eine Amtsperson wenden, wenn man Unterstützung benötigt. »Vor allem mein Vater«, erinnert sich unsere Nachbarin, »hat lange gebraucht, um dieses Prinzip zu begreifen. Und dass man seine Söhne und Töchter sogar für wenig Geld in einem Kindergarten unterbringen kann, hat er überhaupt nicht gewusst. Ich glaube, er war lange Zeit auch zu stolz, um staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.«
Auch Fetiye weiß, dass es nicht nur deutsche, sondern auch aus dem Ausland stammende Familien gibt, die den Sozialstaat durch ihre Raff-und-Schlaff-Mentalität in Gefahr bringen und sich damit unsolidarisch gegenüber den wirklich Bedürftigen verhalten. Aber das Beispiel ihrer eigenen Familie repräsentiert, wie mir mit dieser Materie vertraute Beobachter versichern, eine Mehrheit und nicht, wie man an manchen Stammtischen glaubt, die Ausnahme.
Statt sie der Obhut von Erzieherinnen anzuvertrauen, also für einige Stunden außer Haus zu geben, sinnt Fetiyes Vater darüber nach, wie seine Tochter und ihr kleiner Bruder am sichersten in der neuen, im vierten Stock gelegenen Wohnung aufgehoben sind, während die Eltern ihrer Arbeit nachgehen. Die Eisenstäbe, die er im Sperrmüll findet, bringt er in so dichten Reihen vor den Fenstern an, dass seine Kinder nicht hindurchschlüpfen können. Die Wohnungstüren verriegelt er. »Als die Sozialarbeiterin das entdeckte«, berichtet Fetiye, »bekam sie einen Schock. Sie sagte: ›Das ist ja wie im Gefängnis.‹ Sie sorgte dann dafür, dass wir endlich in den Kindergarten kamen. Wir wunderten uns, dass es da sogar was zu essen gab.«
»Und wie war das mit der Schule? Irgendwann mussten Sie und Ihr Bruder ja auch eingeschult werden ...«
»Ja, ja – das war meinen Eltern durchaus klar. Aber sie wussten nicht, wie man das anstellt. Da haben sie uns einfach Schultüten verpasst und uns zum nächsten Schulgebäude geschickt. Wir sind tatsächlich losmarschiert und haben uns zu den anderen Kindern gestellt. Alle wurden aufgerufen – nur wir nicht. Der Rektor hat gefragt: ›Was wollt ihr denn hier?‹ – ›Lernen‹, habe ich geantwortet. ›Aber ihr seid nicht angemeldet‹, hat der Rektor gesagt und uns weitergeschickt.«
Wo immer Fetiye und ihr Bruder auch um Einlass bitten – man kann nichts anfangen mit ihnen. Als sie am Ende ihrer kafkaesken Suche keinen Ton mehr herausbringen, weist man ihnen Plätze in einer Sonderschule zu. Allmählich überwinden die beiden ihre Scheu – und es stellt sich heraus, dass sie viel zu intelligent sind für das Untergeschoss des deutschen Bildungswesens. Durch die ständigen Besuche in der Arztpraxis und bei Behörden hat zum Beispiel Fetiye bereits so gut Deutsch gelernt, dass die Sozialberaterin den Eltern rät, das Kind nach den ersten Grundschuljahren auf eine höhere Schule zu schicken.
Gut, sagt der Vater: Dann geht sie eben auf die Realschule. Die liegt in unmittelbarer Nähe zu unserer Wohnung in der Neustadt. Also hat Fetiye es mit ihrer Gehbehinderung nicht so schwer. Und auch für uns Eltern ist das die günstigste Lösung. Nein, sagt die Sozialberaterin: Das Mädchen gehört aufs Gymnasium. Und ich fahre Fetiye jeden Tag mit meinem Auto dorthin und hole sie nach dem Unterricht wieder ab.
Als eine deutsche Mitschülerin sie zu sich nach Hause einlädt, empfindet Fetiye das als einen »ganz großen Moment«. Und auch die Überraschung, die sie während des Besuchs erlebt, wird sie nie vergessen. »Da ratterte in der Küche so ein merkwürdiges Ding. Ich fragte: ›Was ist denn das?‹ – ›Eine Waschmaschine‹, antwortete meine Freundin. Zu Hause habe ich das sofort meiner Mutter erzählt. Sie wusch ja die Wäsche der gesamten Familie noch mit der Hand – auch die schietigen Arbeitsklamotten meines Vaters. Irgendwann hatte sie keine Fingernägel mehr. Wir haben uns dann in einem Laden informiert, was eine Waschmaschine alles kann und was sie kostet. Aber mein Vater hat sich zunächst gegen einen Kauf gesträubt, weil er ja ständig an seinen Trecker dachte. Aber am Ende hat er sich doch überreden lassen.«
»Und das war’s dann endgültig mit dem Trecker?«
»Keineswegs. Es wurde weiter eisern gespart, kein Pfennig zu viel ausgegeben. Auch ein Telefon kam bei uns nicht ins Haus. Das war viel zu teuer. Wenn man aber mal mit der Tante in der Türkei sprechen wollte, dann lief das so ab: Man ging zum großen Postamt am Hauptbahnhof und meldete ein Gespräch nach Erzincan an, wo es in jeder Straße aber nur ein öffentliches Telefon gab. Meldete sich jemand am anderen Ende der Leitung, dann bat man, die Tante zu informieren, sie möge am nächsten Tag zu einer bestimmten Zeit für einen Anruf parat stehen. Dieses Gespräch verlief dann im Stakkato, in abgehackten Sätzen. Für irgendwelche Plaudereien blieb keine Zeit. Fünf Mark für ein Gespräch waren das absolute Limit. Mehr Geld nahm man gar nicht erst mit.«
Das Kommunikationszentrum der in Hamburg lebenden Türken ist damals wie heute die Wandelhalle des Hauptbahnhofs. »Wer geheiratet hat, wer gestorben ist ... Was in der Heimat passierte, das erfuhr man in dieser Halle. Es war auch ganz normal, dass man einem Wildfremden tausend Mark in die Hand drückte und ihn bat, das Geld irgendwo in der Türkei abzugeben. Ich habe nie gehört, dass etwas weggekommen ist.«
Als Fetiyes Familie um eine weitere Tochter wächst, teilen sich die Mädchen einen Schlafraum, und der Bruder zieht aufs Sofa um. Da die Mutter auch am Wochenende in ihrer Bäckerei arbeitet und der Vater bei der Bahn keine Sonderschicht auslässt, brauchen die Yldirims dringend jemanden, der ihren Alltag managt. Der Kinderarzt, wegen seiner medizinischen Fähigkeiten und seiner außerdienstlichen Fürsorge eine Respektsperson bei den Yldirims, ernennt Fetiye zum Boss. Sie füllt die Anträge aus, kümmert sich um ihre Geschwister, disponiert die Essensvorräte.
»Hat sich Ihr Vater, der ja aus der tiefen anatolischen Provinz stammt, gegen diesen Rollentausch gewehrt?«
»Nein, überhaupt nicht. Unsere Familie gehört der islamischen Reformgemeinde der Alewiten an. Und zu deren Zielen gehört die Förderung der Frauen. Auch die Bildung spielt bei den Alewiten eine zentrale Rolle.«
»Aber Ihre Mutter konnte doch, als sie die Türkei verließ, weder lesen noch schreiben ...«
»Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass die Familien im bitterarmen Osten Anatoliens viel größer sind als in Deutschland. Wenn man zehn Kinder hat, kann man meist nur ein Kind gezielt fördern. Meine Tante zum Beispiel hatte das Glück, mit Büchern aufzuwachsen. Aber natürlich sagten viele Männer im Dorf zu meinem Opa: ›Du wirst schon sehen, was du davon hast, das Mädchen etwas lernen zu lassen‹«.
Zwei neue Operationen werfen Fetiye, die erst mit sechs gehen lernte und noch immer Schwierigkeiten beim Treppensteigen hat, körperlich und seelisch und damit auch schulisch zurück. Wenn ihre Mutter sie im Krankenhaus besuchen will, verläuft sie sich ständig. »Sie kannte ja nur den kurzen Weg von unserer Wohnung bis zu ihrer Bäckerei. Aber dann hat sie ein Fahrer des Krankenhauses einmal in der Woche abgeholt. Sie blieb dann drei, vier Stunden und wurde anschließend wieder zurückgebracht. Es war ein christliches Krankenhaus. Auf diese positive Erfahrung ist wohl mein Faible für die Kirche zurückzuführen.«
Ende der siebziger Jahre, eine Dekade nach seiner Ankunft in Mölln, erfüllt sich für Fetiyes Vater endlich der Lebenstraum. Er hat nun soviel Geld beisammen, dass er sich bei einem Fachhändler vor den Toren Hamburgs einen Trecker kaufen kann. Um die Frachtkosten so gering wie möglich zu halten, schließt er sich mit einigen Landsleuten zusammen, die ebenfalls einen Traktor erworben haben. Per Sammelfracht werden die Gefährte auf eine weite Reise in die türkische Provinz geschickt. Hüseyin Yldirims Trecker erhält einen Ehrenplatz auf dem Grundstück, das sich die Familie mit den Ersparnissen ihrer in Deutschland arbeitenden Söhne und Töchter anschaffte.
Nur ein paar Jahre später erwirbt der ehemalige Hirte ein Fahrzeug, das seinen Stolz festigt. Knallrot, also nicht zu übersehen, ist der nagelneue VW-Golf, den er in bar bezahlt. »Wir gingen zur Bank«, erinnert sich seine Tochter, »und holten die 18000 Mark ab. Zu Hause zählten wir nach – und siehe da: Es waren 20000. Wir zählte und zählten. Es blieb bei 20000. ›Zieh dich wieder an‹, sagte mein Vater, ›wir bringen die 2000 Mark, die man uns zuviel ausgezahlt hat, zurück.‹ Ja, und da stand ich, das kleine Türkenmädchen, am Schalter und sagte zu dem Kassierer: ›Sie haben einen Fehler gemacht ...‹ Als ich dann die zwanzig Hundertmarkscheine hinblätterte, wusste der Mann immer noch nicht, wie ihm geschah.«
1992, ein Jahr nach ihrer Einbürgerung in Deutschland, macht Fetiye an der Hamburger Klosterschule ihr Abitur. »Ohne die Unterstützung durch ganz tolle Pädagogen, die auf meine Behinderung Rücksicht nahmen, hätte ich das nicht geschafft. Meine Lehrer für Latein und Mathematik haben manchmal Sonderschichten für mich eingelegt. Und in der Nähe des Hauptbahnhofs existierte ein Zentrum, in dem Studenten Kindern mit nichtdeutschen Wurzeln kostenlos Nachhilfeunterricht gaben.«
Im selben Jahr reist Fetiye in ihre ostanatolische Heimat und trifft dort Önder wieder, einen Spielkameraden aus ihren Kindertagen. Es ist eine schicksalhafte Begegnung.