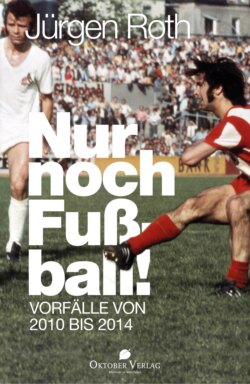Читать книгу Nur noch Fußball! - Jürgen Roth - Страница 6
Vorbemerkungen
ОглавлениеMontag – In christlichen Ländern der Tag nach dem Fußballspiel.
Ambrose Bierce: Des Teufels Wörterbuch
Der Titel dieses Buches ist soweit in Ordnung, aber nicht der wahre Jakob. Denn wie in Noch mehr Fußball! – Vorfälle von 2007 bis 2010 sind auch in diese Chronik Ein- und Auslassungen eingewoben, die andere Bereiche und Topvertreter der »Muskel- und Märchenindustrie des Spitzensports« (Thomas Kistner) zum Gegenstand haben, insbesondere eine berükkend aparte Eisschnelläuferin vom Stamme der Deutschen.
Im großen und ganzen jedoch konzentriert sich dieser Balg aus Glossen, Aufsätzen, Artikeln und Rundfunkbeiträgen auf den Fußball. Das spiegelt dessen Stellenwert wider. »Der Fußball übernimmt alle Fernsehmacht«, klagte der Tagesspiegel vom 3. Juli 2013, »der Tag, an dem Sport in Deutschland nicht mehr Sport, sondern Fußball heißt«, sei nahe. »Denn die öffentlich-rechtlichen Sender interessieren sich auch nur für Quote und Fußball und weniger dafür, ob ein Teil ihrer Zuschauer etwas anderes sehen will.«
Oder hören will. Mit einem Bruchteil der wahnwitzigen Summen, die die Öffentlich-Rechtlichen für Fußballübertragungsrechte aus den Fenstern schütten, ließen sich elaborierte Wortprogramme der Radiowellen pflegen und ausbauen, ließe sich politisch-literarischer Journalismus finanzieren, der den Namen Journalismus verdient. Machtpolitisch gewollt ist das Gegenteil, und auf Grund des verbrecherischen Formatierungszwangs läuft alles mehr oder weniger darauf hinaus, zumindest das ohnehin weithin unumkehrbar vergammelte Fernsehen einem einzigen Format zu unterwerfen, dem Format Fußball – respektive darauf, das Fernsehen nach dem Paradigma des vermaledeiten Sports final umzumodeln.
»Man hat manchmal schon das Gefühl, daß sich Deutschland von der Kulturnation zur Sportnation entwickelt«, räumte Michael Steinbrecher am 21. Juni 2013 gegenüber der FAZ ein. »Der Sport ist in fast allen Lebensbereichen präsent: im Fernsehkonsum, in der Mode, im privaten Verhalten. Sport durchdringt fast alle Sendeformen. Wie funktionieren Castingshows? Das ist nichts anderes als eine sportliche Competition mit Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Schlag den Raab funktioniert auch so. Ich sehe noch keinen Endpunkt – und stelle fest, daß die Dimension und die Akzeptanz enorm gestiegen sind. Die Livepräsentation im Sport ist das letzte kollektive Medienerlebnis, das die Nation verbindet.«
So ähnlich soll das ja bereits am 4. Juli 1954 gewesen sein. Was es mit dem kollektiven Medienerlebnis auf sich hat(te), schildert Gerd Fuchs in seiner Autobiographie Heimwege (Hamburg 2010) – Fuchs war damals einundzwanzig Jahre alt –: »Ich schlenderte die Straße entlang, und weil alle Fenster offen standen, konnte ich das Spiel im Gehen verfolgen – beziehungsweise mußte ich es verfolgen, denn vor dieser Reporterstimme war kein Entrinnen, so daß nicht so sehr ich das Spiel verfolgte als dieses mich. […] Da erhob sich ein Brüllen und explodierte in den Zimmern und stürzte aus den offenen Fenstern heraus und rollte die Straße entlang, ein erlöstes Brüllen, und da richtete es sich auf und riß den Arm befreit hoch: Sieg Heil.«
Der Herr Steinbrecher wird das weder wissen noch wissen wollen, denn er ist mittlerweile tatsächlich und beglaubigt: Professor an der Universität Dortmund. Ich darf aus einem Text aus Noch mehr Fußball! zitieren, der zuerst am 13. Juni 2008 in der Frankfurter Rundschau erschienen war: »Ich mußte so sehr lachen, daß mein Schreibtischstuhl fast zusammenbrach. Vor einem Monat war sie zu lesen gewesen, die Meldung des Jahres: ›Michael Steinbrecher will ›Prof‹ werden‹. Doch, das will er werden, der Michael Steinbrecher: Prof. Beziehungsweise Professor. Die Welt ist voller Wunder. […] Gut, die einen sagen: Das ist der bislang beste Scherz des gar nicht mehr allzu neuen Jahrhunderts. Die anderen interpretieren Steinbrechers Bestreben, den Dortmunder Lehrstuhl für – ja, so was muß es wirklich geben – ›Fernsehjournalismus‹ zu erobern, als Zeichen der vollendeten Verlotterung des deutschen Hochschulwesens, das, nachdem es von neoliberalen Berserkern und Handlangern des Kapitals stranguliert und planiert wurde, jeder opportunistisch-korrupten Pfeife offensteht. Wo Humboldt war, soll Steinbrecher werden. Grandios.«
Fünf Jahre später, im nicht minder famosen Sportjahr 2013, hatte dieser hochoffizielle »Professor für Fernseh- und Crossmedialen Journalismus« (www.journalistik-dortmund.de) selbstverständlich wenig Besseres zu tun, als den Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt am Main zu moderieren (Motto: »Ice and Fire – von Sotschi nach Rio«) – und zwar »gekonnt«, wie wir in einer achtseitigen Zeitungsschleimbeilage erfuhren, einem unschätzbar wertvollen Dokument der geistigen Verluderung und des Prasserwesens, voller Photos von Trantüten, Gaunern und Abgreifern: Hans-Peter Friedrich, Franz Beckenbauer (ohne den läuft ohnehin nichts mehr), Volker Bouffier, Boris Rhein, Roland Koch, Edmund Stoiber und – Waldemar Hartmann, »der den Sportpresseball in den neunziger Jahren selbst dreimal moderiert und ›mit aus der Taufe gehoben‹ hatte«.
Während Michael Steinbrecher also seine akademische Würde und Distanz durch den engagierten Einsatz als Conférencier bei einer von vorne bis hinten korrupten Gockelveranstaltung unter Beweis stellte – und deshalb keineswegs das Amt des Geschäftsführenden Direktors des Dortmunder Instituts für Journalistik niederlegen mußte, das hat er, Wunder über Wunder, auch noch inne –, konnte der offiziell offenbar nicht zum Einsatz gekommene Waldemar Hartmann immerhin seine vor Sprachwitz, intellektueller Schärfe und selbstreflexiver Bescheidung sprühende Autobiographie Dritte Halbzeit – Eine Bilanz (München 2013) bewerben, in der es konsequenterweise zu geschätzten dreiundneunzig Prozent um Spezltum, politischen Filz, unverblümt eingestandene Schiebereien im Medienbetrieb und Kohle mal noch mal Kohle geht.
Na ja, er sagt’s selber: »Ich war eitel wie ein Depp.« Er meint: in seiner Jugend. Nur, daran änderte sich: nichts. Ob er nun mit seiner Nähe zur Familie Strauß herumrenommiert oder zu irgendwelchen Flaschen-Sozis oder zu Muhammad Ali oder zu sonstwem – es ist eine auf fast dreihundertsiebzig Seiten astrein durchgehaltene goldreine Aufplusterei, die trotz journalistischen Beistandes (schreiben kann Hartmann höchstens Einkaufszettel und sogenannte Fernsehgeschichte) grammatikalisch-orthographisch und stilistisch das Niveau von Möbelhauskatalogen erreicht.
Ausgesprochen gelungen fand ich allerdings diesen Satz: »Bei Henry und mir war von Anfang an klar: Ein Duo funktioniert nur zu zweit.« Henry Maske war Hartmanns Experte bei ARD-Boxübertragungen, und eine Seite vorher lesen wir: »Wir waren uns nicht immer einig, weil Henry das Boxen als Philosophie versteht, als Teil des großen Ganzen, als erhabene geistige Auseinandersetzung. Ich bin dagegen der Meinung, daß Boxen insofern mit Schopenhauer zu tun hat, daß auch der ein ›Hauer‹ war, zumindest dem Namen nach.«
Wem soll man jetzt eine langen? Dem Hartmann? Der weder Schopenhauer kennt noch jemals eine Zeile von ihm gelesen hat? Hartmanns Co-Autor, der diesen Dreck zu verantworten hat? Dem Lektor, der nicht mal die grammatikalische Havarie bemerkt und obendrein den Müll stehenläßt?
Nein, ich bin Pazifist und weise statt dessen mit dem gebotenen Maß an »Eitelkeit« (Hartmann) viel lieber auf das Kapitel »Das müssen wir nicht archivieren – Faire und unfaire Kritiker« hin.
»Hand aufs Herz: Mit Kritikern umzugehen – das mußte ich erst lernen«, heißt es da. »Geärgert habe ich mich immer dann, wenn ich genau gemerkt habe, es geht nicht um eine konstruktive und sachliche Kritik – sondern der Absender kann einfach mit meiner Person nichts anfangen, weil ihm mein Schnauzer nicht gefällt oder was auch immer.«
Er schnallt es halt nicht; er kapiert nicht, daß es weniger um die Realperson Waldemar Hartmann als vielmehr um die von ihm schamlos verkörperte Ersetzung von Journalismus durch Gschaftlhuberei und Propaganda geht. Ich darf ein wenig weiterzitieren: »Für mich war das Schlimmste, als mich Jürgen Roth 2002 in der Frankfurter Rundschau als ›konfusen Krachkopf‹ dermaßen persönlich runtergemacht hat, daß ich ein einziges Mal den Medienanwalt Michael Nesselhauf angerufen habe. In der Kritik (wenn man sie überhaupt so nennen möchte) ging es um ›Waldemar Hartmann, diese aggressiv-heitere, mopsigjoviale Inkarnation von rettungsloser Selbstliebe und intellektuellem Bankrott, diese Heimsuchung des modernen Fernsehens der Kumpelei und nationalistischen Erregung‹. Mehr will ich von dieser Schweinenummer gar nicht zitieren, es wäre zuviel der Ehre« – und zuviel der Wahrhaftigkeit.
Vorausgegangen waren der inkriminierten Passage nämlich folgende Zeilen: »Viel, allzuviel haben wir schon aushalten und durchstehen müssen, Mikrophonexaltationen eines Gerd Rubenbauer zum Beispiel, der den alpinen Skisport mehr orgiastisch kreischend als fachlich kommentierend begleitet und während der Eröffnungsfeier dokumentierte, weshalb einer Pistensau wie ihm selbst lachhafte Showdarbietungen genügen, um bar jeder Kontrolle herumzuwitzeln, bis der belastungsfähigste TV-Zuschauer zerebral kollabiert.
Und dann, und dann – tauchte er auf und toppte jeden, mein alter Spezi Waldi, der ungekrönte König der Anwanzerei. Legendär sind seine Interviewturteleien mit den Spitzenkräften des Münchner Bussifußballs, legendär sind des ehemaligen Augsburger Pilsstubenwirts spezielle Schranzenhuldigungen an ›Welt-Präsident‹ Franz Beckenbauer (so Bild bereits am 22. Februar 1995); doch nun, im weiten Westen Utahs, verlor er final die Besinnung und zog diverse Sportler und Wichtigtuer, vornehmlich Bundesinnenminister Otto Schily, gleichfalls ins verdiente Verderben.«
Hartmann sei »sich, wir müssen das so sagen, für wirklich keine Geschmack- und Gedankenlosigkeit zu schade, und zu seinen Gunsten sei konzediert, daß er das auch nicht mehr merkt«, hatte ich im Anschluß an die von ihm repetierten Äußerungen geschrieben und dann meine Invektiven in einen größeren Zusammenhang gestellt: »Gleich zum Start der Wettkämpfe wurde Waldi aus dem Deutschen Haus zugeschaltet. Dort verkündete er lichterloh froh, der Andrang sei immens, weil man die altbairische Disziplin des Weizenbierstemmens unter perfekten Bedingungen absolvieren könne. Anschließend gab er die intime Information preis, er, der berüchtigte Saufchamp, habe beschlossen, zwei Wochen abstinent zu bleiben.
Das muß man wissen, weiß Gott. Das will, das soll man erfahren, und nicht minder bedeutsam dünkt dem schrankenlosen Narziß die Nachricht, das amerikanische Essen bringe ihn in die Bredouille, lasse nämlich seinen ›Diätplan‹ durcheinanderpurzeln und die Taille anschwellen. So tönt es unter einem aufgepfropften Cowboyhut hervor, und während der mutmaßlich impertinenteste der 10.000 Journalisten aus aller Damen und Herren Länder zur Primetime die wehrlosen Studiogäste angockelt und verbal betatscht, ›deutsche Goldmedaillen‹ vorausschauend ausplärrt und ›den Hackl Schorsch‹ ob dessen vorzüglicher Beherrschung des Englischen (›Utah beer ist not the worst‹) belobigt, kramt er in seinem konfusen Krachkopf nach der nächsten Zumutung, die darin gipfelt, daß er selbst schweinsaugenzwinkernd ein paar besonders protzige Statements in, hahaha, kernig-bayerischem Pidgin-Englisch ausspuckt (›So soag’n mir des‹) […].
›Man darf nicht weiter ins Boulevardeske abgleiten‹, hatte vor den Spielen ZDF-Sportchef Wolf-Dieter Poschmann gemahnt. Zumindest bestimmte Kontingente der ARD verfolgen andere Ziele. Die Selbstinszenierung, die Personalityshow, die Aufbauschung des Moderators zum Medium grenzenloser Mitteilsamkeit und geradezu süchtiger Selbstverausgabung, konterkariert alles, was jemals ›seriöser Sportjournalismus‹ genannt wurde. Ein Mann, der den ›Auftrag‹, ›unterhaltsam zu sein‹ (Poschmann), pausenlos mit dem folkloristisch verschwitzten Gealber über Kondome und andere Spießerverdruckstheiten verwechselt, gibt die Richtung vor. Besonnene Akteure, die eigentlich im Zentrum des Fernsehgeschehens stehen sollten, haben da keine Chance. Sehr schön erläuterte etwa der knarzige Skisprungcheftrainer Reinhard Heß nach Sven Hannawalds Silber von der Normalschanze: ›Mit Biertrinken und Gesprächen ist die Leistung nicht zu provozieren.‹ Hartmann vernahm die Botschaft nicht. Er und sein Team fuhren fort, Bierstilblüten zu produzieren und journalistische Leistungen zu erbringen, die offenbar die vollgedröhnten Bild-Berichte über Anni Friesingers ›Oho-Oberweite‹, über den, klar, ›Busen-Neid‹ zwischen ihr und Konkurrentin Claudia ›Nomen no omen‹ Pechstein und über den Popevent als ›Busen-Duell der Eis-Königinnen‹ noch hinter sich lassen sollen.«
Genug der Aufklärung (und Selbstbespiegelung), weiter in Hartmanns Text: »Jedenfalls habe ich zum Telephonhörer gegriffen und mich beklagt: ›Herr Nesselhauf, ich kann doch nicht alles über mir auskübeln lassen.‹ Und dann hat mir Nesselhauf erklärt: ›Herr Hartmann, wir können leider nichts machen. Und ich sage Ihnen auch, warum: Über dem Artikel steht ›Eine Polemik‹.‹«
Das ist juristisch korrekt. Die Meinungsfreiheit und gewisse Rechte haben für Waldemar Hartmann aber offensichtlich nur dann Gültigkeit, wenn sie sein persönliches und pekuniäres Vorankommen sicherstellen: »Da habe ich gelernt: Wenn man ›Polemik‹ über einen Artikel schreibt, besitzt man einen Freifahrtschein für Unverschämtheiten aller Art. Da kannst du jeden von oben bis unten hemmungslos besudeln. Wenn du nur zehn Prozent davon deinem Nachbarn entgegenschleudern würdest, wären diverse Tagessätze fällig. Ich halte das bis heute für eine schreiende Ungerechtigkeit. Für mich hat das mit Pressefreiheit nicht mehr viel zu tun.«
Der Begriff der Person des öffentlichen Lebens ist Waldemar Hartmann also auch unbekannt. Dafür bekannte er am 15. März 2013 in der WDR-Talkshow Kölner Treff abermals ausgiebig, was für ein souveräner Hecht und unübertrefflicher Wodkavernichter er sei, bis Moderatorin Bettina Böttinger anhob: »Ich muß eine Stelle vorlesen. Sie ham die geschrieben. Und ich hab’ mir … Was hat der Mann für ’n dickes Fell, daß der sich traut, das in seinen eigenen Rückblick, also in seine Autobiographie zu schreiben? Wo stand in der Frankfurter Rundschau, Sie wissen schon, was kommt, da stand mal über Sie, es is’ wirklich zu schön. Zu böse.« Es folgte obiger Abschnitt. Böttinger anschließend: »Sind Sie Masochist?« Hartmann: »Nein, ich wollt’ einfach mal zeigen, weil da kommen ja zwei gute Kritiken auch, im Laufe der fünfunddreißig Jahre ham sich die zwei angesammelt, ja? Nee, ich wollt’ einfach mal zeigen, was heut’, was, was möglich war, wie Pressefreiheit auch genützt werden kann. Jürgen Roth hat das übrigens geschrieben, von dem man mir damals dann gesagt hat, er sei noch im bewaffneten Kampf. […] Also is’ das heutzutage möglich, Pressefreiheit!, wenn man ›Polemik‹ drüberschreibt, kann man Kübel voll Schweinereien und Häme über ein’ schütten, und du hast keine Möglichkeit, dem zu widersprechen. Auch das is’ offenbar – Pressefreiheit.«
Selbst hier lag Hartmann daneben. Ich war damals nicht im bewaffneten Kampf, ich war lediglich extremistischer Berater der Gallus-Guerilla-Gardeners.
»Ja, man darf die Wahrheiten ja auch mal niederschreiben.« (Hartmann, Kölner Treff) Für Hunter S. Thompson bedeutete das, Sportjournalisten als »eine dumpfe und hirnlose Subkultur faschistischer Säufer« und als »eine Bande bösartiger, in einem Zookäfig wichsender Affen« zu titulieren (»sie vermehren sich wie Zuhälter und Immobilienmakler«; Hey Rube – Blutsport, die Bush-Doktrin und die Abwärtsspirale der Dummheit – Zeitgeschichte aus der Sportredaktion [Berlin 2006]); für Waldemar »Ich weiß alles, egal, in welcher Sportart« Hartmann wiederum, bei seinem stellaren Auftritt als sogenannter Telephonjoker in der RTL-Raterunde Wer wird Millionär? (21. November 2013) – er erklärte, die deutsche Nationalmannschaft habe nie eine Fußball-WM im eigenen Land gewonnen (und das als Wahlmünchner und jahrzehntelanger BR-Fußballanchorman) – zu behaupten, die Geschichte mit Deutschland stehe in seiner Autobiographie: »›Da gibt es ja nur eins: Deutschland hat natürlich im eigenen Land keine WM gewonnen!‹ Dann fügte er noch an: ›Noch nie im eigenen Land. Kann man in Dritte Halbzeit, in meinem Buch, nachlesen.‹ Falsche Antwort mit peinlicher Eigenwerbung.« (Spiegel Online)
Mit in die Irre führender Eigenwerbung zudem. Ist da nämlich nicht nachzulesen. Sondern beispielsweise, daß Waldemar Hartmann ganz gern mit Horst Seehofer einen heben würde, »um ihm ein wenig Fußballsachverstand zu vermitteln«. Oder: »So unglaublich viel Ahnung von dem Sport, den wir moderieren, haben wir Moderatoren ja auch nicht immer.«
Nicht allzuviel Ahnung haben offenbar dito einige der Autoren der Buchreihe 111 Gründe, den … zu lieben (sie erscheint in einem Imprint-Verlag von Schwarzkopf & Schwarzkopf, der allen Ernstes Wir sind der zwölfte Mann, Fußball ist unsere Liebe! heißt; nu’ is’ alles zu spät, da hilft nicht mal mehr die Erinnerung an Gustav Heinemanns Wort von der Liebe, die nicht dem Staat und allein seiner Frau gelte). Im Falle des Bandes über den 1. FC Nürnberg kann ich das bestätigen. Zu jenem über die Frankfurter Eintracht schreibt mir F. W. Bernstein am 21. Januar 2014 per Mail: »Auch wenn Du unbegreiflicherweise diesem bayerischen Neureichenverein anhängst, so könntest Du vielleicht doch meine Empörung teilen: In diesem Buch fehlt fast nix, aber es fehlt die Seele der Eintracht – ignoriert wird Toni Hübler!«
Fürwahr, ein Skandal, ein echter. (Zu Toni Hübler siehe bei Bedarf etwa Noch mehr Fußball!, S. 79 ff.) Ich hingegen hege nach wie vor die Absicht, irgendwann zusammen mit Kollegen die Buchgroßprojekte Wahre WM-Geschichte – Große Spiele neu gesehen und Deppen und Helden – Die Dummheit im Fußball anzupacken. Für letzteres vorgesehen sind die Kapitel »Falsche Deutungen – Dumme Fußballhistoriker«, »Fußball und Krieg«, »Quatschige Fußballtheorien«, »Spielsystemtorheiten«, »Effenberg – Kasper«, »Klinsmann – Kasper«, »Netzer – Kasper«, »Maradona – Kasper«, »Hauptsache Italien!«, »Große Trainerfehlentscheidungen«, »Fußballsprache als restringierter Code«, »Elende Vereinsbosse«, »Fußballpresse gestern und heute – Von Richard Kirn bis zur Süddeutschen Zeitung«, »Die FIFA, uuaaahh!«, »Gegendummheitsfiguren – Scholl et alii«, »Interview mit Thomas Berthold«, »Was Glück ist? Dumm sein und Fußball spielen« sowie »Die wunderbare Dummheit des Fußballspieles«.
Zum Beschluß: Im hiesigen Kompendium findet sich neuerlich ein Anhang mit Beiträgen, die chronologisch aus der Reihe fallen und ab und an ein wenig vom Thema Fußball/Sport wegführen – oder in dessen Randbezirke. Zur Not ignoriere man ihn/sie.