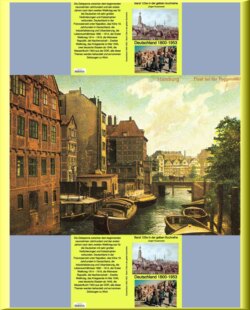Читать книгу Deutschland 1800 - 1953 - Jürgen Ruszkowski - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Chronologie zur Deutschen Kolonialgeschichte
ОглавлениеChronologie zur Deutschen Kolonialgeschichte
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/afrikanische-diaspora/59376/chronologie
1847
Vorlage der „Denkschrift über die Erhebung Preußens zu einer See-, Kolonial- und Weltmacht ersten Ranges“ vor dem Vereinigten Landtag in Preußen.
1856-1868
Errichtung einer Niederlassung des Bremer Handelshauses Friedrich M. Vietor Söhne in Togo (1856);
Errichtung einer Niederlassung des Hamburger Handelshauses Carl Gödelt in Togo (1866);
Errichtung einer Niederlassung des Hamburger Handelshauses Carl Woermann in Kamerun (1868).
1871
Proklamation des Deutschen Reiches in Versailles;
Otto von Bismarck wird Reichskanzler (bis 1890);
Artikel 4 der Verfassung des Norddeutschen Bundes – die Sicherung der Möglichkeit zu überseeischen Erwerbungen – wird ohne Abänderung in die Reichsverfassung übernommen.
1874-1882
Errichtung einer Niederlassung des Hamburger Handelshauses Jantzen & Thormählen in Kamerun;
Gründung des „Zentralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande“ in Berlin (1878);
Erster Deutscher Kolonial-Kongress;
Gründung des „Verein für Handelsgeographie und Kolonialpolitik“ in Leipzig (1879);
Errichtung einer Niederlassung des Hamburger Handelshauses Franz Wölber & Walter Brohm in Togo;
Gründung des „Deutschen Kolonialvereins“ in München(1882).
1884
Februar:
Kampf in Togo zwischen deutschen Firmenbesitzern und einer Gruppe um den Togoer Amtsträger Lawson;
Entführung von drei seiner Mitstreitern durch die deutsche Marine; Abtransport nach Deutschland, Gefangennahme in der Kaserne des 2. Garderegiments in Berlin-Spandau (bis Juni).
März:
Ernennung des Afrikaforschers und Diplomaten Gustav Nachtigal zum „Reichskommissar“ für die westafrikanische Küste.
Juli:
Abschluss von Verträgen zur Meistbegünstigung des deutschen Handels mit afrikanischen Amtsträgern in Togo, Errichtung der Kolonie Togo;
Abschluss von Verträgen zur Meistbegünstigung des deutschen Handels zwischen Duala Amtsträgern und den Hamburger Handelsfirmen C. Woermann und Jantzen & Thormählen;
Errichtung der Kolonie Kamerun;
Aufstand in Duala.
August:
Errichtung der Kolonie Deutsch-Südwest-Afrika (heutige Republik Namibia).
September:
Entsendung des neu gegründeten „Geschwaders für die Westküste Afrika“ mit sechs Kriegsschiffen und ca. 1.300 Marinesoldaten nach Afrika.
Oktober:
Wahl in Deutschland. Haupt-Wahlkampfthema: Kolonialpolitik. Ergebnis: Sieg der Bismarck-nahen Parteien;
Die Regierung Otto von Bismarcks überreicht eine Mitteilung an die europäischen Kolonialmächte über die Besitzergreifung von bestimmten Orten in Westafrika.
November:
Eröffnung der Westafrika-Konferenz („Kongo-Konferenz“) in Berlin.
1885
Februar:
Beendigung der Westafrika-Konferenz in Berlin; Abkommen über Handelsverträge und über die Aufteilung des afrikanischen Kontinents in europäische Einflusszonen; Errichtung der Kolonie Deutsch-Ost-Afrika (heutige Republik Tansania). Auf dem Bild unten: Askari-Söldner:
1888-1891
Gründung der „Deutschen Kolonialgesellschaft“ / DKG (1888);
Einrichtung der Kolonial-Abteilung im Auswärtigen Amt (1890);
Aufstände in Deutsch-Ost-Afrika; (1891 bis 1907) Aufstände in Kamerun (1890 bis 1898).
1896-1902
„Erste deutsche Kolonialausstellung“ im Treptower Park in Berlin, etwa 100 afrikanische Vertragsarbeiter aus allen deutschen Kolonien sind anwesend (1896);
Überreichung einer Petition gegen die deutsche Kolonialpolitik in Kamerun durch die Londoner „African Association“ an Kaiser Wilhelm II (1898);
Besuch der Duala Könige Manga Bell und Dika Akwa in Berlin (1902);
Überreichung von Petitionen an die Kolonial-Abteilung im Auswärtigen Amt (1902).
1904-1905
Gründung der Deutsch-Westafrikanischen Bank in Berlin durch ein Konsortium unter der Leitung der Dresdner Bank. Eröffnung von Zweigstellen in den deutschen Kolonien Kamerun und Togo (1904);
Aufstände der Gruppen Khoikhoin und Herero in Deutsch-Südwest-Afrika, Ermordung von etwa 75.000 Herero (1904 bis 1906);
„Maji Maji“-Aufstand auf den deutschen Baumwollplantagen in Deutsch-Ost-Afrika, Ermordung von etwa 200.000 Menschen in den Aufstandsgebieten (1905 bis 1908);
Überreichung von Petitionen gegen die deutsche Kolonialpolitik durch Könige und Amtsträger aus Togo und Kamerun an die Reichsregierung (1905).
1906-1907
Überreichung einer Petition gegen die deutsche Kolonialpolitik durch den Kameruner Bevollmächtigten Prinz Ludwig Mpundo Akwa an die Reichsregierung (1906); Reichstagswahlen (1907): Sieg der Befürworter der deutschen Kolonialpolitik, Errichtung eines eigenständigen Kolonialministeriums: Reichskolonialamt im Auswärtigen Amt;
Hinrichtung von sechs Aufständischen in der Kolonie Kamerun (1907).
1911-1914
Petitionen gegen die deutsche Kolonialpolitik von Togoer Königen, Amtsträgern und Geschäftsleuten an die Reichsregierung (1911);
Hinrichtung von etwa 200 aufständischen Amtsträgern – darunter Rudolf Duala Manga Bell, Ludwig Mpundo Akwa, Mandola von Groß Batanga, Martin-Paul Samba – in der deutschen Kolonie Kamerun (1914).
* * *
Die Geschichte des ehemaligen Deutsch-Südwestafrika
Klaus Perschke schreibt in Band 41e dieser gelben Reihe:
An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit unternehmen, die Geschichte Südwestafrikas unter die Lupe nehmen, denn damals 1955 hatte ich keinerlei Vorstellung über die Gründungsmotive der kaiserlichen Regierung in Berlin gehabt. Kurz nach dem 2. Weltkrieg wurde in den Jahren von 1945 bis 1951 die Vergangenheit der deutschen Geschichte nach politisch korrekten Kriterien aufgearbeitet. Das untergegangene Kaiserreich wurde auf jeden Fall ausgeblendet. Auch das Thema „Deutsche Kolonialpolitik“ war während meiner Schulzeit für uns genauso tabu. Die Frage „Wie kamen Deutsche Siedler nach Südwestafrika“ hat meines Erachtens der Historiker Bernd G. Längin mit seiner wissenschaftlichen Dokumentation „Die deutschen Kolonien, Schauplätze und Schicksale 1884 bis 1918“, herausgegeben im Mittler-Verlag, sehr sachlich beantwortet. Er hat auch den Finger in eine Wunde gelegt, die gern von den deutschen Historikern verharmlost, verniedlicht und auch verdrängt wurde. Die Wunde hieß „Herero-Krieg“, ein unrühmliches Blatt in der kaiserlichen Kolonialpolitik. Dabei wurden Tausende von Hererofamilien auf Befehl des in Deutsch-Südwest amtierenden und völlig durchgeknallten Generalleutnant Lothar von Trothar, Spross einer adligen Magdeburger Militärfamilie, 1904 in die Wüste getrieben, wo sie mangels Wassers elendiglich verdursteten und umkamen.
Also wie fing alles an? Ich hatte lange gegrübelt und nach einen Stichwort, oder Aufhänger gesucht. Und da fiel mir der Begriff „Tante-Emma-Laden“ ein. Ja, das ist der richtige Einstieg. Denn die erste „Handelsniederlassung“, die ein Bremer Kaufmann namens Lüderitz durch seinen bevollmächtigten Geschäftsführer, Herrn Heinrich Vogelsang aus Bremen, damals gründete, war nichts anderes als eine Art Tante-Emma-Laden am Rande der Wüste - und zwar in einer ziemlich ungemütlichen Gegend auf dem südwestlichen Kontinent Afrika, die offenbar von allen damaligen Kolonialmächten Europas bis dato gemieden worden war. Das an Angola angrenzende Amboland, das nach Süden folgende Damaraland und das bis an den Fluss Oranje angrenzende Groß-Namaland, dieses gesamte Gebiet wurde damals vom britischen Betschuanaland und von der Kap-Kolonie eingegrenzt. Dieses unbekannte Gebiet am südlichen Atlantik wurde grob definiert im nördlichen Teil von den „Schwarzen“, und im südlichen Teil von den „Gelben“, besiedelt. Die Schwarzen, das waren die Bantu sprechenden Hererostämme, alles groß gebaute, stolze und sehr eigen wirkende Menschen. Nach dem Zitat eines Oberleutnants der kaiserlichen Schutztruppe, Kurt Schwabe aus Münster, wurde allen gemein eine „unglaubliche Gier nach Alkohol, Lügenhaftigkeit, ihr Hang zum Diebstahl und ihre Unzuverlässigkeit – Ehre und Ehrgefühl haben die Herero nicht“ nachgesagt. Das klingt wie ein Vorurteil. Herr Längli, der Verfasser des Buches „Die deutschen Kolonien...“, weist an anderer Stelle auf einen weiteren Deutschen, Herrn Leutwein, hin: „Natürlich hat ein Volk, das den größten Bevölkerungsanteil im außertropischen Südwesten stellt, auch gute Seiten, Herero sind gastfreundlich.“ Alle nomadisierenden Hererostämme bestritten ihren Lebensunterhalt mit riesigen, wohlgenährten Rinderherden. Manche Häuptlinge brachten es zu ansehnlichem Reichtum in dem klimatisch günstigeren Norden, in dem es relativ häufigere Niederschläge gab als im Süden, also im Namaland, wo die Rinder auch genügend zu fressen fanden.
Die Gelben, das waren die „Nama“ und die vagabundierenden San, Wildbeuter und Sammler. Für die letzten hatten die Kapholländer das Wort „Bosjesmans“ erfunden, also „Leute, die hinter Zweigen wohnten“, woraus die deutschen Südwestler „Buschmänner“ machten. Die Nama lagen im Aussehen zwischen den Herero und den San. Sie hatten eine hellbraune bis gelbliche Hautfarbe und waren etwas kleiner als die Herero, dafür aber umso kriegerischer veranlagt. Auch sie waren ein Nomadenvolk, aber, bedingt durch den klimatisch ungünstigen, trockenen Lebensraum, ging es ihnen materiell nicht so gut wie den Hereros. Sie mussten den Gürtel enger schnallen. Statt mit fetten Rinderherden mussten sie sich mit Ziegen- und Schafherden zufrieden geben, die im Tauschhandel mit den durchziehenden burischen „Ossentrekkern“ nicht viel einbrachten. Die Nama wurden von den Buren auch verächtlich „Hottentotten“ genannt. Ursache dafür waren ihre beim Sprechen auftretenden merkwürdigen Schnalzlaute, worüber sich die Buren lustig machten.
Burische Ossentrekker zogen schon weit vor den ersten dort niedergelassenen Deutschen durch die Landschaft. Weiterhin traf man auch burische Großwildjäger, die sich oft Jacobs und Willem nannten, hier an. Außer den burischen Ossentrekkern kamen auch Vertreter der englischen Gesellschaft und Forscher aus der Kapkolonie über den Oranjefluss ins Land und nahmen die Geologie unter die Lupe, natürlich im Interesse der Krone. Leider fanden sie nichts entsprechend Lohnendes, weshalb man diese Einöde in den Besitz der Krone nehmen sollte.
Doch zum Lobe des Allmächtigen reiste aus der Kapkolonie auch Gottes Bodenpersonal ein. Da gab es den Ex-Bankier und Kaufmann Johan Keetman, der seinen Missionar Schröder im Auftrage der „Rheinische Mission“ die Station Keetmanshoop für die schwarzen Heidenkinder gründen ließ, weiterhin Carl Hugo Hahn und Heinrich Kleinschmidt, die im Namen des gelobten Herrn Jesus Christus über den Oranjefluss paddelten und nach Bethanien reisten, um Heidenkinder zu taufen.
Südwest, gleich nördlich des Oranjeflusses, ist trocken, trostlos und auch feindselig. Südwest ist Kaffernland, „Kaffern“, welches die Buren aus dem arabischen „Kafir“, ableiteten und was „Ungläubige“ bedeutete. „Verkaffern“ steht für „das Herabsinken des Europäers auf die Stufe eines Eingeborenen“, weiter, „Kaffernarbeit ist etwas, zu dem sich Weiße nicht herab lassen dürfen.“ Das war die damalige Situation. Aber gerade die Missionare legten den Grundstein für die spätere Kolonie. Gottes Sendboten wurden anfangs von den Hererostämmen immer wieder enttäuscht. Doch sie fassten immer wieder Mut, gründeten auf ihren Kreuzzügen fernab jeglicher Zivilisation Missionsstationen zusammen mit Handelsposten und Viehtransportstationen und bahnten durch die allmähliche Erschließung des Landesinneren den Weg für eine gezielte Besiedlung durch Weiße. Als erstes deutsches Siedlerpaar kam der Missionshandwerker Eduard Hälbich, ein 28 Jahre alter Schlesier mit seiner Braut Amalie Bartel in dieser von Gott verlassenen Gegend an, die sich „Otjimbingwe“ nannte. Er baute neben einem Schlachthaus das Warenhaus, baute eine Wagenmacherei neben der Schmiede, und so wurde Otjimbingwe zum wichtigsten Rastplatz für den gesamten Ochsengespannverkehr zwischen dem Landesinneren und der Küste. Es sollten noch viele andere Missionsstationen kombiniert mit Handelsposten und Rastplätzen folgen.
Das Hereroland, also das innere Hochland nördlich des Swakop bis in die weiten Weidelandschaften am Waterberg, erlaubte den Hererostämmen die Großviehzucht. Das Namaland dagegen, südlich des Swakop bis zum Oranje, war trockenes Land, es dominierte der reinste Steppencharakter mit verbuschtem Land. Die Wasserstellen sind dort seltener anzutreffen, der Pflanzenwuchs dürftig. Die Küstenhottentotten hatten den Vorteil, Robben, Delphine und Pinguine verspeisen zu können. Die Binnenlandhottentotten dagegen mussten schon mal auf Schlangen, Eidechsen und Käfer zurückgreifen. Und natürlich hatte sich bei den Hottentotten herumgesprochen, dass die Herero fette Rinderherden besaßen. „Der kühne Handstreich nach einer Hereroherde hatte Tradition, Rinder stehlen ist so viel wie eine offizielle Kriegserklärung. Orlog machen war ein Dauerzustand.“ (Die deutschen Kolonien..., S. 104, 105)
Kapitän Jonker in der Hottentotten-Häuptlingsfamilie der Afrikaaner
Quelle: Längin B.: Die deutschen Kolonien, In Treue fest, Deutsch Südwest
Und an dieser Stelle kam Kapitän Jonker aus der Hottentotten-Häuptlingsfamilie der Afrikaaner im Pontok ins Spiel, denn dieser Fuchs setzte auf den geregelten Nachschub von Feuerwaffen, Kugeln, Pulver und Pferden (S.105). Er war ein echtes Pokerface, hart im Nehmen und verschlagen. Kapitän Jan Jonkers Handelsbeziehungen zu den burischen Wanderhändlern, den Ossentrekkern, waren gut. Die Buren gaben ihm Waren auf Kredit, woraufhin er sich von ihnen aber auch abhängig und manipulierbar machte. Elfenbein als Zahlungsmittel war knapp geworden. Diese Umstände zwangen ihn zum Handeln und zwangen ihn in das Räuber- und Kriegerleben. Es waren die Hererorinder, die er mit seinen Unterhäuptlingen immer wieder den Buren zutreiben musste. Und Jonkers besiegte ständig die Hererohäuptlinge. Als Jonkers 1861 starb, änderte das am Waffen-Rinder-Handelskreislauf nichts. Erst sein Enkelsohn Christian unterlag einem Hererohäuptling bei Otjimbinwe. Er wurde getötet. Die Hottentotten griffen Otjimbinwe erneut an, alle weißen Siedler und Missionsangehörigen mussten sich durch die Flucht retten. Die Hottentotten (Nama) tauschten damals in einem Monat zirka 4.000 Rinder bei den Buren gegen Waffen und sonstige Waren ein. Die Hererostämme besiegten die Nama erst bei Okahandja und bei Otjikango. Orlog führen war ein verdammter Kreislauf von biblischer Brutalität, war aber auch ein lohnendes Geschäft für die durchtriebenen Burenhändler.
Leute, wie die Missionare Hahn oder Kleinschmidt sahen darin etwas wie eine Vorstufe zum Jüngsten Gericht. 1885 stellte sich „Kamaherero“, der Häuptling der Akahandja-Herero, unter den Schutz deutscher Siedler. Düstere Zeiten in Süd-West. Noch gab es die legendäre Schutztruppe des Kaiserreichs nicht, doch es sollte nicht mehr lange dauern, bis sie in Erscheinung traten und an dieser Küste landeten.
Adolf Lüderitz an Bord seiner Brigg TILLY, 1883
Quelle: Bernd G. Längin, Die deutschen Kolonien, Schauplätze und Schicksale 1884-1918, Verlag E.S. Mittler & Sohn GmbH, Hamburg, Seite 109
Erst jetzt tauchte die legendäre Gestalt namens Adolf Lüderitz auf der Bühne der Geschichte auf, eine Mischung aus Geschäftsmann, Handelsreisender und Marketing-Abenteurer. Als junger Mann hatte er sich in der „Neuen Welt“, also den Vereinigten Staaten von Amerika, umgesehen. Er hatte den Tabakmarkt in Virginia studiert, dann in Mexiko eine Farm geführt, wurde Opfer einer Revolution und kehrte abgebrannt nach Deutschland zurück. In Bremen heiratete er eine steinreiche Hanseatenbraut, übernahm das Tabakgeschäft seines verstorbenen Vaters und investierte das geerbte Geld in eine „Faktorei“ in Lagos–Nigeria. Dieser Schritt führte ihn in den westafrikanischen Handel ein. Lüderitz lernte einen weiteren Abenteurer kennen, nämlich den abgebrannten Kapitän zur See Timpe. Auf dessen Vorschlag, mit westafrikanischen „Wilden“ Geschäfte zu machen, kaufte er sich die 260-to-Segelbrigg „TILLY“. Vordergründig dachte man an den Ankauf von Elfenbeinzähnen, doch der „Erwerb von herrenlosem Land“ wurde auch ins Visier genommen.
Als dritter Heißsporn gesellte sich zu den beiden der 21jährige Handelsgehilfe Heinrich Vogelsang, auch ein Bremer, eine Art Marketingstratege (würde man heute sagen) und Fantast, der sich zutrauen wollte, Togo als deutsche Kolonie zu gewinnen. Von hier bis zur Erkenntnis, dass Südwestafrika das gesündere Klima hat, war es nicht weit. Man einigte sich also auf den Südwestteil des Kontinents. Die Reise konnte losgehen.
Heinrich Vogelsang
1983 traf die Brigg „TILLY“ unter dem Kommando von Kapitän Timpe und dem Bevollmächtigten der Firma F.A.E. Lüderitz, Heinrich Vogelsang, in der Bucht Angra Pequena (die enge Bucht) ein. Eng war die Bucht tatsächlich, denn auf den vorgelagerten Inseln hatten sich bereits die Kapholländer und Briten als Seehundsjäger niedergelassen. Der 21jährige Vogelsang ließ sich jedoch nicht verdrießen. Immer positiv denken und optimistisch bleiben! Nach dem Ankern ließen sie abends überschwänglich die Becher kreisen.
Die Weichen zu dieser weiteren Entwicklung hatten also damals dieser Bremer Großkaufmann, weiter unser deutscher krankhaft geltungssüchtige Kaiser Wilhelm II, das aristokratisch geprägte und abenteuerwillige Offizierskorps, die kaiserliche Marineleitung, der damalige Reichskanzler, Fürst Otto von Bismarck, die Politiker im Reichstag und das deutsche Großbürgertum gestellt. Also Wirtschaftsunternehmer, welche den Gedanken einer Kolonialbewegung schürten und Deutschlands Eintritt in die Reihe der Kolonialmächte im Reichstag forderten, damit der deutschen Wirtschaft neue Absatz- und Rohstoffmärkte erschlossen werden konnten und „der Aderlass an kostbarem deutschen Blut (Auswanderer nach Amerika) durch Umleitung der Auswandererströme in koloniale Neuerwerbungen des Reiches ein Ende finden“. Und ausgerechnet Dr. Fabri, der Inspektor der in Südwestafrika tätigen „Rheinischen Mission“, dessen Veröffentlichung „Bedarf Deutschland der Kolonien?“, weckte das Interesse weiterer Kreise in der Wirtschaft. In diese Zeit fällt auch die Gründung eines ersten deutschen Kolonialvereins mit der Tarnbezeichnung „Zentralverein für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Ausland.“ (vergl. Walter Nuhn, Kolonialpolitik und Marine, Bernard & Graefe Verlag, Bonn, 2002, S. 30, 31.) Das heißt, jetzt erst begann sich das Räderwerk der Politik zu bewegen. Aber das Intrigenspiel der Diplomatie lief bereits auf vollen Touren.
Großbritannien und Frankreich hatten bereits 1882 ein auf eine Handelsmonopolstellung abzielendes Abkommen über die „Abgrenzung ihrer politischen und handelspolitischen Interessensphären an der Küste von Sierra Leone und nördlich davon“ im so genannten Sierra-Leona-Abkommen geschlossen. In diesem wurden den beiderseitigen Staatsbürgern „gleiche Vorzugsbehandlung“ dort zugesichert, während die dort Handel treibenden Bürger anderer Nationen, z. B. deutsche Kaufleute, mit hohen Zollsteuern belastet werden sollten. Weiterhin waren Frankreich und Großbritannien keineswegs daran interessiert, dass dem deutschen Kaiser auch ein Stückchen Land vom afrikanischen Kuchen zukommen würde. Im gleichen Jahr, bevor die Segelbrigg „TILLY“ Deutschland in Richtung Westafrika verließ, hatte sich am 16. November 1882 Herr Lüderitz an das Auswärtige Amt in Berlin mit der Anfrage gewandt, ob er für eine geplante Bremer Faktorei an der südwestafrikanischen Küste mit Reichsschutz rechnen könne. Doch das damals nicht gerade sehr kolonialfreundlich eingestellte Auswärtige Amt beantwortete Lüderitz’ Schreiben sehr schleppend. Die Herren Beamten waren, so wie heute immer öfter, total überfordert. Um den möglichen Risiken einer Benachteiligung deutscher Handelsinteressen in dieser Region entgegenzutreten, ersuchte Reichskanzler Fürst von Bismarck daraufhin die Handelskammern der Hansestädte Hamburg und Bremen um eine Stellungnahme zu diesem heiklen Thema. In dieser auf Initiative des uns bekannten Reeders und Großkaufmanns Adolf Woermann und mit Billigung der Bremer Handelskammer verfassten Schriftstückes wurde folgendes als unerlässlich festgehalten:
Abschluss von Freundschafts-, Schutz- und Handelsverträgen mit westafrikanischen Herrschern zur Sicherung des dortigen deutschen Handels. Stationierung von Kriegsschiffen an der Küste von Westafrika, Einrichtung eines Konsulats in Westafrika, Einrichtung einer Kohlenbunkerstation der Kaiserlichen Marine auf Fernando Po, sowie sofortige Inbesitznahme des Küstengebiets der Biafra-Bucht (Kamerun), zur Anlage von deutschen Plantagen- und Handelskolonien für den Fall, dass England dort als Wettbewerber auftritt.
Nach Erhalt dieses Schriftstücks stand der Reichskanzler jetzt in der Verpflichtung gegenüber den Wirtschaftsunternehmern des Reiches. In der Angelegenheit „Lüderitz“ lässt Bismarck, um angesichts der unklaren Besitzverhältnisse Verwicklungen mit England zu vermeiden, am 4. Februar 1883 in London anfragen, ob die Regierung Ihrer Majestät an der Küste Südwestafrikas nördlich des Oranjeflusses bis südlich von der – schon damals britischen – Walvish Bay Hoheitsrechte ausübe, und, wenn ja, ob sie nicht die geplanten Besitzungen des Herrn Lüderitz dort unter ihren Schutz nehmen könne. Anderenfalls, so ließ der Kanzler durchblicken, würde sich das Deutsche Reich die Ausübung dieses Schutzes vorbehalten. Bismarck war ein Fuchs. Diese Note an London war so abgefasst, dass dort der Eindruck geweckt werden sollte, als ob die Reichsregierung den Schutz der deutschen Untertanen in Südwestafrika durch die Britische Krone begrüßen würde. Doch die Antwort der britischen Regierung war ziemlich vage und ausweichend. Britische Diplomaten waren auch ausgebuffte Füchse. Die Kapkolonie – die auch der britischen Krone unterstand – hatte zwar einige Niederlassungen an der südwestafrikanischen Küste, darunter Walvish Bay und auf einigen vorgelagerten Inseln, von denen aus Robbenfang getrieben wurde, doch außerhalb dieser Territorien könne sie keine Verantwortung für den Schutz deutscher Angehörige gewähren. Da London schon einmal – Ende 1880 – auf eine entsprechende Anfrage Berlins den Schutz der durch die blutigen Konflikte zwischen den Herero und den Nama bedrohten Stationen der Rheinischen Missionsstätten mit der gleichen Begründung abgelehnt hatten, setzte sich beim Reichskanzler Fürst von Bismarck der Gedanke durch, dass wie jeder deutsche Untertan in Übersee auch Lüderitz und seine geplanten Erwerbungen Anspruch auf Reichsschutz hätten. Daraufhin ließ er Lüderitz wissen, dass das Kaiserreich ihm und seinen Erwerbungen Schutz gewähren würde (siehe: Stunde null des deutschen Kolonialreiches: Kolonialgründung in Südwestafrika, in: Kolonialpolitik und Marine, Seite 40 -43).
Fort Vogelsang nach der Fertigstellung unweit des Ufers der Bucht Angra Pequena Aller Anfang war damals sehr schwer.
Quelle : Längin B.: Die deutschen Kolonien, In Treue fest, Deutsch Südwest
Zurück zur Landung des Handelsbevollmächtigten Vogelsang aus dem Hause Lüderitz in der Bucht von Angra Pequena. Herr Vogelsang hatte nach der Landung seine Mannschaft sofort angewiesen, eine vorgefertigte Faktorei – in der Art eines Tante-Emma-Ladens – zu bauen, damit er mit den dort lebenden Eingeborenen in den Tauschhandel treten konnte und nannte die Gebäude „Fort Vogelsang“.
Bald danach unternahm Herr Vogelsang einen fünftägigen Ritt ins Bethanierland, um dem Häuptling der Bethanier-Hottentotten einen Besuch abzustatten. Vermutlich hatten es die Geschenke des Herrn Vogelsang dem Kapitän der Bethanier-Hottentotten angetan, so dass beide in eine euphorische Stimmung kamen und sich während der Verhandlungen über Landerwerb einigten, dass Herr Vogelsang neben der gesamten Angra-Pequena-Bucht den dazugehörigen Küstenstreifen in Besitz der Firma Adolf Lüderitz nehmen durfte. Das geschah am 1. Mai 1883. Aber schon im August 1883 kam es zu einer zweiten Begegnung mit Kapitän Josef Fredericks. Bei diesem Landerwerbsvertrag vergrößerte sich der Lüderitz’sche Besitz beachtlich, immerhin vom Oranjefluss bis in den Norden zum 26. Breitengrad Süd und einer Breite ins Landesinnere von 20 geographischen Landmeilen, das hieß ca. 150 km. Der Preis für den Tausch waren Waren im Wert von 100 britischen Pfund Sterling und 200 Gewehre.
Doch, noch war es ja nicht deutsches Staatsgebiet. Adolf Lüderitz ersuchte Reichskanzler von Bismarck um den Schutz durch das Deutsche Reich.
Handschriftliches Telegramm von Reichskanzler von Bismarck an den Konsul Herrn Lippert in Kapstadt vom 24.April 1884
Quelle: Bernd G. Längin: Die deutschen Kolonien...,Verlag E. S. Mittler & Sohn, Hamburg, 2005, Seite 12
Die preußischen Herren Beamten in Berlin ließen sich wieder einmal unendlich viel Zeit. Diese brennende Angelegenheit sollte sich leider wieder ein ganzes Jahr hinziehen.
Kapitän Joseph Frederiks, der Häuptling der Bethanierhottentotten und Geschäftspartner von Herrn Vogelsang
Quelle: Längli, B., Die deutschen Kolonien, In Treue fest, Deutsch-Südwest, Seite 110
Da der britische Kolonialminister Lord Derby unterdessen die Kapkolonie zu Maßnahmen ermutigte, Adolf Lüderitz’ Landerwerb gewaltsam rückgängig zu machen und dieses dem Reichskanzler zu Ohren kam, war Schluss mit lustig. Der Reichskanzler wurde am 3. Juni 1884 durch den Konsul Lippert in Kapstadt von dem „Ränkespiel“ der Briten, die südwestafrikanische Küste von der Mündung des Oranjeflusses bis südlich von Walvish Bay zu annektieren, über den Korvettenkapitän Aschenborn, Kommandant des Kreuzer SMS „NAUTILUS“, gewarnt, woraufhin die SMS „NAUTILUS“ sofort zur Sondierung der Lage nach Angra Pequena entsandt wurde. Weiterhin sendete er ein Kabelgramm an den Konsul Lippert, in dem dieser aufgefordert wurde, der Kapregierung mitzuteilen, dass dieser Landerwerb des Herrn Lüderitz ab sofort unter dem Schutz des Deutschen Reiches gestellt wird.
Damit hatte die Geburtsstunde des deutschen Kolonialreiches geschlagen. Auf Anweisung des Reichskanzlers setzte daraufhin die Marineleitung am 21. Juni 1884 die gedeckte Korvette SMS „ELISABETH“, ein Kadettenschulschiff, mit Kurs Südatlantik in Marsch, mit dem Befehl, sich im Verein mit der auf der Heimreise von Ostasien befindlichen gedeckten Korvette SMS „LEIPZIG“ und dem bereits im Südatlantik befindlichen Kanonenboot, SMS „WOLF“, an der südwestafrikanischen Küste zu vereinen und den Küstenstreifen zwischen Oranjefluss und Angola endgültig in deutschen Besitz zu nehmen und einer britischen Annexion zuvorzukommen.
Korvette SMS „LEIPZIG“
Quelle : Längin B.: Die deutschen Kolonien, In Treue fest, Deutsch Südwest
Das denkwürdige Ereignis der offiziellen Flaggenhissung in der Bucht von Angra Pequena fand am 7. August 1884 statt. Der feierliche Hoheitsakt wurde von den Besatzungen der Korvetten SMS „LEIPZIG“ und SMS „ELISABETH“ vollzogen.
Dieser Hoheitsakt brachte großes Aufsehen in der in- und ausländischen Presse, löste aber Begeisterung im deutschen Volk aus, aber auch einen beträchtlichen außenpolitischen Wirbel, besonders mit dem britischen Empire (vergleiche Walter Nuhn, Kolonialpolitik und Marine Seite 46, 47).
Kapitän zur See Raven von SMS Kanonenboot „WOLF“ bekam auch noch den Auftrag, im Rahmen einer kühnen Überraschungsaktion vom Nordufer der Swakopmündung bis an die Grenze von portugiesisch Angola an markanten Punkten deutsche Hoheitspfähle in den Boden zu schlagen. Dieser Coup war gelungen. Lüderitz hatte bereits zu diesem Zeitpunkt vom Topnaarkapitän Piet Haibib weiteres Land in den Grenzen der Breitengrade 22° bis 26° Süd Land für 20 britische Pfund Sterling erworben. Schon im September erkannte die britische Krone die deutsche Schutzherrschaft an. (vergl.: In Treue fest Deutsch-Südwest, Seite 111).
So sah der Zeichner damals das Ereignis der Kolonialgründung in
Südwestafrika
Quelle: Walter Nuhn, Kolonialpolitik und Marine, Bernhard & Graefe Verlag, Bonn, 2002, Seite 347
Eigentlich wäre ich jetzt mit der Nachhilfe im Geschichtsunterricht aus dem Kaiserreich am Ende. Doch nicht ganz. Es sollte noch einmal interessant werden mit dem Fortgang dieser Geschichte.
Quelle : Längin B.: Die deutschen Kolonien, In Treue fest, Deutsch Südwest
Herr Lüderitz klotzte ran, seine Leute errichteten in Aus, Kuibis und Bethanien eine Faktorei nach der anderen. Sie schlossen Kaufverträge ab und erwarben Minenrechte in geographisch grob und unklar begrenzen Gebieten. Lüderitz’ Agent Koch erwarb von dem Afrikaaner-Kapitän Jan Jonker den Platz Windhuk und das dazugehörige Weideland mit Ausnahme der Privatrechte des Stammes für 100 brit. Pfund Sterling. Das heißt, er hatte jetzt Landerwerb im Überfluss, aber auch gleichzeitig ein total verkorkstes Geschäft. Er war eigentlich pleite.
Angereiste Mineningenieure und Geologen fanden absolut keine abbauwürdigen Bodenschätze, kein Gold, kein Kupfer, kein Silber, kein Blei und keine Kohle, nur Sand bis Walvish Bay. Der Tauschhandel mit den Eingeborenen lohnte sich sowieso nicht. Irgendwann hatte er 1885 rund eine Million Goldmark in seinen afrikanischen Landbesitz gesteckt. Und als dann auch noch seine Brigg „TILLY“ aus Deutschland kommend mit teuren Bohrmaschinen an Bord in der Einfahrt der Angra-Pequena-Bucht auf dem Angra-Riff auflief, Wasser machte und sank, da sank auch der gute Stern des Adolf Lüderitz. Seiner Firma ging die Puste aus, und er verkaufte im April 1885 große Teile seiner Besitzungen mit den dazugehörigen Minenrechten an die Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika. Den neuen Herren der alten Erde wurde von Berlin aus die Landeshoheit übertragen. Adolf Lüderitz, der hanseatische Großkaufmann aus Bremen, gab trotzdem nicht auf. Im Juli brach der nicht mehr so junge Hanseat von Aus zu einer Expeditionsreise per Ochsengespann zusammen mit Bergwerksingenieur Iselin, dem Seemann Steingröver und dem Faktoreileiter Müller in den Süden zum Oranjefluss auf, um Mineralien zu suchen. Am Ufer des Oranje bestiegen Lüderitz und Steingröver ein Faltboot, um damit den Fluss auf seine Schiffbarkeit zu untersuchen. In seinem letzten Brief an die zurückgebliebenen Kollegen schrieb er: „Der Fluss ist hübsch und romantisch, macht uns aber viel Arbeit, da wir 52 Stromschnellen zu überwinden hatten.“ Beide Kanuten übernachteten auf der Farm des Buren Kort Doorn, verließen dann das Festland und waren seitdem verschollen geblieben. Das war das Ende des Großkaufmanns aus Bremen im Mündungsgebiet des Oranjeflusses (siehe: In Treue fest – Deutsch-Südwest, Seite 112,113).
Doch zurück zur Gründung der Schutztruppe, denn sie war jetzt notwendiger denn je. Zuerst wurde eine private Schutztruppe, die aus deutschen Siedlern bestand, rekrutiert und aufgestellt, die sich den aufständigen Hereros und Namas entgegenwarf und die Weißen verteidigten sollte. Als diese ihre Unterlegenheit gegenüber den kriegerischen Eingeborenen nach Berlin telegrafierten, kam endlich Bewegung seitens der Reichsregierung und des Militärs ins Spiel. Ein Herr Heinrich Ernst Göring aus Emmerich wurde vom Kaiser zum Reichskommissar von Deutsch-Südwestafrika ernannt.
Man sollte die Kolonie befrieden, die ausgebrochenen Unruhen der Herero- und Namastämme niederschlagen. Doch der „gelbe Hendrik“ (Häuptling der Namastämme), einer der verwegensten Räuber in Deutsch-Südwest, und der „weiße Wilhelm“ waren als König und Kaiser von Gottes Gnaden für zwei verschiedene Reiche bestimmt. Keiner kannte den anderen, wahrscheinlich hätten sie sich auch gegenseitig gehasst, weil beide große Dickköpfe waren. Als die deutschen Südwestler Hendriks Waffenhandel unterbinden wollten, vertrat der Nama furchtlos die Meinung, dass „der Mensch ein natürliches Recht auf das Tausch- und Prestigemittel Waffe habe, ebenso wie auf Sonne und Regen!“ (vergl.: In Treue fest, Deutsch-Südwest, Seite 114.)
Estorffs legendärer Kavallerietransport. 1894 kamen sie mit dem Dampfer „JULIA BOHLEN“ in Swakopmund an, allerdings ohne Pferde. Die Logistik hatte noch nicht einwandfrei funktioniert. Einige Herren mussten zu Fuß von Swakopmund nach Windhuk marschieren, da an der ganzen Küste keine Pferde aufzutreiben waren. (Wahrscheinlich hatten einige Herren bei diesem Spaziergang runde Füße bekommen. Anmerkung des Verfassers) siehe: In Treue fest, Deutsch-Südwest.
Quelle : Längin B.: Die deutschen Kolonien, In Treue fest, Deutsch Südwest
Nachfolgender Reichskommissar von Herrn Göring wurde der aus Strümpfelbrunn im Odenwald stammende Kommandeur der Schutztruppe und Gouverneur Theodor Leutwein
Jetzt war eine militärisch gedrillte Schutztruppe gefordert, die per Schiff aus Deutschland nach Deutsch-Südwest transportiert wurde. Die angereisten Herren in ihren Paradeuniformen waren in bester Stimmung und glaubten, ein leichtes Spiel mit den Hereros und den Namas zu haben.
Doch Hochmut kommt vor dem Fall. Der Schuss ging zunächst nach hinten los! Auch diese Elitetruppe erlebte enorme Verluste, da die kriegerischen Reiter der Namastämme sich in der Geographie des Landes besser auskannten und gut bewaffnet waren. Die Herren in ihren Ausgehuniformen, alles kleine Wilhelms, mussten anfangs bitteres Lehrgeld bezahlen. Mancher Schutztruppler hauchte im Wüstensand sein Leben aus. Man brauchte mehr Militär aus der Heimat, und man brauchte ein Mittel zum schnelleren Transport innerhalb des Landes. Um die Schutztruppler in Zukunft schneller zu allen Brennpunkten der ausgebrochenen Unruhen der Herero- und Namaaufstände zu bringen und Nachschub von der Küste ins Inland zu befördern, beschloss die Deutsche Kolonial-Gesellschaft, eine Eisenbahnlinie zu bauen. Ausgangspunkte waren Swakopmund in der Mitte der Küste und Lüderitzbucht im Süden. Die Eisenbahntrasse wurde von Angehörigen der Schutztruppe und von „Bastardeinheiten“ von der Küste ins Inland verlegt. Bastardeinheiten bedeutete im Beamtendeutsch „Mischblut-Stammkompanien“. Die Herrenmenschen beschäftigten Mischblutangehörige, weil sie sie dringend nötig brauchten. Es gab also bereits Mischehen, allerdings waren diese auch verpönt bei den Deutschen und den Buren. Auf jeden Fall wurde der Bau der Eisenbahnstraße eine große Herausforderung der Herren.
Ein noch größerer Feind als die Eingeborenen war die Natur. Wanderdünen machten ihnen an der Küste bei Lüderitzbucht das Leben zur Hölle. Immer, wenn eine Trasse fertig gelegt war, passierte es, dass ungünstige Winde die Wanderdünen in Bewegung setzten und die Trasse unter dem Sand begruben. Und diese mussten immer wieder von den Pionieren freigeschaufelt werden. Doch jetzt kamen die Herren Ingenieure auf eine glorreiche Idee. Es wurden Streckenposten eingerichtet. Alle 20 km wurden an der Trasse im Umkreis von Lüderitzbucht Bahnmeisterposten eingerichtet, die von einem Bahnmeister mit einem angestellten Hottentotten, also einem Angehörigen der Nama, kontrolliert wurden. Die Eisenbahn fuhr damals, man schrieb bereits das Jahr 1908, zweimal die Woche von Lüderitzbucht nach Kalkfontein fast an der Grenze des Oranjeflusses.
Und dann passierte etwas, womit in Deutsch-Südwest und im kaiserlichen Berlin mit seinem Hang zu Militärparaden niemand gerechnet hatte. Der Glückspilz der Stunde am 8. Mai 1908, also 23 Jahre nach Adolf Lüderitz’ Abflug ins Nirwana, war einer dieser Bahnmeister und Angestellten der Kolonial- und Eisenbahnbau-Gesellschaft Lenz & Co., August Stauch.
Stauch war mit seinem farbigen Streckenarbeiter Zacharias Lewala mit der Draisine auf der Strecke unterwegs, als dieser Zacharias während einer Verschnaufpause im Kiessand bei Kolmanskuppe ein paar wasserklare Klippies fand, die – nach eingehender Prüfung des kaiserlichen Regierungsgeologen Paul Range – die saubersten Diamanten waren, die er je gesehen hatte, also Diamanten, die der Oranjefluss vor Millionen Jahren ins Meer gespült hatte und die von Wind und Wellen zurück an Land getragen und nun im Wüstensand versteckt lagen.
August Stauch
Die daraufhin verbreitete Nachricht vom Hottentottenparadies löste einen Diamantenrausch unter den deutschen Glücksrittern und Spekulanten aus. Bahnmeister Stauch ergriff die Chance seines Lebens und kaufte sich das Schürfrecht über ein Gebiet von 75 qkm. „Die Diamanten in ihrer ganzen breiten Aussaat fanden in den nächsten sieben Monaten die zähen Lüderitzbuchter unter einem fast übermenschlichen Aufwand an Energie“ (Grimm). „Jeder lag im Sand und scharrte, verwegene Gestalten hinter jeder Klippe“. In Kolmanskuppe entstand eine blühende Diamantenstadt. „Es ist genug da für alle, man braucht sich doch nur danach zu bücken, am besten vormittags vor dem Einsetzen des Nebels“ (siehe: In Treue fest – Deutsch-Süd-West, Seite 148). Herr Stauch wurde der „Diamantenkönig“ genannt. Er gab die Streckenfahrerei sofort auf, gründete damals mit deutschen Geldgebern die Koloniale Bergbau-Gesellschaft und brachte es in kürzester Zeit zum ersten Millionär von Deutsch-Südwest. Ein cleverer Junge, dieser Herr Stauch.
Doch jetzt wachten auch die verschlafenen Beamten in Berlin auf! Der Reichskanzler und der Kaiser erkannten den kommenden Geldsegen und machten sofort Schluss mit der Schürfrechtvergabe. Im September 1908 wurde ein 100 km breiter Küstenstreifen zwischen dem Oranje und dem 26. Breitengrad Süd zum Sperrgebiet erklärt. Das deutsche Kapital wurde - wie immer - gierig. „So, wie die Dernburgsche Sperrverfügung dem Großkapital für die Ausbeutung der Diamantenfelder den Löwenanteil zusicherte, so schlug sie auch – Zuwiderhandlungen wurden nach § 90 der Bergwerksverordnung mit 500 Mark Strafe oder mit Haft geahndet – dem kleinen Mann damit ins Gesicht.“ 1909 kam es zur Gründung der Deutschen Diamanten–Gesellschaft. Eine typische beamtendeutsche Diamantenfund-Registrier-Gesellschaft erhielt das Monopol zur Vermarktung und diente als Sammelstelle. Während Buren und Engländer voller Habgier und Neid über die Grenze blickten, wurden Lagerstätten in Elisabethbucht, Pomona, Bogenfels und Charlottental abgebaut. Zwischen 1908 und 1913 wurden 4,7 Millionen Karat im Wert von rund 150 Millionen Reichsmark gewonnen, also etwa ein Fünftel der damaligen Weltförderung von Diamanten (vergl.: In Treue fest – Deutsch-Südwest, Seite 149). Es hätte mit den sprudelnden Einnahmen aus dem Diamantenhandel damals noch jahrelang so weitergehen können, denn der schöne Wilhelm benötigte diese Finanzspritze aus dem Wüstensand aus Deutsch-Südwest. Immerhin kostete der Aufbau seiner ultramodernen Kriegsflotte ein Vermögen. Und hätte nicht, ja, hätte nicht dieser bornierte Imperator von Gottes Gnaden sich 1914 durch den unseligen Beistandspakt mit dem k. u. k Kaiser Franz-Joseph, auch von Gottes Gnaden, in den völlig überflüssigen Krieg zwischen Österreich und Serbien hineinziehen lassen, sondern diesen bereits heraufziehenden Konflikt von vorneherein energisch abgewehrt. Aber diese Courage hatte er leider nicht! 1918 war Deutsch-Südwest futsch, die Einnahmen aus dem Diamantenhandel waren futsch und seine stolze Kriegsflotte war auch zu 80 Prozent von der Royal Navy versenkt worden. Weiterhin waren ihm auch seine engsten Militärberater abhandengekommen, die ihm den ganzen Schlamassel eingebrockt hatten, und er selbst musste abdanken, um in Holland aus lauter Frust Holz zu hacken. Es hätte nie einen Versailler Vertrag gegeben, nie die schlimmen zwanziger Notjahre und nie wären Adolf Hitler und seine Nationalsozialisten 1933 an die Macht gekommen. Leider hatten Wilhelms militärische Ratgeber Ludendorff und Hindenburg ihm den falschen Weg gewiesen bzw. sogar diktiert. Und das kostete bei Ausbruch des I. Weltkriegs den Deutsch-Südwestlern ihre Heimat. Sie wurden binnen kurzer Zeit von einer militärischen Übermacht aus der Kapkolonie überrannt und enteignet. Möglich, dass diese Diamantenfunde eine bedeutende Rolle beim Ausbruch des Krieges gegen das Kaiserdeutschland gespielt hatten. Doch das ist mein rein subjektives Gedankenspiel. Nur, nachdenklich macht es im Nachhinein allerdings, dass das seit 1918 weltweit größte Diamanten-Imperium „De Beers“ bis heute der einzig verbliebene private Nutznießer der Diamantenabbaufelder geblieben ist. Man darf sich doch darüber ein paar Gedanken machen - oder nicht? Haben wir Deutschen etwas aus der vergangenen Weltgeschichte dazugelernt? Leider bis heute nicht allzu viel.
Das waren einige Seiten Nachhilfe in Geschichtsunterricht über Südwestafrika. Hoffentlich verzeihen meine Leser mir diesen Exkurs in die Vergangenheit.
* * *