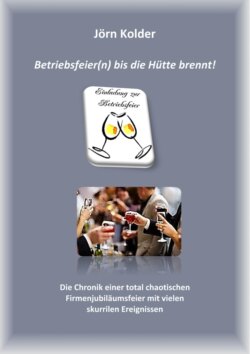Читать книгу Betriebsfeiern(n) bis die Hütte brennt! - Jörn Kolder - Страница 3
Die Firma
ОглавлениеErwin Kunze hatte sich in seiner 17jährigen Betriebszugehörigkeit kontinuierlich den Ruf eines absoluten Arschlochs erarbeitet. Besonders mühselig war das nicht gewesen, denn die „KME Export-Import GmbH“ (KME stand für „Klein Maschinen Elemente“) war ein überschaubarer Betrieb, in dem so im Schnitt dreißig Leute arbeiteten und man sich demzufolge zwangsläufig fast täglich über den Weg lief und die Eigenarten der anderen zur Genüge kannte. Von dem beschäftigten Personal arbeitete die überwiegende Anzahl, nämlich so um die zwanzig Leute, jeweils in der Beschaffung und im Vertrieb im Innendienst. Diese Mitarbeiter spürten Bedarfe an Maschinenteilen auf und organisierten die Transaktionen zu den Nachfragern, so dass sie Beschaffung und Vertrieb gleichermaßen übernahmen. Fünf von ihnen hatten Kontakte zu ausländischen Firmen in der jeweiligen Landessprache. Drei Angestellte waren für das Rechnungswesen verantwortlich, vier stellten den Außendienst sicher und zwei bewirtschafteten das Lager. Dazu kamen noch die Sekretärin des Geschäftsführers, der Controller und ein Mann für die IT, der Systemadministrator. Das Geschäftsmodell der „Klitsche“, wie die Mitarbeiter ihre Brotquelle nicht sonderlich respektvoll bezeichneten, ging auf den Inhaber, Friedhelm Richter, zurück.
Richter war jetzt 84 Jahre alt und verfügte neben seiner ausgeprägten Vorliebe für unverdünnten Gin über ein weiteres herausstechendes Merkmal, nämlich eine wie im Zeitraffer zunehmende Senilität, die bei seinen häufigen Besuchen im Betrieb immer mehr sichtbar wurde. Hinter seinem Rücken nannten ihn die Angestellten recht despektierlich den „Alten Trottel“. 1930 geboren und noch mit 15 Jahren zum Volkssturm eingezogen, war der alte Mann durch und durch Pazifist, und wünschte sich eigentlich auch für seine Firma eine produktive, friedvolle und harmonische Arbeitsatmosphäre. Er lag allerdings weit daneben wenn er vermutete, dass dies tatsächlich an dem wäre.
An diesem Zustand war der von ihm als Geschäftsführer eingesetzte Hubertus Kriegel nicht ganz unschuldig. Kriegel hatte vor kurzen seinen 56. Geburtstag gefeiert und war Richters Schwiegersohn. Abgesehen davon, dass Kriegel für sein Alter mehr als passabel aussah, brachte der Mann keinerlei weiteren Talente mit, außer einem ordentlichen Handicap beim Golfspielen und einem Faible für modische und teure Anzüge. Kriegel hatte man den Spitznamen „Das tapfere Schneiderlein“ verliehen. Bettina Kriegel, seine stockhässliche Gattin, erschien mehrmals in der Woche im Büro ihres Gatten und ließ sich offensichtlich von diesem in Modefragen beraten, denn bei ihren nächsten Besuchen führte sie dann jedes Mal neue Sachen vor. Da sie mit Vorliebe protzigen Schmuck trug, wurde sie „Die Goldmarie“ genannt. Wahlweise konnte man ihr auch den Namen „Die Kleckserin“ geben, denn in unregelmäßigen Abständen tauschte sie ihre selbst gefertigten und furchtbaren Bilder in den Büroräumen aus. Manchmal kreuzte auch noch ihr Sohn Gunter in der Firma auf, der zwar das gute Aussehen von seinem Vater geerbt hatte, aber wegen seiner arroganten Art kurz und bündig „Der Arsch“ tituliert wurde.
Friedhelm Richter hatte sich nach dem Krieg in einigen Betrieben als Angestellter nützlich gemacht und bald erkannt, dass in der schnell wieder auf die Beine kommenden Wirtschaft mehr drin sein könnte, als ein schmaler monatlicher Lohn. Der junge Mann war zu diesem Zeitpunkt ausgesprochen tatkräftig. Deutschland war schon immer führend im Werkzeugmaschinebau gewesen und Richter schlussfolgerte, dass dieser traditionsreiche Industriezweig das Wachstum noch weiter anfeuern würde. 1954 hatte er etwas zusammengespart (Geld konnte ihm niemand leihen, da Richter durch die Kriegsereignisse Vollwaise war) und gründete die „F. Richter Export-Import GbR“. Der einzige Angestellte zu diesem Zeitpunkt war er selbst.
In einem mit Aktenschränken vollgestopftem Büro hing Richter fast den ganzen Tag am Telefon und klapperte die Unternehmen nach Nachfragewünschen in Bezug auf Maschinenteile ab. Die Bestellungen notierte er fein säuberlich auf einer jeden Tag neu anzulegenden Karteikarte. Richter hatte stets zugesagt, die gewünschten Teile beschaffen zu können, obwohl das damals ein schwieriger Akt war. Während er durch seine Telefonate auf der einen Seite Nachfrage generierte, musste er diese auf der anderen Seite aber auch durch Lieferung befriedigen. Also rief er bei in Frage kommenden Unternehmen an. Hatte er ein Geschäft soweit vorbereiten können, schaltete er Horst Bachmann ein.
Bachmann war ein knorriger Mann von schätzungsweisen 45 Jahren und hatte im Krieg einen Unterschenkel eingebüßt, weswegen er schlecht zu Fuß war. So lag es für ihn nahe, sich mit Maschinenkraft zu bewegen. Bachmann war zudem gelernter Maschinenschlosser und hatte sich bald nach Kriegsende aus verschiedensten Teilen erst einen, und dann noch einen zweiten kleinen Laster zusammengebaut. Das war nicht einfach gewesen, aber Bachmann besaß derartig gute Improvisationsfähigkeiten, dass er Teile verschiedenster Herkunft kombinieren konnte. Der Tank seines ersten Lasters stammte beispielsweise von einem zerschossenen Wehrmachtskrad, das Lenkrad aus einer demolierten Zugmaschine. Das größte Problem waren damals die Reifen gewesen, aber irgendwie hatte sie Bachmann dann doch noch auftreiben können. Er hatte noch einen alten Kriegskameraden angeheuert und die beiden transportierten dann alles Mögliche, konnten sich aber mehr schlecht als recht über Wasser halten, weil die Nachfrage nur sporadisch war.
Das änderte sich, als Richter eines Tages einen Auftrag an Bachmann vergab. Das Teilebeschaffungsgeschäft lief immer besser an und Richter hatte zwei Leute einstellen müssen, um die Transaktionen bewältigen zu können. Da er emsig war und für sich selbst und seine Leute die Devise ausgegeben hatte, auch das Unmöglichste möglich zu machen, hatte es sich schnell rumgesprochen, dass auf Richters Firma Verlass war. Er musste demzufolge bald eine größere Bürofläche anmieten und abermals Leute einstellen. Auch Bachmann profitierte von diesem Aufschwung und konnte dann auch den ersten von ihm selbst zusammengebastelten Laster verschrotten und einen neuen kaufen.
Friedhelm Richter war bald klar geworden, dass er immer ein kleiner Krauter bleiben und eventuell von größeren Konkurrenten geschluckt werden würde, wenn er seinen Radius nur auf die Großstadt und deren Umland beschränken würde. Momentan war das zwar noch ausreichend, aber der Mann dachte weiter. 1963 stellte er zwei neue Leute ein. Paul Yates war nach dem Krieg in Deutschland hängengeblieben und nicht wie seine Offizierskameraden nach England zurückgekehrt. Dafür hatte er zwei Gründe gehabt. Das ständig miese Wetter auf der Insel und Helga Bräuer. Ähnlich war es Jean Travidue gegangen, den es aus irgendwelchen Gründen, über die er aber nie sprach, nicht mehr nach Frankreich zurückgezogen hatte. Yates sprach naturgemäß perfekt Englisch, Travidue neben Französisch noch Spanisch und Portugiesisch und konnte auch ganz gut Italienisch parlieren. Die „KME Export-Import GmbH“ streckte ihre Finger somit also schon damals vorsichtig in andere Länder aus.
Zu dieser Zeit bestand die nunmehr in eine GmbH umgewandelte Firma aus immerhin schon fünfzehn Mitarbeitern. Richter war der ganze finanzielle Kram mittlerweile über den Kopf gewachsen, so dass Katrin Beyer in das Unternehmen kam, um sich um die Buchhaltung zu kümmern. Die Bilanzsumme betrug zu diesem Zeitpunkt knapp drei Millionen D- Mark. Forderungen und Verbindlichkeiten hielten sich in etwa die Waage, so dass die Liquidität nie in Gefahr war.
Richters Leute hatten bald eine gewisse Routine bei der Auftragsabwicklung erreicht, so dass sie zwar ganz ordentlich zu tun hatten, aber sich keiner so richtig den Arsch aufreißen musste. Es wurde noch entspannter, als gegen Ende der siebziger Jahre die ersten Computer Einzug in die Bürowelt hielten.