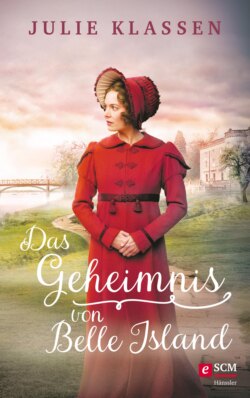Читать книгу Das Geheimnis von Belle Island - Julie Klassen - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 6
ОглавлениеAm nächsten Morgen wachte Benjamin erfrischt auf. Er sah sich verwirrt um, erkannte jedoch weder das Zimmer noch das fremdartige Geräusch der quakenden Wasservögel und das Hupen draußen vor dem Fenster. Die Läden standen offen, das Sonnenlicht fiel ungehindert herein – alles wirkte so anders als am gestrigen Nachmittag.
Als der Arzt ihm Ruhe verschrieben hatte, hätte er nie gedacht, dass er den ganzen Abend und die ganze Nacht durchschlafen würde. Die Reise und der Schwindelanfall hatten sehr an seinen Kräften gezehrt.
Er stand vorsichtig auf, prüfte, ob seine Beine ihn tragen konnten, und stellte erleichtert fest, dass sie wieder zuverlässig waren. Bei dem Gedanken daran, wie er sich bei seiner Ankunft blamiert und vor Miss Wilder und ihrem ärztlichen Freund als Schwächling erwiesen hatte, wurde ihm ganz heiß vor Verlegenheit.
Heute wird es anders, gelobte er sich. Dafür würde er sorgen.
Im Nachthemd – er erinnerte sich gar nicht, es angezogen zu haben – trat er ans Fenster und schaute hinaus. Staunend betrachtete er den Ausblick. Der Nebel von gestern war fort. Alles strahlte in leuchtenden Farben: Üppiger grüner Rasen erstreckte sich bis hinunter zu einem sanft dahinfließenden Flüsschen in dunklem Blau. Leuchtend gelbe Narzissen säumten das Ufer, blühende Kirschbäume fügten kleine rosa-weiße Farbkleckse hinzu.
Jenseits der Themse wirkte das Dorf Riverton wie eine entzückende Märchensiedlung – eine schmale Steinkirche mit efeubewachsenem Turm, eine Mühle, Dorflädchen, Stroh- und Ziegeldachhäuschen, wunderschön gelegen an einem sanften Hang, der sich hinter der Straße erhob, auf der er mit der Kutsche hergekommen war.
Das überfüllte, schmutzige London schien plötzlich unendlich weit fort. Eine Welt der Dunkelheit und der Schatten, verglichen mit dem lebhaften Aquarell vor seinen Augen.
Vorsicht … mahnte er sich selbst und dachte an die Aufgabe, die ihn hierhergeführt hatte. Dieser Besuch war kein privater Ausflug, so schön das auch wäre. Zudem war es möglich, dass sich in dieser lieblichen Szene vor ihm möglicherweise ein Mörder verbarg.
Nachdem er sich gewaschen hatte, nahm er ein Hemd aus seinem kleinen Koffer, zerknittert, aber sauber, und kleidete sich an. Gott sei Dank waren seine Hände wieder ruhig, während er sich rasierte und die Knöpfe schloss. Gerade band er seine Krawatte zu einem schlichten Knoten, da hörte er eine Kutsche unter dem Fenster vorfahren. Ein schlankes Gefährt, gelenkt von einem Postkutscher, überquerte die Brücke zur Insel.
Ein Schauer überlief ihn. Jetzt wurde es interessant.
Kurz darauf verließ er sein Zimmer und ging den Flur hinunter. An den Wänden hingen förmliche Porträts von Wilder-Vorfahren. Eine breite, mit Teppich ausgelegte Treppe führte hinunter in eine große Eingangshalle mit mehreren Türen und Fluren, die davon abgingen. Er hörte Frauenstimmen und folgte ihnen zu einer offenen Tür.
Dahinter erkannte er Miss Wilders Stimme: »Ich bin so erleichtert, dass ihr endlich da seid. Allmählich habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Wir hatten euch schon gestern erwartet.«
»Ich weiß. Es tut mir so leid.« Miss Lawrences Stimme klang zögernd. »Wir wurden, … wir wurden aufgehalten.«
»Auf dem Fest ist doch alles gut gegangen, hoffe ich?«
»Ja, angesichts des Ortswechsels in letzter Minute ist es ein wahres Wunder. Aber das ist nicht der Grund für unsere Verspätung. Tante Belle, ich muss dir leider eine schlimme Nachricht mitteilen.«
»Wenn es um Onkel Percivals Tod geht – das weiß ich bereits. Es ist schrecklich.«
Ein Moment respektvollen Schweigens verstrich, dann fragte Miss Wilder plötzlich: »Was meinst du mit dem kurzfristigen Ortswechsel? Fand das Fest denn nicht wie geplant in unserem Londoner Haus statt?«
Benjamin stand in der Tür eines zwanglosen Morgenzimmers. Drinnen saßen Isabelle Wilder und Rose Lawrence gemütlich beisammen und tranken Tee, ganz vertieft in ein angeregtes Gespräch. Mr Adair hatte mit ausgestreckten Beinen in einem Sessel Platz genommen, halb verborgen hinter einer Londoner Zeitung.
Miss Lawrence schüttelte den Kopf; ihre Augen sprühten vor Zorn. »Nein. Zum Schluss hat Onkel Percy es abgelehnt, wegen der Kosten.«
»Aber …! Das ist doch Tradition in unserer Familie. Dort haben deine Eltern ihre Verlobung gefeiert und davor meine Eltern.«
»Ich weiß. Ich habe auch versucht, es ihm zu erklären, aber er wollte nicht hören.«
»Meine Liebe, das tut mir so schrecklich leid. Du hättest es mir schreiben sollen.«
»Es kam ziemlich überraschend, da blieb dafür keine Zeit mehr. Zum Glück sind Christophers Eltern eingesprungen und haben ihr Haus zur Verfügung gestellt. Aber es war ein fürchterlicher Aufwand, noch allen Bescheid zu geben und das Geschirr und das ganze Essen, das Mrs Kittleson schon bestellt hatte, hinüberzuschaffen.«
»War es sehr peinlich?«
»Eigentlich nicht. Ich habe es auf Onkel Percys schlechten Gesundheitszustand geschoben.« Rose schlug eine Hand vor den Mund. »Oh! Ich hätte mir nicht träumen lassen, wie prophetisch das war!«
Rose sah ihre Tante an und ließ die Hand wieder sinken. »Aber es kann doch noch gar nicht in der Zeitung gestanden haben. Woher weißt du es denn?«
Benjamin räusperte sich, um sich bemerkbar zu machen, und betrat das Zimmer.
Als die junge Frau ihn sah, öffnete sie überrascht den Mund. »Oh … Mr Brooks, nicht wahr?«
»Booker.«
Mr Adair ließ die Zeitung sinken und runzelte die Stirn. »Was macht er denn hier?«
Benjamin wandte sich weltmännisch an das Paar: »Guten Tag, Miss Lawrence, Mr Adair. Hatten Sie eine angenehme Reise?«
Die beiden starrten ihn nur sprachlos an.
Isabelle brach das peinliche Schweigen. »Mr Booker ist ein Anwalt aus Onkel Percys Kanzlei. Er hat mir die Nachricht persönlich überbracht. Wie geht es Ihnen heute Morgen, Mr Booker? Besser, hoffe ich!«
»Ja, vielen Dank.« Miss Wilder wirkte heute ebenfalls frischer, dachte Ben. Ihre blauen Augen blickten hell und ausgeruht.
Mr Adair faltete seine Zeitung zusammen. »Hmpf. Sie haben wirklich keine Zeit vergeudet. Die Geier können es wohl nicht erwarten, einen neuen Vormund zu benennen?«
In Miss Wilders Gesicht trat ein leicht besorgter Ausdruck. »Oh. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht.«
»So, wie ich Onkel Percy kenne, hat er längst einen ernannt.« Rose Lawrence kräuselte die Lippen. »Jemand, der noch herrschsüchtiger und knickeriger ist, als er es war.«
Miss Wilder legte ihrer Nichte warnend die Hand auf den Arm. »Schhh, meine Liebe. Das wollen wir doch nicht hoffen.« Sie sah ihn an. »Sind Sie deshalb hier, um uns einen neuen Vormund zu nennen, Mr Booker? Das hatten Sie gar nicht erwähnt.«
Er schüttelte den Kopf. »Nein. Erstens gibt es nach dem Tod von Mr Norris wichtigere Dinge und« – er wählte seine Worte mit Bedacht – »zweitens geht es darum, wer davon profitiert.«
Doch Miss Wilder wandte sich an ihre Nichte. »Mr Booker weiß, dass Percival und ich uns gestritten haben. Anscheinend glaubt er, ich hätte ihn getötet«, sagte sie frei heraus.
»Was?!«, platzte Rose heraus.
Benjamin wappnete sich gegen einen verbalen Ausfall. Doch statt des Wutanfalls, den er erwartet hatte, kicherte Miss Lawrence. »Das ist wirklich köstlich! Da haben Sie sich aber gründlich verrannt, Mr Booker. Tante Belle? Können Sie sich vorstellen, dass sie sich nach London geschlichen hat, den Mord begangen hat und wieder heimlich, still und leise zurückfuhr, ohne dass irgendjemand es mitbekommen hat?« Die junge Frau schüttelte sich vor Lachen. »Tut mir leid, aber das ist wirklich zu lächerlich!«
Mr Adair jedoch war gar nicht amüsiert. »Rose, beherrsche dich bitte! Das ist nicht zum Lachen.«
Benjamin hob das Kinn. »Warum sollte das so außer Frage stehen? Ihre Tante gibt zu, dass sie zornig auf Mr Norris war und Grund hatte, ihn tot zu wünschen.«
Rose sah ihn an, ihr Blick war plötzlich eiskalt, dann wandte sie sich an ihre Tante. »Weiß er es denn nicht?«
Miss Wilder zuckte, peinlich berührt, die Achseln. »Möglicherweise ist mir mein Ruf vorausgeeilt. Vielleicht hat Percival es auch gelegentlich erwähnt.«
»Was erwähnt?«, schnappte Benjamin, irritiert, weil er die Ursache für Miss Lawrences Heiterkeitsausbruch war und nicht wusste, warum.
»Meine Tante hat diese Insel seit fast zehn Jahren nicht mehr verlassen.«
Er drehte sich um und starrte Miss Wilder ungläubig an. Die Londoner Haushälterin hatte erwähnt, dass sie seit Jahren nicht in London gewesen war, doch davon hatte sie nichts gesagt!
Miss Wilder rutschte unbehaglich auf ihrem Stuhl herum und wandte den Blick ab. Verlegen rieb sie sich den Nacken. »Du meine Güte. Es so ausgesprochen zu hören, lässt mich dastehen wie eine Verrückte.«
Miss Lawrence wollte ihrer Tante beistehen und wechselte schnell das Thema. »Wie lange werden Sie denn bleiben, Mr Booker?«
»Das weiß ich noch nicht. Ein oder zwei Tage. Aber ich werde heute Abend ins Gasthaus übersiedeln.«
Miss Wilder straffte sich. »Mr Booker, eine Frage wegen der Vormundschaft. Besteht die Möglichkeit, sie aufzuheben? Rose und ich können unsere Geschäfte selbst wahrnehmen.«
Verdutzt über diese unerwartete juristische Frage, schwieg Benjamin und überlegte einen Moment. »Das würde davon abhängen, wie der ursprüngliche Aussteller der Urkunde – Ihr Vater, nehme ich an – den Treuhandvertrag gestaltet hat. Ich müsste mir die Bedingungen ansehen.«
»Würden Sie das für uns tun? Ich bezahle natürlich Ihr übliches Honorar.«
Mr Adair zischte: »Vorsicht, Miss Wilder. Ich glaube kaum, dass er die beste Wahl ist. Soll ich nicht lieber meinem Vater schreiben? Sein Anwalt wäre objektiver.«
»Aber Mr Booker ist hier und als Mitglied von Percivals Kanzlei hat er Zugang zu den Treuhandunterlagen, dem Testament und anderen Unterlagen, die er braucht. Übernehmen Sie den Auftrag, Mr Booker? Ich wüsste gern, was auf Rose und mich und das Anwesen zukommt.«
»Sind Sie denn nicht im Besitz der Kopie Ihres Vaters von den Treuhanddokumenten?«
Sie schüttelte den Kopf. »Soweit ich weiß, hat Onkel Percy sie – hatte sie – in London.«
Benjamin zögerte. Ihre Bitte lieferte ihm einen Grund, die Korrespondenz und die übrigen Papiere durchzusehen und dabei vielleicht auf Beweise zu stoßen. Außerdem brauchte die Kanzlei im Moment wirklich jeden zahlenden Klienten, den sie bekommen konnten.
»Na gut«, antwortete er. »Ich will sehen, was ich herausfinden kann.«
Isabelle lächelte ihn dankbar an; dabei hoffte sie innerlich, dass sie keinen Fehler gemacht hatte, als sie ihn eingeladen hatte, hierzubleiben.
Rose sah ihren Gast an. »Wenn Sie bleiben, Mr Booker, dann müssen Sie auch zu unserer Feier kommen!«, sagte sie.
Doch Isabelle warf rasch ein: »Rose, ich habe nachgedacht: Angesichts von Onkel Percys Tod weiß ich nicht, ob eine weitere Feier angemessen wäre.«
»Es tut mir leid, dass er tot ist, wirklich, aber er war doch nur ein entfernter Verwandter. Und außerdem hat er sich viel zu stark in unser Leben eingemischt und versucht, alles zu kontrollieren. Soll das nach seinem Tod einfach so weitergehen? Es hätte ihm gefallen, der Grund für ein weiteres abgesagtes Fest zu sein. Nein!«
Rose nahm Isabelles Hand. »Ich weiß, dass es schlimm für dich war, dass du nicht mit uns zusammen in London feiern konntest. Und ich weiß auch, dass du dich damit getröstet hast, dass du hier ein zweites Fest für uns geben willst. Du hast dich so sehr darauf gefreut!«
Sie beugte sich vor. »Außerdem haben wir im Dorf Miss Truelock getroffen. Sie hat uns schon erzählt, wie sehr sie sich auf das Fest freut!«
Arminda Truelock war die Tochter des Pfarrers und Isabelles beste Freundin. Eine alte Jungfer wie sie, die viel zu wenig gesellschaftliche Kontakte und Vergnügungen im Leben hatte. Isabelle hasste es, sie enttäuschen zu müssen.
Sie zögerte. »Nun ja, ein Essen käme wohl infrage. Aber Tanzen … ich weiß nicht …«
»Oh, aber wir müssen tanzen! Wie bei einem altmodischen Rèiteach.«
»Rei-tschach?«, fragte Mr Booker nach.
»Das ist Gälisch. Eine Verlobungsfeier«, erklärte Isabelle. »Eine lange Tradition in unserer Familie.«
»Und wir können sie auch nicht mehr verschieben«, fügte Rose hinzu, »weil ich bald eine alte, verheiratete Frau sein werde, und dann ist es zu spät für eine Verlobungsfeier.«
Isabelle zuckte zusammen, doch sie brachte ein Lächeln für ihre geliebte Nichte zustande, die offenbar mit Bedacht das Thema ihrer bevorstehenden Hochzeit zur Sprache gebracht hatte. Isabelle hatte gehofft, Rose würde auf der Insel heiraten, in der kleinen Kapelle des Herrenhauses, doch Rose hatte freundlich eingewandt, dass die Kapelle viel zu klein für die vielen Gäste war, die sie und die Adairs einladen würden. Isabelle hatte entgegnet, dass sie dann in St. Raymonds im Dorf heiraten und danach zum Hochzeitsfrühstück auf die Insel kommen könnten, wo sie, Isabelle, mit Freuden sämtliche Gäste bewirten würde. Rose schien für diese Idee auch aufgeschlossen zu sein, doch Mr Adair meinte, die Reise sei zu weit für seine Londoner Verwandten und Freunde.
Rose hatte das Ganze beendet, indem sie sagte, sie würden später noch einmal darüber reden. Doch dieses Später rückte mit Riesenschritten näher. Wie sollte Isabelle es ertragen, nicht an der Hochzeit ihrer Nichte teilzunehmen? Rose war mehr eine Tochter für sie als eine Nichte, schließlich hatte sie sie nach dem Tod ihrer Eltern praktisch großgezogen.
Ihr Herz geriet aus dem Takt. Warum nur kann ich diese Angst nicht überwinden?
Isabelle erhob sich. »Ich muss es Mrs Philpotts sagen. Entschuldigt mich bitte.«
Mr Booker folgte ihr aus dem Zimmer. »Ihre Nichte hat mich aus Höflichkeit eingeladen, das ist mir bewusst. Aber das ist nicht nötig.«
»Es war nicht nur Höflichkeit, glauben Sie mir.« Isabelle schenkte ihm ein schiefes Lächeln. »Wir könnten noch einen Mann sehr gut gebrauchen. Haben Sie Abendkleidung?«
»Nicht dabei.«
Isabelle sah ihn abschätzend an. Angenehme Gesichtszüge. Tiefbraune Augen. Dunkles, leicht gelocktes Haar. Groß, gute Figur und schlank, aufrechte Haltung. »Ich glaube, Sie haben etwa die Größe meines Vaters. Und die Männermode verändert sich ja längst nicht so schnell wie unsere. Ich werde Mr Adairs Kammerdiener bitten, ein paar von Papas Sachen auszubürsten und aufzubügeln. Natürlich nur, wenn Sie einverstanden sind.«
»Selbstverständlich.«
»Gut.« Sie zögerte. »Und … da Sie zum Fest kommen und uns mit der Vormundschaft helfen, sollten Sie auch auf der Insel bleiben. Sie brauchen nicht in ein Gasthaus zu ziehen.«
Eine dunkle Braue hob sich. »Sicher?«
Isabelle nickte.
»Nun gut. Dann vielen Dank, Miss Wilder.«
Miss Wilder wollte in Richtung Küche gehen, doch sie drehte sich noch einmal um. »Da Sie die Treuhandsache für uns übernehmen – könnten Sie sich noch um eine weitere Angelegenheit kümmern? Es hängt damit zusammen.«
Er sah sie skeptisch an. »Und das wäre?«
»Bitte folgen Sie mir, ich zeige es Ihnen.«
Sie führte ihn in ein maskulin eingerichtetes Zimmer, dominiert von einem großen Mahagoni-Schreibtisch, mit deckenhohen Bücherregalen an den Wänden. »Das war das Arbeitszimmer meines Vaters. Ich nutze es jetzt als Büro.« Sie schloss die Tür, öffnete die Fensterläden, um Licht hereinzulassen, und begann: »Sie erinnern sich vielleicht, dass ich sagte, dass mein Vater seine Sachen in Ordnung bringen wollte, bevor er sich auf diese letzte Reise gemacht hat?«
»Ja …?«
»Er hat an jenem Abend gesagt, dass er sich erneut mit seinem Testament befassen wollte, mit Blick auf die Vormundschaft. Sie als Anwalt raten den Menschen wahrscheinlich, ihren Letzten Willen aufzusetzen, bevor sie sich auf eine Reise mit der Kutsche machen. Sie wissen ja selbst, wie gefährlich diese Art des Reisens sein kann. Und ich erfuhr es zu meinem Kummer am nächsten Tag.«
»Ja.«
»Papa hatte sein Testament bereits geändert, als er von Roses Geburt im Ausland erfahren hatte. Damals setzte er eine Treuhandschaft ein, weil er mich und Grace und damit auch Rose versorgt wissen wollte. Er ernannte Percival zum Vormund im Falle seines Todes und legte ein bescheidenes Gehalt für ihn fest. Wir haben nicht viele Angehörige und Papa hatte damals keinen Grund, an Percys Ehre oder Fähigkeiten zu zweifeln.
Als er erfuhr, dass Graces Mann gestorben und Grace selbst krank war, sagte er zu mir, er halte es für richtig, die Treuhandbedingungen zu ändern. Wenn das Schlimmste eintreten würde, sollte ich, sobald ich volljährig war, Roses Vormund und meine eigene Herrin werden. Percivals Vormundschaft sollte also nicht unbegrenzt bestehen bleiben. Immerhin war ich damals schon zwanzig.«
»Hat Ihr Vater diesen Willen schriftlich festgehalten?«
»Genau das ist die Frage. Wenn ja, haben wir das Schriftstück jedenfalls nie gefunden. Vielleicht wollte er es aufschreiben, hat es in der Eile aber vergessen. Ich muss gestehen, dass ich mir anfangs auch kaum Gedanken darüber gemacht habe. Onkel Percival hat seine Aufgabe sehr pflichtbewusst erfüllt und ist dabei immer im Hintergrund geblieben, hat sich nie in unseren Alltag eingemischt. Ich habe Rose hier aufgezogen, bis sie nach London gegangen ist.
Bei einem seiner letzten Besuche hat Onkel Percy dann Stunden allein in diesem Arbeitszimmer verbracht. Er hat sämtliche Schubladen und Ordner durchgesehen und ganz eindeutig irgendetwas gesucht. Einmal bin ich um drei Uhr morgens nach unten gekommen, weil ich mir eine warme Milch machen wollte, und er suchte immer noch. Er wirkte sehr besorgt, fast panisch.«
»Sie glauben, er hat das Testament gesucht?«
»Ja.«
»Sie sagten, Ihre Eltern seien seit über zehn Jahren tot. Warum sollte Mr Norris plötzlich ein etwaiges neueres Testament suchen?«
Sie antwortete kleinlaut: »Möglicherweise, weil ich eine Andeutung gemacht habe, dass mein Vater etwas Schriftliches über die Beendigung der Vormundschaft hinterlassen hat, und dass ich dieses Schriftstück vorlegen würde, damit er abgesetzt wird.«
»Aber Sie sind nicht im Besitz eines solchen Dokuments.«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Ich war wütend, verängstigt und verzweifelt. Er hat gedroht, mein Leben zu ruinieren. Meine Insel. Ich wollte ihn daran hindern; das war alles, woran ich damals denken konnte. Ich wusste, dass mein Vater niemals einverstanden gewesen wäre, wenn er noch gelebt hätte. Und wenn er vorausgesehen hätte, wie hinterhältig Percy vorgehen würde, hätte er ihn nie zu unserem Vormund ernannt.«
Benjamin fragte sich, ob sie Percival Norris wirklich nur gedroht hatte. Er blickte sich im Zimmer um, betrachtete den Schreibtisch und die Schränke. »Hätte Ihr Vater ein solches Dokument hier aufbewahrt?«
»Meiner Ansicht nach hätte er es mit auf die Reise genommen. Ich glaube, er wollte es, nachdem er Grace vom Schiff abgeholt hatte, den Londoner Anwälten übergeben, aber so weit ist es ja nicht gekommen. Vielleicht irre ich mich aber auch; ihre Koffer wurden uns nämlich ausgehändigt und wir haben keine Papiere darin gefunden. Andererseits war ich damals vor Kummer außer mir und hatte keinen Kopf für so banale Dinge wie juristische Unterlagen.«
»Verzeihen Sie, aber Ihre … Wurden Ihre Eltern ebenfalls hierher gebracht?«
Sie schien zusammenzuzucken. »Ja. Sie sind auf dem Friedhof von St. Raymonds in Riverton begraben. Der Bestatter hat mir ein paar persönliche Dinge gebracht – Papas Geldbörse und seine Uhr, Mamas Handtasche und ihren Ring, aber keine Papiere.«
»Warum ist Ihnen das so wichtig, jetzt, da Mr Norris tot ist?«
»Wenn ich nichts unternehme, werden wir einen anderen Vormund bekommen und wieder in allem, was wir tun oder mit unserem Geld anfangen wollen, einem fremden Willen ausgeliefert sein. Ein Fremder wird Roses Mitgift bestimmen, ihren Ehevertrag aushandeln und all das. Ich muss es wissen. Habe ich nicht allen Grund, einen solchen Nachfolger abzulehnen und meine eigene Herrin zu werden, ohne äußere Einmischung?«
»Gehört das Anwesen denn nicht zur Hälfte Rose?«
»Die Insel und unser schönes Haus in London gehören zum Treuhandvermögen. Jedenfalls glaube ich das. Doch letztlich ist Rose meine alleinige Erbin. Wenn ich einmal sterbe, wird sie alles erben.«
»Ich weiß nicht, ob ich das herumerzählen würde.«
»Warum nicht?«
Benjamin machte sich in Gedanken eine Notiz zu diesem Motiv, beschloss aber, im Moment nichts dazu zu sagen. »Egal. Zurück zu Ihrer Frage – Sie haben recht, Ihr Vater als ursprünglicher Aussteller hat wahrscheinlich einen weiteren Treuhänder verfügt, für den Fall, dass Mr Norris die Aufgabe nicht übernehmen konnte oder wollte. Sonst müsste das Gericht das tun.«
»Aber warum brauchen wir überhaupt einen Treuhänder oder Vormund? Rose ist noch nicht achtzehn, aber sie wird bald heiraten und dann wird ihr Besitz auf ihren Mann übergehen.«
»Richtig. Es sei denn, vor der Heirat wird ein Ehevertrag geschlossen.«
»Deshalb hat Percival ja auf einen Vertrag bestanden, obwohl das den Adairs gar nicht recht war.«
Benjamin nickte. »Ihre Nichte ist sehr jung, es ist also nicht abwegig, dass Mr Norris einen Vertrag für nötig hielt, zu ihrem eigenen Schutz, und einen älteren Vormund, der sie beraten kann.«
»Und was ist mit mir? Ich bin dreißig Jahre alt.«
»Zugegeben, Sie wirken durchaus, als könnten Sie diese Aufgabe übernehmen.«
»Danke. Mein Ziel ist es, dieses Haus und die Insel für künftige Generationen zu bewahren. Für Roses Kinder.«
»Und Ihre eigenen?«
Sie sah ihn mit großen blauen Augen an. »Ich … ich hege derzeit keine Heiratspläne.«
»Weiß Dr. Grant das?«
»Sie sind unverschämt!« Wütend funkelte sie ihn an.
»Verzeihen Sie. Das war taktlos.«
Sie hob das Kinn. »Dr. Grant und ich sind alte Freunde.«
Sein Blick ruhte auf der anmutigen Linie ihres Halses. »Er scheint Sie zu bewundern.«
Sie spielte an der Wachsjacke herum, die auf dem Schreibtisch lag. »Vielleicht. Aber wir sind nur … Freunde.«
»Ich frage mich, warum.«
Sie zuckte die Achseln und wandte den Blick ab.
Benjamin war unwillkürlich gerührt, doch er kämpfte sofort gegen dieses Gefühl an. Sie zog ihn bereits in ihren Bann, so wie es bei Susan Stark gewesen war. War es unklug von ihm, dieser Frau zu helfen? Würde er es noch bereuen, wenn er hierblieb? Andererseits konnte es sich durchaus als vorteilhaft erweisen. So hätte er Zugang zu den Menschen, die hier lebten, und Gelegenheit, ihren verborgenen Geheimnissen auf die Spur zu kommen.
Er straffte die Schultern und rettete sich in ein geschäftsmäßiges Verhalten. Auf dem Terrain fühlte er sich sicherer. »Nun gut. Ich werde nach einem neuen Testament suchen und versuchen herauszufinden, wie die Frage des Treuhand-Nachfolgers geregelt werden könnte. Ich werde Mr Hardy, unserem Seniorpartner, schreiben und mich nach den aktuellen Bedingungen erkundigen.«
»Danke.« Sie löste einen Schlüssel von der Schlüsselkette an ihrem Gürtel und schloss den Schreibtisch und die Aktenschubladen auf. »Lassen Sie mich wissen, was Sie herausgefunden haben.« Damit ging sie. Benjamin blieb allein in dem Arbeitszimmer zurück und fragte sich, wie um alles in der Welt er zum Gast von Leuten geworden war, die er kaum kannte und denen er noch weniger vertraute.
Bis vor Kurzem hatte er sich für einen ganz passablen Menschenkenner gehalten, hatte geglaubt zu wissen, ob jemand die Wahrheit sagte oder log. Doch der Fall Susan Stark hatte seinem Selbstvertrauen einen schweren Schlag versetzt. Jetzt war er ganz und gar nicht mehr sicher, was er glauben sollte.
Er beschäftigte sich ein Weilchen mit den Papieren, dann schrieb er Mr Hardy, erkundigte sich nach den Bedingungen der Vormundschaft und teilte ihm mit, dass er noch ein paar Tage länger auf Belle Island bleiben würde.
Als er gerade dabei war, den Brief zu versiegeln, ertönte draußen lautes Hundegebell.
Er schaute aus dem Fenster und sah Miss Wilder, wie sie auf dem Rasen mit zwei Hunden spielte. Der alte Hund, den er schon gesehen hatte, hatte einen Stock im Maul, den Miss Wilder ihm spielerisch fortzunehmen versuchte. Sie tanzte ausgelassen um den Hund herum, fröhlich lachend, und wehrte dabei einen kleinen Welpen ab, der sie bellend verfolgte.
Isabelle schien ein ausnehmend natürlicher, unaffektierter Mensch zu sein, völlig unbekümmert um ihre Wirkung und ihr Aussehen. Er selbst war bis jetzt immer eher voreingenommen gegenüber, wie er sie insgeheim bezeichnete, Landpomeranzen gewesen, doch anscheinend lag er da falsch. Er schloss die Augen. Zieh keine voreiligen Schlüsse über sie, in keinerlei Richtung. Er mochte ihre Haltung bewundern, doch das bedeutete noch lange nicht, dass sie kein Unrecht begangen hatte.
Nach ein paar Minuten legte sich der alte Hund hin und war trotz all ihrer Bemühungen nicht mehr zum Spielen zu bewegen. Die Zunge hing ihm aus dem Maul; er schien über die Mätzchen seiner Herrin zu lachen und wedelte freundlich mit dem Schwanz. Schließlich gab sie auf, warf den Stock fort und strich dem Hund über den Kopf. Dann ging sie mit dem Welpen zurück ins Haus.
Kurz darauf ging Benjamin durch die Haustür; er wollte den Brief persönlich aufgeben. Auf dem Weg über die hölzerne Brücke nach Riverton kam er zu dem Schluss, dass das Dörfchen ausnehmend hübsch war. Die Häuschen waren von üppigen Kletterpflanzen bewachsen, in den Vorgärten wuchsen bunte Frühlingsblumen und vor einem bescheidenen Cottage neben der Kirche konnte man Blumensträuße kaufen. Gegenüber befand sich ein Dorfladen, dessen Schaufenster ein Sammelsurium von Dingen zeigte, die die Vorübergehenden zum Kauf animieren sollten: Kerzen, Tabakspfeifen, Kreisel und Bälle, Zuckerwecken, Zinn- und Eisenwaren, Knöpfe und Bänder.
Ein Stückchen weiter unten, am Ufer, erhob sich die alte Mühle, deren Räder das Wasser in schaumig-weiße Strudel verwandelten. Neben der Mühle stand ein Wagen mit roten Rädern, hoch mit Mehlsäcken beladen. Die Pferde fraßen frisches Heu, das ihnen jemand hingeworfen hatte.
Die Uferstraße verlief parallel zur Themse, eine andere Straße, die sie im rechten Winkel kreuzte, führte den Hügel hinauf. Dort erblickte Benjamin sein Ziel – das White Hart Inn, das zugleich als lokales Postamt fungierte. Das Gasthaus machte einen einladenden Eindruck mit seinem warmen gelben Anstrich, dem roten Ziegeldach und einem Hof, in dem ein paar ältere Leute unter einem knorrigen Walnussbaum saßen und sich angeregt unterhielten.
Benjamin betrat das Gasthaus und gab seinen Brief auf. Dann fragte er den Wirt, ob er oder ein Mietstall im Dorf Mietkutschen zur Verfügung stellte, wenn jemand – Miss Wilder zum Beispiel – nach London fahren wollte.
Der Blick, mit dem der Gastwirt ihn ansah, zeigte deutlich, dass er ihn für einen Trottel hielt. »Sie sind nicht von hier, nicht wahr? Die nächste Kutschstation ist in Maidenhead. Dorthin bringen wir unsere Post und von dort holen wir sie ab, mit unserem Eselskarren. Aber damit kämen Sie nicht weit.«
»Nein. Trotzdem vielen Dank.«
Er hatte erledigt, was er sich vorgenommen hatte. Jetzt betrat er, aus einer Laune heraus, den Schankraum und setzte sich neben einen silberhaarigen Mann, der dort ganz allein saß.
In der Hoffnung, ein paar Informationen über die Wilders zu erhalten, sprach er den Alten beiläufig an. »Einen guten Tag Ihnen, Sir. Was gibts Neues im Dorf?«
Der grauhaarige Kopf drehte sich zu ihm, wässerige Augen sahen ihn an. »Nicht viel. Hab Sie noch nie hier gesehen.«
»Ich bin zu Besuch – aus London.«
»Dann wollen Sie hoffentlich nicht lange bleiben.«
Benjamin hob überrascht den Kopf. »Oh! Warum?«
»Schlechtes Wetter im Anmarsch. Der Kalender hat eben nicht immer recht. Ich spür es in den Knochen. Wird sogar schlimmer als '11 oder als die Flut von '08.«
Der Wirt trat an ihren Tisch; er lächelte nachsichtig. »Lassen Sie sich von Mr Colebrook nichts erzählen, mein Freund. Er sagt unablässig den Weltuntergang voraus.«
»Ach was.« Der Mann machte eine wegwerfende Handbewegung und sah ihn verächtlich an. »Sie werden schon sehen, dass ich recht habe.«
Benjamin bestellte sich einen Kaffee und ein zweites Pint für Mr Colebrook.
Die silbernen Brauen hoben sich dankbar; der Alte nickte Ben zu. »Vergelt's Gott.«
Benjamin trank einen Schluck Kaffee, dann wandte er sich dem alten Mann zu: »Sie leben schon lange hier, nicht wahr?«
»Und ob, junger Mann. Da waren Sie noch nicht mal geboren, würde ich sagen.«
»Das ist mein erster Besuch hier. Ich wohne für ein paar Tage auf Belle Island. Hier geht anscheinend das Gerücht herum, dass die junge Dame die Insel seit zehn Jahren nicht verlassen hat. Aber das ist doch bestimmt übertrieben, oder?«
»Nein, Sir. Sie bleibt lieber zu Hause. Ist ja auch nichts gegen zu sagen.«
»So was habe ich noch nie gehört. Ist sie … krank?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Aber … warum macht sie dann so was? Was meinen Sie?«
»Wegen des Fluchs. Jeder Wilder, der auf der Insel geboren ist und sie verlässt, stirbt jung.«
»Das habe ich gehört. Aber das glaubt doch wohl keiner?«
Der alte Mann sah ihn mit plötzlich erwachtem Misstrauen an. »Warum wollen Sie das wissen?«
Benjamin zuckte die Achseln. »Reine Neugier. Sie müssen zugeben, dass es sonderbar ist.«
Der alte Mann kniff die Augen zusammen, dann schien er einen Entschluss zu fassen. Er holte eine Münze aus der Tasche und knallte sie auf die Theke. »Ich gebe gar nichts zu. Und ich kann mir mein Bier selbst kaufen und meine Meinung für mich behalten, vielen Dank. Dasselbe empfehle ich Ihnen. Sie werden nicht erleben, dass ich etwas Schlechtes über die Herrin sage. Tut mir sowieso schon leid, dass ich überhaupt was gesagt habe.«
»Sie haben nichts Unpassendes gesagt, Sir, bestimmt nicht. Bitte setzen Sie sich wieder hin. Ich wollte Sie nicht kränken.«
Doch der Mann stand mit wackeligen Beinen auf, verließ den Schankraum durch die Seitentür und ging zu den anderen auf den Hof. Benjamin seufzte. Wie hatte er sich nur so zum Narren machen können! Als Anwalt vor Gericht würde er wahrlich kein gutes Bild abgeben. Seine Fähigkeit, Zeugen zu befragen, ließ eindeutig sehr zu wünschen übrig.