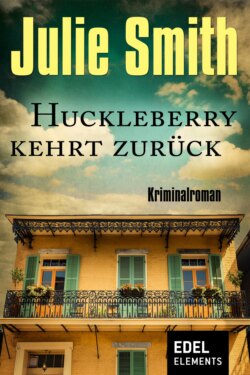Читать книгу Huckleberry kehrt zurück - Julie Smith - Страница 5
2
ОглавлениеWenn Booker jemals sein illegales Handwerk aufgeben würde, könnte er als Raumausstatter Karriere machen. Sein Geschenk für Sardis war ein kleiner Baum (›Ficus Benjamini‹ laut Auskunft der stolzen Besitzerin), der ihrem Wohnzimmer den letzten Schliff verlieh.
Nachdem wir die Treppe erklommen hatten, um ihn zu besichtigen, fehlte uns die Kraft für den Schwarzenegger-Film. Wir schafften es gerade noch bis ins Schlafzimmer, wo wir zu einem kläglichen Haufen auf dem Bett zusammensanken. Ich träumte selig vom Leben auf dem Mississippi und stellte fest, daß man sich auf einem Floß mächtig frei und leicht und zufrieden fühlt. Ich rauchte meine Maiskolbenpfeife, ließ die Füße ins Wasser baumeln und mich von der Sonne wärmen, bis sich die Idylle plötzlich in einen Alptraum verwandelte. Eine gräßliche Harpyie schoß plötzlich vom Himmel herab und riß mir meine Pfeife aus dem Mund. Während sie sich wieder in die Lüfte emporschwang, breitete sie ihre Klauen aus, so daß jede einzelne Kralle im Sonnenlicht glitzerte, und ließ die Pfeife mit einer Geste äußerster Verachtung fallen. Dann stürzte sie erneut auf mich zu, schlug mich mit ihren Flügeln und schwang sich empor, um mich zu beobachten. Mit dem Gelächter der West-Hexe und der schrillen Stimme von Margaret Hamilton schrie sie: »Ich werde dich zivilisieren, junger Mann!« Und da war ich doch mächtig überrascht – wie Huck sagen würde –, als ich sah, wer sie war. Mal gar nicht davon zu reden, wer sie nicht war: weder die Hexe noch die Witwe Douglas, und auch nicht Tante Sally oder Tante Polly, oder Miss Watson. Es war Sardis.
Hellwach starrte ich an die Decke und fragte mich, was in aller Welt ich wohl geträumt hätte, wenn wir doch zusammengezogen wären. Etwas sagte mir, daß Sardis recht gehabt hatte, als sie nichts übestürzen wollte. Ich verdrückte mich.
Ich verdrückte mich in meine eigenen vier Wände, nach unten. Aber natürlich nicht wegen dieses absolut dummen und kindischen Traumes. Ich habe keine Ahnung, was mein Unterbewußtsein dachte, und weise hier nachdrücklich darauf hin, daß es in keiner Weise die Ansichten der Direktion wiedergab.
Ich ging, weil ich nicht mehr einschlafen konnte und Sardis nicht wecken wollte, wenn ich mich im Bett hin und her wälzte. Ich machte mir eine heiße Schokolade und zog mich damit in mein Wohn-und-sonstwas-Zimmer zurück. Und da auf meinem häßlichen Couchtisch lag es vor mir, in gewöhnliche Schuhkartons gebettet, das geheimnisvolle Manuskript.
Booker hatte bei seiner sehnsüchtigen Betrachtung eine endlose Nacht lang die Selbstbeherrschung aufgebracht, es nicht anzufassen. Außerdem hatte er verboten, es in der Nähe von Weingläsern anzusehen. Nur ein Vandale und Philister würde mit einer Tasse Schokolade in der Hand daran herumfingern. Aber mir ging es wie einem Teenager mit Hormonschüben, der sich nicht beherrschen kann.
Was für eine wunderschöne Handschrift. Im wahrsten Sinne des Wortes »fließend«. Sie schien eine Eigendynamik zu entwickeln, als ob der Autor im gleichen zügigen Tempo dachte, wie er schrieb. Beim Durchblättern sah ich nur wenige Korrekturen. Hier und da ein durchgestrichenes Wort, ein durchgestrichener Absatz, das war alles. Konnte irgend jemand beim ersten Entwurf schon so gut schreiben? Immerhin war Mark Twain Journalist gewesen. Aus eigener Erfahrung wußte ich, daß man als Journalist immer nur eine Chance hatte. Vielleicht war ihm das zur Gewohnheit geworden.
Ich ließ mich mit dem ersten Karton nieder. Ich hatte eine Entscheidung gefällt und bedauerte lediglich, daß sie nicht ganz so respektvoll war wie die von Booker. Wenn auch nur eine winzige Chance bestand, daß ich hier Amerikas größten Roman in der Hand hielt, eigenhändig geschrieben von Amerikas größtem Romanschriftsteller, Humoristen und wahrscheinlich auch Journalisten (falls man keinen allzu großen Wert auf Fakten legte), dann wollte ich ihn jetzt auch lesen. Vielleicht würde ein bißchen von seiner Genialität auf mich abfärben.
»Scheiß auf die Langfinger!« murmelte ich und goß Brandy in meine Schokolade. Bis Sonnenaufgang hatte ich den Inhalt beider Schuhkartons durch, ungefähr vierhundert halbe Seiten, und war ganz benebelt vor Glück. Schläfrig und satt. Und ich dachte: Mein Gott, diese letzte Szene war toll!
Es war die Stelle, wo Huck in die Stadt geht und die Handzettel für den König und den Grafen verteilt, und der alte Boggs kommt angeritten, »besoffen und schwankend in seinem Sattel«, brüllend und fluchend. »Ich wollte, der alte Boggs würde mir mal drohen«, sagt einer von den Tagedieben, »dann wüßt’ ich, daß ich noch tausend Jahre leben würd.« Old Boggs, o weh, überlebt die nächste Stunde nicht, weil er für seine Beschimpfungen vom eingebildeten Colonel Sherburn erschossen wird.
Dann die traurige Szene, wie sich seine sechzehnjährige Tochter über ihren toten Vater wirft. Und die komische, wenn die Leute drängeln, um einen Blick auf die Leiche zu werfen: »Das ist nicht recht und nicht anständig, daß ihr die ganze Zeit dableibt und keinen anderen ranlaßt; andere haben auch ’n Recht drauf, genau wie ihr!«
Ich war wunschlos glücklich.
Und genauso glücklich verliefen die zwei Stunden Schlaf, die ich mir gönnte. Dann war es Zeit, in die Universitätsbibliothek zu gehen und ein paar Fragen zu stellen. Beim Kaffee dachte ich nach. Ich mußte mir etwas einfallen lassen, und es mußte plausibel klingen. Ich könnte erzählen, daß ich an meiner Dissertation schrieb, aber man würde mich in sieben Sekunden als Mark-Twain-Ignoranten entlarven. Oder hieß es Clemens-Ignorant? Ich wußte noch nicht einmal, wie die Fachleute den großen Mann nannten. Aber dann kam mir die Idee – es gab eine Sorte Forscher, bei denen Unwissenheit zum Berufsbild gehörte. Ich suchte nach meinem alten Presseausweis.
Gegen zehn war ich in der Bibliothek und folgte dem Schild im vierten Stock zur Mark-Twain-Sammlung. Ich wußte, was dort zu finden war: Notizen, Briefe und andere Schätze im Wert von zweiundzwanzig Millionen Dollar, das meiste hatte Clemens’ Tochter der Universität überlassen, mit der Auflage, alles zu veröffentlichen. Ich war froh, als ich vor einer Tür stand, die selbst von der Barrow-Bande nicht zu knacken gewesen wäre – Wissenschaftler konnten so achtlos sein.
Die Dame dahinter öffnete nicht jedem. Sie schmetterte (wie Huck sagen würde): »Wer ist da? Sind Sie angemeldet?«
»Paul McDonald vom ›Chronicle‹. Ich würde gerne mit jemandem sprechen.«
»Tut mir leid. Der Cheflektor ist im Urlaub.«
»Ich bin nicht anspruchsvoll. Gibt es sonst jemanden, der sich auskennt?«
»Darf ich fragen, in welcher Angelegenheit?«
»Ich brülle ungern durch die Tür. Wie wäre es, wenn ich die Treppe wieder runtergehe und Sie von der Telefonzelle aus anrufe?«
»Oh, das ist nicht nötig.« Sie öffnete die Tür und kam heraus. »Ich bin Linda McCormick. Kann ich Ihren Presseausweis sehen?«
Ich zeigte ihn ihr. »Sind Sie das?«
»Wie bitte?«
»Die Person, die sich auskennt.«
Sie lachte verlegen, als sei sie sich nicht sicher, ob das ein Witz sein sollte. »Jedenfalls bin ich die einzige, die Ihnen zur Verfügung steht. Was kann ich für Sie tun?«
»Ich arbeite an einer Story über Manuskriptsammlungen.«
»Dann sind Sie hier richtig.« Sie trat zur Seite und ließ mich hinein. Ich folgte ihr einen Flur hinunter, an dessen Wänden zu beiden Seiten Bilder von Mark beziehungsweise Sam hingen. Ehrlich gesagt sah ich mir lieber meine Begleiterin an.
Obwohl sie ein ziemlich formloses Kleid mit einem locker gebundenen Gürtel trug, sah ich Bewegung darunter. Ihr Gesicht gefiel mir sogar noch besser. Sie war vielleicht fünfunddreißig, hatte dunkles, lockiges Haar und sah etwas verschlafen aus. Frauen mit einem verschlafenen Blick inspirieren mich immer dazu, sie mir auf einem Kissen vorzustellen. Ich stellte mir Linda vor, und das beeindruckte mich so, daß ich davon geradezu überwältigt war.
Als ich mich ihr gegenübersetzte, sah ich, daß das Make-up ihrer hübschen haselnußbraunen Augen ziemlich verschmiert war. Vermutlich verursachte das den Schlafzimmer-Effekt. Es gehört zu den reizvollen Eigenschaften akademisch gebildeter Frauen, daß sie anscheinend nie richtig lernen, mit Make-up zurechtzukommen.
»Ich entnehme Ihrer Antwort, daß eine Menge Leute Twain sammeln. Oder sollte ich von ›Clemens‹ sprechen?«
»Anthony Burgess hat gesagt: ›T. S. ist der einzige Eliot, und George Eliot ist wie Mark Twain ein Pseudonym, das sich nicht abkürzen läßt.‹ Damit teilt er mehr oder weniger die Auffassung der älteren Generation. Hier bei uns sagen wir meistens Clemens, aber wir haben nichts gegen ›Twain‹. Das gilt nicht mehr, so wie früher, als ein schrecklicher Fehlgriff. Tatsache ist, daß er selbst einige Briefe mit ›Mark‹ unterzeichnet hat.«
»Wenn man dem Autor selbst nicht einmal mehr glauben kann ...«
»Aber dann ließ er’s wieder bleiben. Vielleicht waren die Empfänger nicht damit einverstanden.« Ich hätte schwören können, daß sie ein winziges bißchen flirtete, als sie mich ansah. Sie wurde sogar rot, aber möglicherweise ärgerte sie sich, weil sie den Faden verloren hatte. »Entschuldigen Sie bitte«, sagte sie, »Sie fragten nach Sammlern. Das ist ein ziemlich heißes Eisen. Die Briefe werden für tausend Dollar pro Seite gehandelt. Und das ist vielleicht sogar noch zu niedrig geschätzt.«
»Und die Manuskripte?«
Sie schenkte mir einen vielsagenden Blick. »Megadollar.«
»Wie steht’s mit dem Glanzwerk?«
»Huck?«
Ich nickte.
»Das ist eine traurige Geschichte. Ein Teil des Manuskripts ist verlorengegangen. Den Rest hat die öffentliche Bibliothek von Buffalo.«
»Welchen Rest?«
»Ungefähr die letzten drei Fünftel und einen Teil vom Anfang des Buches. Die ersten zwei Fünftel sind größtenteils 1876 entstanden – bis zur Mitte von Kapitel zwölf, und außerdem schrieb er den überwiegenden Teil der Kapitel fünfzehn und sechzehn. In Buffalo liegt die zweite Hälfte von Kapitel zwölf bis Kapitel vierzehn und von Kapitel zweiundzwanzig alles bis zum Schluß.«
»Er hat später noch etwas am Anfang eingefügt?«
Sie nickte. »Die Geschichte über die Walter-Scott- und die König-Salomon-Debatte.«
Daran konnte ich mich nicht erinnern, mit Sicherheit hatte ich auch in der letzten Nacht nichts davon gelesen. Wieder diese Gänsehaut. »Hat er eine Kurzschrift verwendet?«
»Nein, er schrieb in ganz normaler Langschrift. Aber da er sehr fortschrittlich war, ließ er seine Bücher für den Drucker mit der Maschine abschreiben. Das Typoskript fehlt ebenfalls.«
»Also haben sie in Buffalo die Handschrift.«
»Ja. Übrigens gibt es davon ein Faksimile.« Ich gab mir Mühe, nicht vom Stuhl aufzuspringen.
»Haben Sie das zufällig da?«
»Kann man Warzen mit Wasser vom faulem Holz heilen?«
Ich muß ziemlich verblüfft ausgesehen haben, denn sie wurde wieder rot. »Ein kleiner Scherz. Aus ›Tom Sawyer‹.«
»Jetzt erinnere ich mich. Ich ziehe die Methode mit der toten Katze vor.«
»Ich kann Ihnen das Faksimile in den Lesesaal schicken, wenn Sie es sich ansehen wollen.«
»Das wäre nett. Ich glaube, ich habe einen Aufhänger für meine Story.«
»Ja?«
»Ich werde eine Geschichte über den verlorenen Teil des Huckleberry-Finn-Manuskriptes schreiben, und was passieren würde, wenn man es wiederfände.«
»Aha.« Allmählich verstand ich sie besser. Sie sagte kaum etwas, wenn es nicht um Mark Twain ging, wenn sie aber bei diesem Thema war, wurde sie richtig gesprächig.
»Und was glauben Sie, was passieren würde?«
»Man würde sich darum reißen.«
»Wieviel wäre es wert?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Wenn man es nach dem derzeitigen Preis der Briefe berechnet, könnte man als vorsichtige Schätzung bei tausend Dollar pro Seite anfangen.«
»Es wären wahrscheinlich rund vierhundert Seiten. Kann das stimmen?«
»Eher fünfhundert.« (Ich wußte es natürlich besser.)
»Also vielleicht eine halbe Million Dollar?«
»Das läßt sich schwer sagen. Ein Teilmanuskript ist wesentlich weniger wert als ein vollständiges. Wenn die Bibliothek in Buffalo nicht verkaufen will – was sehr wahrscheinlich ist –, gibt es keine Möglichkeit, es zu vervollständigen. Also würde man letzten Endes vielleicht nicht mehr als zweihundertfünfzigtausend bekommen.«
»Ziemlich wenig.«
Sie nickte. »Völlig richtig. Schließlich reden wir von ›Huckleberry Finn‹.«
»›Die ganze moderne amerikanische Literatur‹«, zitierte ich, »›stammt von einem Buch von Mark Twain ab, das ›Huckleberry Finn‹ heißt ... Vorher gab’s nichts. Seitdem hat es nichts Vergleichbares gegeben.‹«
Sie nickte wieder, um mir zu zeigen, daß sie das Zitat kannte. »Hemingway war nicht der einzige, der so dachte. Ich könnte Ihnen Leute zeigen, die vor nichts zurückschrecken würden, um so ein Manuskript zu besitzen.«
»Die Getreuen der Huckleberry-Finn-Gemeinde.«
»Sie haben von uns gehört?«
»Wie bitte?«
Erneut stieg ihr diese anziehende Röte ins Gesicht. »Ach nichts. Ich war nur überrascht, daß Sie den Ausdruck ›Gemeinde‹ verwendet haben. Sie können sich gar nicht vorstellen, welches Ausmaß von Verehrung und Heldenanbetung der Kult um Mark Twain im Lauf der Zeit angenommen hat. Ich könnte Ihnen Menschen zeigen, die zehn Jahre ihres Lebens für einen Abend mit ihm geben würden.«
»Aber was würden sie für die verloren geglaubte Huckleberry-Finn-Handschrift zahlen?«
»Wer weiß? Aber zweihundertfünfzigtausend halte ich für sehr vorsichtig geschätzt. Vielleicht bis zu einer Million.«
»Wie würde man seine Echtheit überprüfen lassen?«
»Wer klug ist, kommt damit zu uns – seriöse Händler tun das auch. Aber viele Leute würden sich gar nicht darum kümmern.«
»Was? Warum denn nicht?«
Mit einem Ausdruck von Enttäuschung und Ratlosigkeit drehte sie ihre Handflächen nach oben. »Ich nehme an, sie wollen es gar nicht wissen. Ein Händler hat mir einmal erklärt: ›Miss McCormick, nehmen Sie an, Sie hätten ein Nugget, das fast eine Tonne wiegt. Würden Sie dann wissen wollen, ob es Katzengold ist?«
»Wahrscheinlich hatte er ›Durch Dick und Dünn‹ gelesen.«
»Da geht es hauptsächlich um Silber«, sagte sie mechanisch, ihre Gedanken waren nicht beim Thema. Mir fiel auf, wie sehr das Problem mit der Echtheit ihr zu schaffen machte.
Sie schob mir zwei Kopien von Briefen Mark Twains hin – gleichen Inhalts, aber unterschiedlich datiert. Der eine war auf Briefpapier des Bohemian-Clubs von San Francisco geschrieben. »Achten Sie auf das Datum«, sagte Linda.
»Achtzehnhundertdreiundachtzig.«
»Er verließ San Francisco 1866, kehrte ’68 kurz zurück und kam danach nie mehr wieder.«
»Vielleicht hatte er das Briefpapier aufgehoben.«
Sie schüttelte den Kopf. »Sehen Sie sich die blauen Linien an.«
Zwei Diagonalen waren vom linken zum rechten Rand gezogen. »Vergleichen Sie die beiden Dokumente«, sagte sie, »und beachten Sie, daß die Linien in den Briefen jeweils die gleichen Worte beim gleichen Buchstaben kreuzen. Der Brief von 1875 ist echt. Es wäre möglich, daß Clemens ihn später auf Bohemian-Club-Papier abgeschrieben hat, aber nicht so, daß jeder Buchstabe identisch ist. Das ist zu präzise, um echt zu sein. Dieser Brief ist eine Fälschung. Aber das ist einer von den wenigen Fällen, wo ein Sammler sich die Mühe gemacht hat, nachzufragen. Unglücklicherweise ist es ihm zu spät eingefallen.«
»Da hat er Pech gehabt.«
»Nicht unbedingt. Wenn er wollte, könnte er den Brief wahrscheinlich für das gleiche Geld oder mehr wieder loswerden.«
»Das passiert häufiger?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Die Menschen sind dumm.«
»Was für Papier hat Mark Twain benutzt?«
»Normalerweise halbe Bögen. Soll ich Ihnen auch eine Originalhandschrift mit dem Faksimile schicken? Ich weiß schon – ›1002‹.«
»Was ist das?«
Sie lächelte wissend und verschwörerisch. »Wahrscheinlich die schlechteste Erzählung, die Clemens je geschrieben hat. Aber er beendete sie ungefähr zur gleichen Zeit wie Huck, also müßten Schrift und Papier ähnlich sein.«
Ich trennte mich nur ungern von Linda, aber das ließ sich nicht vermeiden. Die Bancroft Library war eine Präsenzbibliothek, in der man nichts ausleihen konnte. Dokumente wie die Mark-Twain-Schriften darf man sich nur im Lesesaal ansehen, und bevor man ihn betritt, muß man seine Sachen in einem Schließfach deponieren. Man darf nur einen Bleistift oder eine Schreibmaschine mitnehmen. Tinte ist streng verboten. Ich fand das gut – man hatte das Gefühl, daß die Sammlung sorgfältig gehütet wurde. Außerdem gefiel es mir, daß jeder über achtzehn die Bibliothek benutzen durfte, nicht nur Studenten der Universität und Akademiker. Jedermann konnte sich hier ein seltenes, wichtiges Manuskript ansehen. Aber natürlich hatte fast niemand Interesse daran.
Ich schon. Ich war überrascht, wie sehr ich mich darauf freute, die Papiere in der Hand zu halten, von denen ich diesmal ohne jeden Zweifel wußte, daß sie Mark Twain eigenhändig beschrieben hatte.
Als das Faksimile und die Erzählung endlich ankamen, war ich so aufgeregt, daß ich mich nicht entscheiden konnte, was ich zuerst ansehen sollte. Ich nahm mir schließlich die Erzählung vor und fiel beinahe um, als ich sie sah. Das gelbliche Papier hatte die gleiche Stärke, das gleiche Format und die gleiche Farbe wie das Manuskript bei mir zu Hause. Die klare, großzügige Schrift war unverwechselbar.
Nur um ganz sicher zu gehen, zog ich die eine Fotokopie heraus, die ich mitgebracht hatte. Bookers Manuskript mußte ganz einfach echt sein. Es gab gar keine andere Möglichkeit. Ich verstand sofort, warum sich die Sammler nicht die Mühe machten, ihre Dokumente prüfen zu lassen. Man wußte es einfach.
Ich wandte mich dem Faksimile zu und legte meine Kopie über die erste Seite – genau das gleiche Format! Ich begann zu lesen: »Na, weil’s schon spät nachts war und gewitterte und das Ganze so geheimnisvoll aussah ...« Das klang merkwürdig. Es sollte an die Stelle anschließen, wo Colonel Sherburn den alten Boggs erschossen hatte. Dies hier war anscheinend das Kapitel, wo sie den leckgeschlagenen Dampfer fanden. Aber dann kehrte ganz schwach aus einer verstaubten Ecke meines Gedächtnisses der Name des Dampfers in die Erinnerung zurück – Walter Scott. Es war die Einfügung. Clemens hatte die Seite mit »81 A–1« numeriert. Ich nahm an, daß das »A« genau das gleiche bedeutete wie heute »Addendum« oder »Anfang«. Über sechzig der kleinen Seiten umfaßte das Addendum, die folgende Seite trug die Seitenzahl 160. Der erste Satz begann so: »Sie strömten die Straße rauf, auf Sherburns Haus zu ...«
Bevor ich nach Hause ging, versuchte ich, die Erzählung zu lesen, aber offen gestanden war ich zu aufgeregt dafür. Der vollständige Titel lautete: ›1002. Eine orientalische Geschichte‹, und war anscheinend Scheherazades Version von einem verschwundenen Manuskript. Eine gute Idee, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mit Linda übereinstimme, daß es sich um das schlechteste Werk des großen Mannes handelt. Ich fragte mich, ob neue Lektoren in der Mark-Twain-Forschung wohl Monate brauchten, um sich an den Umgang mit solchen Dingen zu gewöhnen. In meinem Wohnzimmer war das etwas anderes gewesen, weil ich nicht genau wußte, was ich vor mir hatte. Hier konnte ich mich überhaupt nicht beruhigen.
Ich brachte es fertig, immerhin soviel zu lesen, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Und ich warf einen Blick auf das Faksimile. Wie auf den Seiten bei mir zu Hause hatte der Autor hier sehr wenig korrigiert. Im Typoskript der ›Orientalischen Geschichte‹, das mir Linda ebenfalls geschickt hatte, gab es wesentlich mehr Korrekturen.
Nachdem ich das Material wieder abgegeben hatte, rief ich Linda an.
»Paul!« Ihre Stimme klang erfreut, daran war nicht zu zweifeln. »Das Gespräch mit Ihnen hat mir Spaß gemacht.«
»Mir auch. Vielen Dank, daß Sie sich soviel Zeit genommen haben.«
»Unsinn. Es tat mir leid, daß ich mich nicht länger mit Ihnen unterhalten konnte. Vielleicht können wir unser Gespräch später einmal fortsetzen.«
Überrascht stellte ich fest, daß sie plötzlich mit vollen Segeln flirtete. Warum auch nicht? Für einen bärtigen Bär mit Brille sah ich nicht schlecht aus. Und vermutlich hatte ich sie ziemlich interessiert angesehen. »Das würde mich freuen«, sagte ich. »Vielleicht könnten wir irgendwann zusammen Kaffee trinken. Inzwischen habe ich aber noch eine Frage. Hat Twain im Typoskript viel korrigiert?«
»Ganz bestimmt. Deshalb sind die Typoskripte für die Forschung so wichtig.«
»Also würde sich die hypothetische Huck-Finn-Handschrift in einigen Details von dem Buch unterscheiden, das wir heute kennen?«
»Unbedingt.«
Ich mußte sie also nur vergleichen. Aber mein altes Exemplar war mit meinem Haus verbrannt. »Sagen Sie, Linda«, fuhr ich fort, »ich brauche einen neuen Huck. Welche Ausgabe soll ich kaufen?«
»Unsere natürlich.«
»Sie meinen die neue. Aber es gibt doch bestimmt mehrere Studienausgaben?«
»Es gibt keine andere Ausgabe«, sagte sie nachdrücklich.
»Was ist mit der Ausgabe zum hundertsten Geburtstag?« Das war eine sehr populäre Ausgabe, die mit großem Trara vom Stapel gelaufen war.
Zur Antwort bekam ich ein verächtliches Schnauben. »Nur wenige wissen davon, aber dort wurde die letzte Zeile weggelassen.«
Auf meinem Weg in die Buchhandlung kam mir der Gedanke, daß ich im Moment von lauter Dingen erfuhr, von denen nur wenige wußten. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie ein Universitätsverlag dazu kam, die letzte Zeile eines Buchs wegzulassen. Trotzdem war es so. In der Ausgabe der Mark-Twain-Library (»unsere«, hatte Linda gesagt) war er drin, in der anderen nicht: »Mit besten Grüßen Euer Huck Finn. Ende.« Gekauft.
Als ich Buch und Manuskript verglich, wurde ich schon auf der ersten Seite belohnt, wo Huck einen Teil von ›Tom Sawyer‹ erzählt und sagt: »Nun, das Buch endet folgendermaßen: Tom und ich fanden das Geld, das die Räuber in der Höhle versteckt hatten, und wir wurden dadurch reich.«
Im Manuskript lautet der Satz: »Das Buch geht folgendermaßen aus: Tom und ich fanden das Gold, das die Räuber in der Höhle versteckt hatten, und wir wurden dadurch reich.« Der Autor hatte »nun« hinzugefügt und »geht aus« durch »endet« und »Gold« durch »Geld« ersetzt.
Ich las weiter. Und fand noch viele Unterschiede. Wenn das nicht echt war, wollte ich in dem Stück von Hucks aristokratischen Freunden des Königs Giraffe sein.