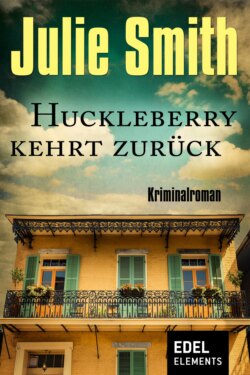Читать книгу Huckleberry kehrt zurück - Julie Smith - Страница 8
5
ОглавлениеFulton lag direkt bei Tupelo, der Geburtsstadt eines bedeutenden amerikanischen Helden. Es war eine so blühende Metropole, daß ich nicht sicher war, ob ich den Elvis-Presley-Park finden würde, um ihm meine Aufwartung zu machen. Aber ich gelobte, es auf jeden Fall zu versuchen, bevor ich die Stadt verließ.
Als erstes entdeckte ich das Natchez Trace Inn, trug mich ein und vertiefte mich eine Zeitlang in das Telefonbuch. Einen Edwin Lemon gab es nicht, aber dafür fünf andere Lemons. Zwei davon hatten nie von Edwin gehört, der dritte war nicht da und die vierte meinte, Edwin könnte mit der Kusine dritten Grades von ihrem Ehemann verwandt sein, Veerelle Lemon, die irgendwann weggezogen war, rüber nach Ballardsville. Veerelle war die fünfte. Ihre Stimme klang teilnahmslos. »Edwin? Edwin ist seit zehn Jahren nicht mehr hier. Seit ’77, glaub ich. Oder war das ’78, als er wegging? Also ehrlich, ich kann mich kaum noch dran erinnern.«
Wenn einem in der flimmernden Hitze von Itawamba County das Blut gefrieren konnte, dann war das jetzt bei mir der Fall. »Er war Ihr Mann?«
»Mein Sohn. So’n guter Junge, das gab’s nicht noch mal. Da war nichts, was er nicht für mich getan hätte.«
»Und wo ist er jetzt?«
»Hab seit zehn Jahren nichts mehr von ihm gehört.«
»Mrs. Lemon, ich stelle Nachforschungen für jemanden in Kalifornien an. Könnte ich für ein paar Minuten bei Ihnen vorbeikommen?«
»Sie wissen was über Edwin?«
»Vielleicht. Jedenfalls versuche ich, etwas zu erfahren.«
»Dann kommen Sie doch vorbei. Gleich morgen früh, ja?«
Die Fahrt nach Ballardsville war eine Reise in die Vergangenheit, fast bis in die Zeit von Huck und Tom. Es gab keine Gehwege und keine Straßenlaternen. Zwar waren die Straßen gepflastert und es gab viele Autos und Traktoren auf den Feldern, aber diesen Teil konnte man ausblenden. Die Farmhäuser hatten große Veranden mit Schaukelstühlen. Manchmal gab es Teiche, die eigentlich für Fische angelegt worden waren, aber so aussahen, als ob man prima darin baden könnte. Die Kinder der Pächter spielten barfuß, ihre Beine waren rot vom Staub.
Veerelle wohnte in keinem der bezaubernden alten Häuser, sondern in einem schlecht gebauten modernen Bau mit niedrigen Räumen. Sie hatte es offensichtlich mit den ausrangierten Möbeln von einem Dutzend Lemon-Familien eingerichtet, die eine Vorliebe für das frühe Amerika hatten, und etliche Kunstledersessel dazwischengestellt. Irgendwer in der Familie strickte Wolldecken und häkelte Sesselschoner.
Veerelle war eine von den reizenden alten Damen, denen man immer gern begegnet. Graumeliertes Haar mit einer ordentlichen Dauerwelle, hübsches Sommerkleid, auf dem Schoß eine Schüssel mit Bohnen. (»Es macht Ihnen doch nichts, wenn ich meine Bohnen fürs Abendessen schnippele, oder?«) Bei ihr mußte jeder sofort an seine Mutter denken.
»Ich kann Ihnen den Namen meines Klienten nicht nennen«, begann ich, »aber man hat mich mit einer Sache beauftragt, die vielleicht mit Ihrem Sohn zu tun hat.«
Ihre Augen wurden feucht. »Sie woll’n mir doch nicht erzählen, daß er vielleicht noch am Leben is’?« Die Tränen begannen zu fließen.
»Tut mir leid, Ma’am, daß ich Sie aus der Fassung gebracht habe. Aber ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe seinen Namen von einer Universitätsbibliothek, wo er ein paar Nachforschungen angestellt hat.«
»Bei einer Bibliothek? Aber Edwin hat doch in einer Bibliothek gearbeitet! Drüben im Itawamba Junior College.«
»Er war Bibliothekar?«
»Na sicher. Am Ole Miss hat er studiert, aber dann kam er nach Hause und hat hier gearbeitet. Und mir hat er das Haus gebaut, als sein Daddy tot war. Selbst hat er in Fulton gewohnt. In einer winzigen Wohnung.«
»War er verheiratet?«
»Nein. Eine Frau fand er immer zu teuer. Er hat nicht gern Geld ausgegeben – außer für mich. Für sich wollte er gar nichts, aber für seine Mama war ihm nichts zu teuer.«
»Da kann man sich kaum vorstellen, daß er zehn Jahre lang nichts von sich hören läßt. Das paßt doch gar nicht zu ihm.«
»So was hätte er ja auch nie getan.«
»Sie hören sich so an, als ob Sie die Hoffnung ziemlich aufgegeben hätten.«
Nachdem ihr jetzt offensichtlich klargeworden war, daß ich ihr keine falschen Hoffnungen machen wollte, hatte sie sich wieder unter Kontrolle. »Ich weiß schon lange, daß Edwin tot ist.«
»Woher denn, Mrs. Lemon?«
»Weiß ich einfach. Ich fühl es. Wenn alles in Ordnung wär, hätte er’s irgendwie geschafft, mir Bescheid zu sagen.«
»Vielleicht können Sie mir sagen, warum er hier fortgegangen ist?«
»Vielleicht sollte ich’s doch lieber nicht sagen. Mir ist immer noch nicht klar, warum Sie hier sind.«
»Ich glaube, daß vor zehn Jahren etwas passiert ist, was meinen Klienten betrifft und auch Ihren Sohn. Vielleicht kann ich herausfinden, was mit Ihrem Sohn geschehen ist.«
»Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich’s wissen will.«
»Sie glauben, daß er in irgendeine Sache verwickelt war – wie soll ich das sagen? Irgendwas ...« Irgendwas Kriminelles, meinte ich, aber der armen Veerelle konnte ich das nicht sagen. Sie kam mir so unschuldig vor, in ihrem häßlichen Backsteinhaus, das sie wahrscheinlich für das vornehmste Haus der Umgebung hielt.
»Edwin hatte eine Seite, über die ich lieber nicht nachdenken will.«
»Mrs. Lemon, ich will Sie nicht drängen, aber es könnte möglicherweise sehr hilfreich sein, wenn Sie mir sagen, was Sie damit meinen.«
Energisch brach sie die Bohne in ihrer Hand in Stücke. Das laute Knacken ließ darauf schließen, daß die Bohne für meinen rechten Arm herhalten mußte. »Das laß ich lieber bleiben. Aber ich hab mich entschlossen, Ihnen zu erzählen, wie er weggegangen ist. Vielleicht will ich doch wissen, was mit ihm passiert ist. Vielleicht ...« Ihre Augen füllten sich wieder mit Tränen. »Es könnte ja sein ...« Wortlos stand sie auf, ging aus dem Zimmer und kam mit einem Papiertaschentuch zurück, das sie in der Hand zerknüllte. Sie setzte sich, stellte die Schüssel mit den Bohnen vorsichtig auf einen Beistelltisch und sah mich aufmerksam an. »Edwin kam eines Tages vorbei und sagte: ›Komm mit, wir machen einen Ausflug mit meinem neuen Auto.‹ Herrje, das hätte mich fast umgehaun. Edwin hat nie was für sich gekauft. Sein Auto war zehn Jahre alt, und er behauptete, daß es noch lief wie geschmiert. Wenn er mir ein neues Auto gekauft hätte, das hätt mich weniger gewundert; so einer war er. Sich selbst hat er nie was gegönnt. Aber an dem Tag kam er in ’nem netten kleinen knallgelben Datsun vorbeigefahren. Ich hab eine Bemerkung wegen der Farbe gemacht, und er sagte: ›Aber Mama, das ist zitronengelb, wie Lemon.‹
Er machte eine Fahrt mit mir, und dann gingen wir zusammen rein und tranken Kaffee, und er sagte: ›Mama, ich mach ein bißchen Urlaub.‹ Na ja, ich war nicht sicher, ob ich richtig gehört hatte, weil’s Oktober war – und Edwin war Bibliothekar am College. Da gab’s jetzt keine Ferien. Ich sagte: ›Edwin, was redest du da bloß?‹ Und er sagte, er nimmt sich ’nen Monat frei. ›Wanda Kimbrough macht Vertretung für mich‹, sagte er. ›Sie ist froh, daß sie Arbeit hat, und die sind vielleicht froh, daß sie sie kriegen.‹ Na ja, können Sie sich vorstellen, wie ich mich da gefühlt hab? Ich sagte: ›Sohn, du redest, als ob du nicht mehr wiederkommst.‹ Er sagte: ›Ich komm wieder. Ich komm bestimmt wieder, und dann kann’s vielleicht sein, daß ich ’ne kleine Überraschung für dich hab. Es kann gut sein, daß ich ein bißchen Geld reinkrieg.‹ Und am nächsten Tag fuhr er in dem zitronengelben Datsun weg.«
»Über das Geld hat er sonst nichts gesagt?«
»Ich hab alles mögliche probiert, ums aus ihm rauszukriegen, aber er sagte kein Wort mehr. Sagte immer wieder, er wollte mir keine Hoffnungen machen.«
»Hat er gesagt, wo er hinwollte?«
»Hat er.« Ihre Lippen bildeten einen dünnen, harten Strich. »San Francisco.«
»Mehr hat er Ihnen nicht erzählt? Hat er vielleicht ein Buch erwähnt oder ein Manuskript?«
Plötzlich, zum ersten Mal während des Gesprächs, lächelte sie. »Nein, wieso? Hat er an einem Buch gearbeitet? War es das?«
»Wie bitte?«
»Edwin hat ein Buch geschrieben! Also darum geht’s die ganze Zeit. Und jetzt weiß ich, warum er so plötzlich weggefahren ist – ich wette, er hat’s jemandem geschickt, der’s drucken wollte.«
»Madam, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ich habe nur einen Verdacht und möchte gern wissen, ob Sie ihn mir bestätigen können – wer war Edwins Lieblingsschriftsteller?«
»Lieblingsschriftsteller?« Sie sah verwirrt aus. »Moment! Jetzt weiß ich’s. Es war dieser Neger.«
»Wie bitte?«
»Sie wissen schon.« Sie zog ein zerlesenes Taschenbuch aus dem Bücherschrank und zeigte mir den Titel: ›Giovannis Zimmer‹.
»Ach so, James Baldwin.«
»War das der, den Sie gemeint haben?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich dachte an Faulkner.«
Sie lächelte zum zweiten Mal. »Von dem halten wir hier nicht viel.«
»Ich würde gern mit ein paar von Edwins Freunden reden, wenn ich schon mal hier bin.«
»Da würd ich mit Wanda Kimbrough anfangen, wenn ich Sie wär. Sie arbeitet immer noch da drüben.«
Mit ›da drüben‹ meinte sie die Bibliothek des Itawamba Junior College, wo Wanda Kimbrough vor zehn Jahren als Vertretung für einen Mann angefangen hatte. Mir schoß durch den Kopf, ob es sich lohnte, für diesen Arbeitsplatz zu töten.
Falls das so war, konnte ich mir Wanda dennoch nicht als Verdächtige vorstellen. Das konnte aber auch daran liegen, daß ich mir das nicht vorstellen wollte. Sie war üppig und freundlich, was ich mochte; und sie sprudelte mit allem heraus, was ihr in den Sinn kam. Das ist für mich die schönste menschliche Eigenschaft überhaupt.
»Eine Frage«, legte sie los, »ist Ihr Klient schwul?«
»Dem entnehme ich, daß Edwin schwul war.«
»Sie entnehmen richtig. Aber Veerelle ist eine strenggläubige Baptistin und obendrein tyrannisch bis zum letzten. Ich freu mich für Eddie. Hab ich immer getan. Weil ich verdammt genau weiß, was passiert ist – er hat in San Francisco so viele Schwanzlutscher gefunden, wie er sich’s immer erträumt hat, und damit war Schluß mit Fulton, Miss’ippi. Sehen Sie, Eddie konnte hier nie so sein, wie er wirklich war, weil seine Mama ihm immer über die Schulter geguckt hat. Und vor lauter schlechtem Gewissen, weil er schwul war, hat er jeden Penny, den er verdient hat, für sie ausgegeben und verdammt wenig für sich selbst behalten. Und wissen Sie was? Ich glaub, Veerelle hat’s gewußt. Ich glaub, sie hat’s die ganze Zeit gewußt. Und sie hätte ihm nie den Gefallen getan, ihm zu sagen, daß sie’s wußte und akzeptierte. Sie hat einfach alles genommen, was er hatte, und sich von vorne bis hinten von ihm bedienen lassen.«
»Ich fand sie gar nicht so übel.«
»Ach, ich glaube, sie ist auch nicht schlimmer als die anderen Scheinheiligen hier in der Gegend. Hier wimmelt es nur so von denen. Aber Tatsache war, daß sie Eddie das Leben zur Hölle gemacht hat, und er mußte da raus.«
»Woher kannten Sie Eddie?«
Während wir redeten, nahm sie ein paar Bücher von einem Handwagen und sortierte sie ein. Sie behandelte die Bücher sorgfältig und liebevoll, wie alle echten Bibliophilen. »Vom Ole Miss. Wir hatten beide Englisch als Hauptfach.«
»Dabei fällt mir was ein – wer ist Ihr Lieblingsschriftsteller?«
»Was? Sind Sie verrückt?«
»Schnell, sagen Sie: Wer ist es?«
»Faulkner. Was geht Sie das eigentlich an?«
»Und danach?«
»Eudora Welty.«
»Wen mochte Eddie am liebsten?«
Sie schnitt eine Grimasse. »James Baldwin natürlich. Was zum Teufel soll die Frage?«
Ich beschloß, mich noch ein letztes Mal in Amateurpsychologie zu versuchen: »Ich wollte wissen, ob Sie Mark Twain sagen.«
Sie sah völlig verblüfft aus. Vielleicht war sie eine gute Schauspielerin, aber ich glaubte nicht, daß sie etwas von dem Manuskript wußte. Ich sagte: »Weil Ihr Freund bei einer Universitätsbibliothek angerufen hat, um sich nach etwas zu erkundigen. Bei der Bibliothek der University of California.«
»Meinen Sie Berkeley?«
Ich nickte. »Er sagte, er würde in ein paar Tagen vorbeikommen, um etwas zu überprüfen, aber er hat sich dann nie blicken lassen.«
Sie schnappte nach Luft. »Also ist er vielleicht nie dort angekommen.«
»Das ist sicherlich möglich.«
»Und in all den Jahren vermutete ich ihn im Schwulenhimmel auf Erden.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Vielleicht hatte er seinen Plan geändert und woanders versucht zu erfahren, was er wissen wollte. Die Sache ist die: Ich glaube, daß er etwas wußte, was für den Fall wichtig ist, an dem ich arbeite. Was wissen Sie über den Grund, weshalb er wegging?«
»Er hat mir nur gesagt, daß er sich in San Francisco umsehen wollte. Im Castro, Sie wissen schon, im Schwulenviertel. Er sagte, wenn es ihm dort gefallen würde, wollte er vielleicht dort hinziehen.«
»Aber sein Abschied kam ziemlich plötzlich, oder? Es sieht doch etwas seltsam aus, sich dafür den Semesteranfang auszusuchen, wenn man genausogut im vergangenen Sommer hätte gehen können.«
»Er hat sich darüber nie so genau ausgelassen, aber ich glaube, er war auf einen Typ aus San Francisco scharf, der hier den Sommer verbracht hat. Bei einem Freund zu Besuch, wie mir gesagt wurde. Eddie hatte hier keinen Liebhaber, aber ich glaube, ihm wurde ganz warm ums Herz, als er Tad kennenlernte – Tad Ludwig hieß er. Klasse Typ, wenn man auf blond steht. Aber Tad war schon vergeben. Jedenfalls sah es so aus.«
»Sie glauben, Eddie hatte eine Affäre mit ihm?«
»Ich will es mal so sagen. Eines Nachts begegnete ich den beiden auf einem Parkplatz. Man soll ja nicht vorschnell urteilen, aber Eddie kniete.«
»Also nehmen Sie an, daß Eddie plötzlich von einem unwiderstehlichen Verlangen für Tad gepackt wurde?«
»Entweder das, oder er bekam einen Anruf von ihm.«
»Eine Frage: Veerelle sagte, ihr Söhnchen hatte eine Seite, über die sie nicht gern nachdenke. Was meinen Sie, was sie damit gemeint hat?«
»Daß er schwul war, nehme ich an.«
»Und wie war Ihr Eindruck – können Sie sich vorstellen, daß Edwin in krumme Sachen verwickelt war?«
Sie lachte, wieherte geradezu. »Eddie? Er hat mir beigebracht, wie man klaut, als wir achtzehn waren.«
»Das ist alles?«
»Sie Unschuldslamm, ich kann nur sagen, es war ein Glück, daß Edwin keinen Funken Ehrgeiz besaß. Denn sonst hätte er sogar noch die alte Veerelle gevögelt, um zu kriegen, was er wollte.«
Außer ihr, erzählte Wanda, hatte Edwin nur noch einen engeren Freund, der noch in der Gegend von Tupelo lebte: Tad Ludwigs Freund, Duncan Jones. Dunc war Englischlehrer und hatte sein Sprechzimmer beinahe in Rufweite von der Bibliothek. Er war schon älter und zog jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viele von Wandas klasse Typen an. Sein Haar war dünn geworden, und er trug eine Brille, besaß aber zum Ausgleich ein freundliches, offenes Gesicht. Er machte einen ehrlichen Eindruck, aber es konnte durchaus sein, daß der Schein trog.
Auch nach zehn Jahren schien er Edwin eine Sache noch immer nicht verziehen zu haben: »Er hat mir nie gesagt, daß er wegwollte. Eines Tages war er einfach nicht mehr in der Bibliothek, dafür war Wanda da.«
»Haben Sie eine Ahnung, warum er gegangen ist?«
»Nur das, was er Wanda angeblich erzählt hat.«
»Das klingt nicht so, als ob Sie ihr glauben.«
»Ich bin klug genug, um Wanda mit Vorsicht zu genießen.«
»Hatten Sie den Eindruck, daß Edwin ein ehrlicher, anständiger Kerl war?«
»Absolut. Warum – hat Wanda gesagt, er wäre es nicht?« Er schnaubte verächtlich. »Wanda hat soviel Moral wie ein Laubfrosch.«
»Ach. Also gut, wer ist Ihr Lieblingsschriftsteller?«
»Mark Twain. Warum?«
Darauf war ich nicht vorbereitet. Aber ich reagierte schnell und schob noch etwas hinterher, das er nicht ignorieren konnte: »Wußten Sie, daß Edwin eine Affäre mit ihrem Freund Tad Ludwig hatte?«
»Diese Fotze!«
»Tad oder Edwin?«
»Wanda. Ihre Klappe ist das reinste Minenfeld.«
»Heißt das, sie redet zu viel oder sie lügt?«
»Beides.«
Damit kam ich nicht weiter – Zeit für die Rückblende zum Thema: »Haben Sie sich mit Edwin jemals über Mark Twain unterhalten?«
»Nicht daß ich wüßte. Warum?«
»Denken Sie gründlich nach. Speziell über ›Huckleberry Finn‹.«
Er zog die Augenbrauen hoch. »Nein. Da bin ich sicher. Aber hätten Sie was dagegen, mir mal zu sagen, warum Sie fragen?«
»Ich fürchte, da hab ich was dagegen.«
Aber ich nahm an, daß er es von Wanda erfahren würde, wo sie so gute Freunde waren.
Eine Sache galt es noch zu erledigen, bevor ich tun konnte, was ich wirklich wollte. Im Büro des ›Journal‹ verfaßte ich den folgenden Text: »Es könnte sein, daß ich etwas habe, was Ihnen gehört. Mr. Mark Twain hat es geschrieben, und im großen und ganzen hat er da drin die Wahrheit gesagt. Bitte anrufen wegen Übergabe.«
Dann setzte ich noch eine Anzeige auf, in der ich um Informationen über den Aufenthaltsort von Edwin Lemon bat. Nachdem ich beides aufgegeben hatte, machte ich mich auf, wie das jeder echte Amerikaner tun würde, um eine tiefe spirituelle Erfahrung am Geburtsort von Elvis Presley zu suchen.
Etwas machte mich auf der Stelle sentimental. Ein cleverer Architekt hatte die Kapelle im Elvis Memorial Park so konstruiert, daß sie mit dem heiligen Ort in einer Linie lag. Wenn man sich also zufällig dort trauen ließ, sah man hinaus auf das winzige Haus, in dem der King das Licht der Welt erblickt hatte. Einen Augenblick lang dachte ich darüber nach, ob Sardis einen diesbezüglichen Antrag in Erwägung ziehen würde.