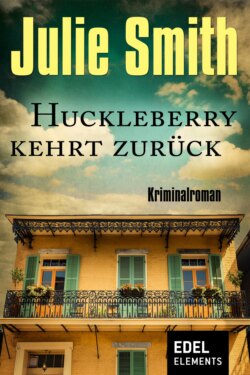Читать книгу Huckleberry kehrt zurück - Julie Smith - Страница 7
4
ОглавлениеDas Problem war, die Banken hatten schon geschlossen. Auch gut; ich wußte, was ich mit dem Manuskript machen würde.
Ich fuhr mit meinem Toyota in Richtung Osten, freute mich auf zu Hause und hoffte insgeheim, Sardis in meiner Küche anzutreffen, wo sie vielleicht ein Huhn mit ihrer leckeren Salbeifüllung zubereitete. Aber ich wußte, daß es nicht so sein konnte. Eigentlich war ich derjenige gewesen, der sich geweigert hatte, die Schlüssel zu tauschen. Wenn Sardis glaubte, daß ich für ein Zusammenleben mit ihr nicht reif genug war, dann würde ich verdammt noch mal dafür sorgen, daß sie nicht in den Genuß des Zusammenlebens mit mir kam. Vielleicht wurde es ihr hier und da zu unbequem, daß sie meinen Schlüssel nicht hatte, und dann, so sagte mir mein Verstand, würde sie sich eines Besseren besinnen. (Obwohl der Verstand eigentlich wenig damit zu tun hatte – es war reine Sturheit, und das wußte ich genauso gut wie Sardis. Aber ich war mein Leben lang stur gewesen und würde jetzt auch nicht damit aufhören. Egal, wie unbequem das für mich war.)
Und ehrlich gesagt, war es eigentlich nur für mich unbequem. Sardis hatte ihr Apartment mit ihrer künstlerischen Ader und ihrer sinnenfrohen Liebe zu Stoffen eingerichtet. Es sah äußerst einladend aus und meines mehr als kahl. Unsere Apartments hatten die gleiche Aufteilung – Wohnzimmer, Eßzimmer, Küche, Schlafzimmer und ein Extrazimmer als Arbeitszimmer oder Atelier. Ich würde weder das Schlaf- noch das Arbeitszimmer benutzen, bevor ich mir eine Einrichtung dafür leisten konnte. Meine verbrannten Möbel waren zwar versichert gewesen, aber ich hatte das ganze Geld in das Haus gesteckt, weil es um einiges mehr als das alte gekostet hatte.
Bisher hatte ich nur fünf größere Gegenstände gekauft – meinen schönen Eßtisch, ein Videogerät, eine Stereoanlage, ein unbehandeltes Bücherregal und ein Gemälde. Ich hatte durch den Brand ein Bild verloren, an dem ich sehr hing, und brauchte Mary Robertsons kleine Szene am Fluß, um mich zu trösten.
Es gab noch einen schönen Gegenstand in der Wohnung – noch ein Gemälde, das mir Sardis zum Einzug geschenkt hatte. Ich fand, daß es ihre bisher beste Arbeit war, und war stolz, es zu besitzen. Es handelte sich um eine kraftvoll stilisierte Darstellung eines Feuers, ein Bild, das für uns beide mehrere Bedeutungsebenen hatte, angefangen mit dem Verlust meines Hauses und der Art und Weise, wie Sardis mich anschließend bei sich aufgenommen hatte, bis hin zu dem, was in den folgenden Wochen passiert war, nicht nur zwischen uns, sondern auch um uns herum.
Mein übriger Besitz bestand aus ausrangierten Gegenständen von anderen Leuten – ein altes Bett, das sich zum Sofa zusammenklappen ließ, ein Fernseher, eine Kommode mit Schubladen, alte Chromstühle mit Plastiksitzen, die neben dem Eichentisch fürchterlich aussahen, und ein unglaublich schwerer, häßlicher Wohnzimmertisch. Das Biest hatte eine Glasplatte auf einem scheußlich verzierten maschinengedrechselten Fuß, so daß man von oben jeden geschmacklosen Schnörkel sah.
Das war der Schrott, zu dem ich Sardis den freien Zugang verwehrte – mehr oder weniger ein Trödelladen. Ich war erst zwei Tage dort, fühlte mich aber unbestreitbar zu Hause. Es würde jedenfalls ein Zuhause werden – meine Bücherregale quollen bereits über, und jetzt hatte ich auch noch Bookers Kerzenleuchter. Von dem Geld, das er mir zahlte, konnte ich vielleicht sogar ein paar anständige Stühle fürs Eßzimmer und einen neuen Wohnzimmertisch kaufen.
Als ich einparkte, lag Spot vor dem Eingang, eine mittelgroße schwarze Fellkugel, die sich entrollte und streckte, als ich näher kam. Also, hier war mein Zuhause. Mit oder ohne Sardis, Spot war da.
Das Manuskript lag auf dem schauerlichen Wohnzimmertisch. Jetzt, da ich von seiner Echtheit überzeugt war, verletzte dies mein ästhetisches Empfinden. Und da ich jetzt glaubte, daß Beverly wegen dieses Manuskripts umgebracht worden war, versetzte es mich außerdem in Angst und Schrecken. Die einzige Möglichkeit, es zu verstecken, sah ich in der Aneignung dieses fremden geistigen Eigentums – und ich hatte weiß Gott genügend Manuskripte, um das bewerkstelligen zu können. Fünf meiner unveröffentlichten Meisterwerke befanden sich zur Zeit des Brandes in den Händen von unentschlossenen (und schließlich ablehnenden) Lektoren. Eins lag bei einem potentiellen Agenten und mein neuestes bei einem Bekannten. Mein Lebenswerk war also nicht verloren. Ich besaß etliche wertlose Manuskripte, unter denen man das von Mr. Clemens verschwinden lassen konnte. Ich legte das erste Kapitel von ›Vandale in Böhmen‹ auf Huck Finn, beschriftete es wie all meine anderen Manuskripte und verbannte es ans untere Ende des Stapels.
Dann ging ich nach oben, um Sardis zu berichten, und hoffte auf eine Einladung zum Abendessen – ohne Erfolg. Statt dessen machte ich mir eine Thunfischpasta. Während ich darauf wartete, daß das Wasser kochte, schob ich einen Anruf beim ›Chronicle‹ ein: »Hasilein, hier spricht Paul.«
»Herzallerliebster! Wann wirst du diese Blondine verlassen und wieder heimkommen zu deiner Deb?« Debbie war dicht am Pensionsalter, mochte Sardis sehr gern und würde mir endlose mütterliche Predigten halten, wenn ich auf die Idee käme, mich von ihr zu trennen.
»Ich stehe mit meinem Koffer unten vor der Tür.«
»Mach dich nicht über die alte Deb lustig. Wie ist die neue Wohnung?«
»Die Wohnung ist toll. Und ich habe einen interessanten Job, der mir vielleicht sogar dazu verhilft, sie einzurichten.« Weil Debbie so etwas wie meine Lieblingstante ist – und mein volles Vertrauen genießt –, zögerte ich keine Sekunde, ihr die ganze Geschichte zu erzählen, wobei ich nicht einmal Bookers Namen wegließ. Sie kannte ihn von meiner längst verjährten Story, warum hätte ich ihr also etwas vormachen sollen?
Ihre Reaktion war typisch: »Schatz, darüber mußt du schreiben! Das ist die wildeste Geschichte, die ich seit Jahren gehört habe.«
»Sicher, aber es gibt da ein teuflisches Problem, findest du nicht auch?«
»Na ja, wenn’s nur um die Wahl zwischen Geld und Ruhm geht ...«
»Das eigentlich nicht. Ich bin mit Booker befreundet, erinnerst du dich?«
»Konzentrier dich auf das Wesentliche.«
»Und ich würde mich sowieso für das Geld entscheiden. Es ist nur so, daß ich ein bißchen Hilfe brauche.«
»Hab ich mir gedacht. Du willst, daß ich bei den Bullen anrufe.« Und sie legte auf, ohne die Antwort abzuwarten.
Ich verputzte gerade den letzten Rest der Thunfischpasta, als das Telefon klingelte.
»Süßer, die Sache ist nicht sehr hübsch. Jemand hat die arme Beverly erdrosselt und mit dem Kopf auf den Boden geschlagen.«
»Puh. Wenigstens wurde sie nicht erschossen.«
»Wie bitte?«
»Nicht so wichtig. Wann ist es passiert?«
»Ziemlich spät. Zwischen neun und elf.«
Nicht so gut für Booker.
»Aber eher gegen neun, sagen sie. Weil jemand gegen halb zehn versucht hat, sie anzurufen, und da war besetzt. Es hat sich herausgestellt, daß der Hörer nicht auf der Gabel lag, als ihre Mitbewohnerin sie am nächsten Morgen fand.«
Schon besser für Booker – um neun war er bei uns gewesen.
»Die Polizei glaubt, daß dein Kumpel es war.«
»Wie meinst du das?«
»Bev und Isami haben den Einbruch natürlich angezeigt. Die Bullen glauben, daß der Einbrecher wiedergekommen ist.«
»Warum sollte er?«
»Er hat Beverlys Schmuck nicht gekriegt. Genauer gesagt, soviel die Bullen wissen, hat er gar nichts von Bev gekriegt; den Verlust eines Manuskripts von unschätzbarem Wert hat sie natürlich nicht angegeben. Sie nehmen an, daß er nur in Isamis Zimmer war und dann irgendwie gestört wurde, bevor er bei Bev nachsehen konnte. Deshalb kam er in der nächsten Nacht wieder, sie hat ihn überrascht, und er hat sie auf die letzte Reise geschickt.«
»Das ist ihre Theorie, oder?«
»Nicht schlecht, wenn du mich fragst. Wer glaubt schon an einen neurotischen Einbrecher, der sich an seinem lieben Daddy rächen will?«
»Noch eine Frage, Deb – wurde sie sexuell mißbraucht?«
»Anscheinend nicht. Nur gewürgt und übel zugerichtet.«
»Danke, Darling. Sag Bescheid, wenn du was von mir brauchst.«
»Mach ich, Schatz. Mit dem größten Vergnügen.«
Gute alte Deb. Sie hatte mir so oft geholfen, daß ich die Fälle gar nicht mehr zählen konnte. Sogar Geld hatte sie mir schon geliehen, ohne je um eine Gegenleistung zu bitten. Ihr Auftreten war forsch – einer forschen Reporterin angemessen –, aber wenn ich je einen Menschen mit einem goldenen Herzen kennengelernt hatte, dann war es Debbie Hofer, und ich hätte sie auf der Stelle geheiratet, wenn sie mich hätte haben wollen. Wollte sie aber nicht.
Sie hatte das unmißverständlich klargestellt. Und Sardis wollte nicht einmal mit mir zusammenleben.
Also gut. Da würde ich mich eben mit der Gesellschaft eines der weltbesten Humoristen begnügen müssen. Ich öffnete eine Flasche roten Glen Ellen Proprietor’s Reserve, mein derzeitiger Lieblingswein, und nahm meinen neuen Huck Finn zur Hand. Schließlich hatte ich gestern damit angefangen – warum sollte ich ihn nicht zu Ende lesen? Aber nach kurzer Zeit hatte ich einen Geistesblitz und griff wieder zum Telefon. »Isami Nakamura? Hier spricht Ben McGonagil vom ›Examiner‹. Ich schreibe einen Nachruf auf Ihre Mitbewohnerin und würde Ihnen gern ein paar Fragen stellen.«
»Eigentlich wollte ich gerade weggehen. Ich werde eine Zeitlang woanders wohnen und bin nur kurz vorbeigekommen, um ein paar Sachen zu holen.«
»Ach. Können Sie mir dann vielleicht sagen, wen ich sonst fragen könnte – vielleicht ihre Eltern?«
»Mr. und Mrs. George Alexander. In Hillsborough. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum Sie mich nicht schon danach gefragt haben, als Sie mich wegen des Mordes interviewten?«
»Immer eins nach dem anderen, das ist meine Devise.«
Daß sie mit McGonagil gesprochen hatte, war interessant. Er war ein Star. Wenn sie ihn auf die Story angesetzt hatten, wollte der ›Examiner‹ die Sache groß aufmachen. Ich rief in Hillsborough an, diesmal mit neuer Identität. »Hallo – hier spricht Blick vom ›Progress‹.«
George Alexander war der Abscheu deutlich an der Stimme anzuhören: »Irgendwie mit dem Inspektor Blick von der Mordkommission verwandt?«
»Mit dem? Gott sei Dank nicht. Der Name ist in dieser Gegend weit verbreitet.«
»Was kann ich für Sie tun, Mr. Blick?«
»Ich schreibe einen Nachruf auf Ihre Tochter und hätte Ihnen gern ein paar Fragen gestellt.«
»Das haben schon etliche Reporter vor Ihnen getan, da kommt es auf Sie auch nicht mehr an.«
»Wie alt war sie, Sir?«
»Vierunddreißig.«
»Entschuldigen Sie bitte, sagten Sie vierundzwanzig?«
»Vierunddreißig.«
»Wie lange ist sie schon geflogen?«
»Zehn Jahre. Hat ihr Studium abgebrochen, um sich die Welt anzusehen. Ich glaube, es hat ihr Spaß gemacht. War nie wieder hier.«
»Wo hat sie studiert?«
»An der Universität von Michigan. Geschichte. Ihren ersten Abschluß hat sie am Bryn Mawr gemacht. Auch in Geschichte.«
»Die nächste Frage können Sie sich wohl schon denken?«
»Die Familie besteht aus ihrer Mutter und mir und einem Bruder.«
»Sie haben mir sehr geholfen, Sir. Vielen Dank.«
Ich legte auf und fand es ziemlich bedauerlich, daß die Höflichkeit es verbietet, einen trauernden Vater nach dem Vorstrafenregister seiner Tochter zu fragen. Trotzdem war ich mit dem Ergebnis meines Telefonats sehr zufrieden. Beverly Alexander hatte keineswegs zu den leichtsinnigen Mädchen gehört. Oder falls doch, dann wenigstens zu der gebildeten, etwas älteren Sorte. Offensichtlich war sie ein bißchen überqualifiziert gewesen, wofür es vielleicht einen Grund gab. Vielleicht war sie Alkoholikerin oder drogenabhängig. Oder einfach nur faul. Auf jeden Fall hatte ich es mir einfacher vorgestellt, sie zu durchschauen. Mir kam eine Idee, und ich wählte die Nummer ihres Vaters zum zweiten Mal. »Mr. Alexander? Hier ist noch mal Blick. Ich möchte doch einen größeren Artikel über Beverly schreiben und versuche herauszubekommen, was für ein Mensch sie war. Wissen Sie vielleicht, wer ihr Lieblingsschriftsteller war?«
»Albert Camus.«
»Eigentlich meine ich ihren liebsten amerikanischen Schriftsteller.«
»Mr. Blick, sind Sie wirklich nicht mit diesem Mordinspektor verwandt?«
Muffiger alter Geier. Kein Wunder, daß seine Tochter ausfliegen wollte. Ich kehrte zu Huck, Jim und dem Glen Ellen zurück – allesamt eine angenehmere Gesellschaft.
Aber mich irritierte die Tatsache, daß McGonagil und Blick vor mir an den Leuten dran gewesen waren. Zwar hatten sie vor mir von Beverlys Tod erfahren – weil das zu ihrem Job gehörte –, aber bei mir hatten schon Augenblicke der Zerstreutheit eingesetzt, als es noch das eine oder andere zu erledigen gab. Wenn ich Bookers dickes Geld wert sein wollte, mußte ich mich ranhalten. Als die Bibliothek am nächsten Tag geöffnet wurde, stand ich schon vor der Tür.
Die schöne Linda sah so frisch aus wie der junge Morgen, aber schon wieder mit reizvoll verschmiertem Augen-Make-up. Als sie mich sah, errötete sie – noch ein Pluspunkt. »Ah, Paul McDonald.«
»Darf ich Sie etwas Ungewöhnliches fragen, Linda?«
»Nur zu.«
»Der fehlende Teil von Huck Finn – was wäre, wenn er doch noch existiert?«
»Ich dachte, darüber hätten wir gesprochen – wir würden uns darum reißen.«
»Nein, nein – lassen Sie mich die Frage neu formulieren. Gibt es darüber irgendwelche Geschichten? Ich meine zum Beispiel, daß Clemens das Manuskript seiner Tochter zur Aufbewahrung gegeben hat, die es dann an einen Unbekannten verkaufte. Oder es befindet sich vielleicht in einer Privatsammlung, an die aber niemand rankommt, obwohl man sogar weiß, wer der Eigentümer ist. Eine von diesen Geschichten, die jeder kennt, die aber nicht bewiesen werden können – wie die Gerüchte über gestohlene Kunstwerke.«
»Sie meinen Legenden. Wie die Spukgeschichten über UFOs, die man gesichtet haben soll.«
»Genau.«
»Es gab tatsächlich einmal eine Geschichte. Aber das ist die einzige, die ich kenne – um das Manuskript rankt sich kein Gespinst aus sagenumwobenen Überlieferungen.«
»Und was ist das für eine Geschichte?«
»Das kann ich Ihnen sogar genau sagen, weil ich den Anruf entgegengenommen habe. Es war« – sie kniff die Augen zusammen – »vielleicht 1978? Nein, 1977. Vielleicht auch im Herbst davor. Nein, es war Winter. Das weiß ich genau, weil ...«
»Also mehr oder weniger vor zehn Jahren?«
»Ungefähr. Wenn Sie mich mal eine Minute nachdenken lassen ...«
»Soviel Zeit hab ich schon.« Ich hoffte, daß sie die Anspielung verstand und einen Zahn zulegte. »Wer war es?«
Sie kniff wieder die Augen zusammen – ihr Make-up sah mit jeder Sekunde schlimmer aus. »Edwin ... Apple. Nein, Lemon. Edwin Lemon.«
»Kennen Sie ihn?«
»Mein Gott, nein, er rief an und sagte im schönsten Südstaaten-Dialekt: ›Hier ist Edwin Limmon aus Fuh-al-ton Miss’ippi.‹«
»Foolton?«
»Fulton, glaube ich.«
»Und was hat er gesagt?«
»Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, daß er mir die gleichen Fragen stellte wie Sie neulich – ob man weiß, was mit dem Manuskript passiert ist? Welche Teile fehlen? Und so weiter. Dann sagte er, er habe wahrscheinlich den Rest.«
»Das kann doch nicht wahr sein!«
»Doch, bestimmt. Einfach so. Das ist nur dieses eine Mal passiert. Er sagte, er würde es uns sofort herbringen, damit wir es uns ansehen könnten.«
»Und dann?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Wir haben nie wieder von ihm gehört.«
»Sie haben nicht versucht, der Sache auf den Grund zu gehen?«
»Ich nahm an, daß es nur Unfug war.«
»Haben Sie hier eine Karte von den USA?«
»Ich könnte vielleicht eine auftreiben. Warum?«
»Ich möchte nachsehen, wo Fuh-al-ton ist.«
Fünf Minuten später hatte ich Booker am Telefon, der fluchte. »Sieh zu, daß du in ein Flugzeug kommst, McDonald. Was denkst du dir eigentlich dabei – glaubst du, ich bin ein Geizhals? Ich will, daß die Sache erledigt wird, und zwar anständig. Fahr hin, wo du willst, ist mir egal, was es kostet. Und beeil dich. Dieser Kram macht mich ganz nervös.«
»Na ja, ich könnte die Maschine nach Memphis in anderthalb Stunden erwischen.«
»Dann tu’s.«
»Ehrlich gestanden sind die Kreditkarten-Leute immer noch sauer.« (Als sie mir mein Konto wegen Überziehung gesperrt hatten, schnitt ich meine Karte in kleine Fetzen, schmierte Katzenfutter drauf und schickte sie zurück. Ich erzählte ihnen immer wieder, daß ich inzwischen reifer geworden sei, aber sie hatten mich durchschaut.)
»Komm vorbei, dann gebe ich dir einen Vorschuß.«
Ich raste nach Hause, schmiß ein paar Sachen in eine Tasche und wollte gerade die Tür abschließen, als mir das Manuskript einfiel. Ich hatte vorgehabt, es zur nächsten Bank zu bringen, sobald sie aufmachten. Jetzt war keine Zeit dafür. Sollte ich es mitnehmen? Nein. Viel zu gefährlich. Ich würde Sardis überreden müssen, es zur Bank zu bringen. Aber ich hatte noch nicht einmal genug Zeit, um mit ihr zu reden. Ach so – ich mußte sie auch bitten, Spot zu füttern; ich würde sie vom Flugplatz aus anrufen. Ich legte den Schlüssel unter die Fußmatte und zog los.
Da ich noch bei Booker vorbeifahren mußte, stieg ich dreißig Sekunden vor dem Abflug ins Flugzeug. Also rief ich Sardis erst an, als wir in Memphis wieder Boden unter den Füßen hatten, und bis dahin war das undankbare Weib aus irgendeinem selbstsüchtigen Grund ausgegangen. Ihr Pech, daß sie meinen frisch erworbenen Akzent nur aus zweiter Hand zu hören bekam. »Hier ist dein Getreuer aus der Huckleberry-Gemeinde«, teilte ich ihrem Anrufbeantworter mit, »bin in Mimfis, auf’m Weg nach Fuh-al-ton, Miss’ippi. Und ’nem netten alten Manuskript auf der Spur.« Sardis kam aus Mississippi, und ich wußte, es würde sie freuen, daß ich ihre Sprache gelernt hatte.