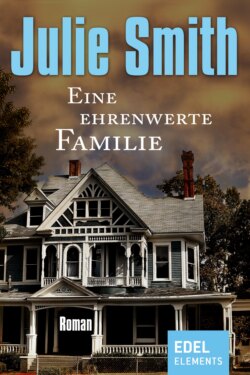Читать книгу Eine ehrenwerte Familie - Julie Smith - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеDas Rauschen des Bluts in ihren Ohren war wie ein wilder Trommelwirbel, das Lenkrad war glitschig von ihrem Schweiß. Reed fuhr den Mercedes wie einen Sportwagen und fluchte, weil sie die Kurven nur schwerfällig nehmen konnte.
Meine Schuld, dachte sie. Dennis könnte das besser. Verdammt noch mal, jeder könnte es besser.
Blind vor Tränen, versuchte sie, nicht nachzudenken, nur zu fahren. Seltsamerweise waren die Straßen fast leer, sonst wäre der Tercel vielleicht mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Oder sie selbst; oder ein Streifenwagen hätte sie stoppen können.
Aber es war eine träge Nacht im Big Easy – alle waren nach der Arbeit nach Hause gegangen und offenbar auch dort geblieben.
Sie glaubte, sich an einen Satz zu erinnern: »Wenn jemand mir folgt, werde ich ihn abknallen, das schwöre ich.«
Aber sie war nicht sicher. Zunächst hatte sie die Worte nicht verstanden. Sie hatte überhaupt nichts verstanden. Ihr Verstand hatte sich verabschiedet. Reed war einfach auf Autopilot.
Ihre Füße hatten noch funktioniert. So einfach war das.
Sie war ihnen hinterhergerannt, hatte gesehen, wie Sally grob in den Tercel geworfen wurde, als wäre so etwas wie ein Autositz noch nicht erfunden, und war zu spät gekommen. Die Autotür war bereits verriegelt gewesen.
Vor Reeds geistigem Auge flackerten Szenen auf wie in einem Alptraum. Sie sah sich selbst, wie es in Wirklichkeit überhaupt nicht möglich war, wie sie aus der Tür stürzte, beinahe die Treppe hinunterfiel und innehielt, um das Gleichgewicht zu bewahren, kostbare Millisekunden verlor, dann an der Autotür zerrte, durchs Fenster sah, wie Sallys kleiner blonder Kopf gegen die Tür auf der anderen Seite prallte; sie rief ihren Namen – Sally! –, dann hörte sie den Motor des Tercel anspringen. Der Schlüssel hatte noch gesteckt, der Wagen war fluchtbereit gewesen.
Reed hatte ihren eigenen Ersatzschlüssel erst unter dem rechten Kotflügel hervorfingern müssen, eine weitere folgenschwere Verzögerung. Dann begann die Verfolgungsjagd, Reed immer noch auf Autopilot, sie tat nur, was sie tun mußte, um ihr Kind zurückzubekommen. Sie achtete überhaupt nicht darauf, wohin sie fuhr, welche Stadtviertel sie durchquerte, wo sie auf die Schnellstraße einbog – sie fuhr einfach, und jetzt hatten diese Rückblenden begonnen, vielleicht ein erstes Anzeichen dafür, daß sie wieder zu Verstand kam.
War das wirklich Reed Hebert, die hier am Steuer saß? Was machte sie hier eigentlich?
Sie sollte anhalten und die Polizei rufen, aber sie wußte auch, daß sie es nicht tun würde. Wahrscheinlich würde sie keine Telefonzelle finden. Und wenn, dann war der Notruf vielleicht besetzt. Sie würde den Tercel verlieren.
Was, wenn sie im Haus ihrer Eltern geblieben wäre und die Polizei von dort aus angerufen hätte? Das wäre das einzig Vernünftige gewesen, aber daran hatte sie nicht gedacht, sie hatte zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gedacht, sondern war einfach Impulsen gefolgt. Aber jetzt fiel ihr ein, daß sie dann nichts über das Auto gewußt hätte, nicht seine Farbe, das Modell, die Nummer, und all das wußte sie jetzt.
Also tue ich doch das Richtige.
Sie glaubte es weder, noch zweifelte sie daran. Es war einfach ein Gedanke, während sie fuhr.
Jetzt merkte sie, daß sie in der Nähe des Bayou St. John waren.
Da stimmt doch was nicht. Was zum Teufel machen wir hier?
Ihr wurde klar, daß sie geglaubt hatte, den Grund für die Entführung zu kennen, aber ein Viertel wie dieses hier wäre ihr dabei nicht in den Sinn gekommen. Bürgerlich. Der vornehme, neue Teil, etwa zwei Querstraßen von den Beinahe-Slums entfernt.
Der Tercel hielt vor einem riesigen Haus, einem absurd großen Haus, so groß wie diejenigen an der St. Charles Avenue, aus grauem Stein und umgeben von einem soliden schmiedeeisernen Zaun. Eine Gruppe von Männern kam gerade heraus auf den Bürgersteig.
Sally wurde aus dem Wagen gezerrt und zum Tor geschleppt. Sie schrie laut: »Mommy! Mommy! Mommy!«
Reed hatte nicht vor, durch ein Parkmanöver Zeit zu verlieren. Sie ließ den Wagen einfach auf der Straße stehen. Als sie herausstürzte, fand sie sich einem der Männer aus der kleinen Gruppe gegenüber, die sich dem schreienden Kind zugewandt hatte.
Es war Bruce Smallwood, den sie von den Anhörungen vor dem Kasino-Komitee her kannte. Neben ihm stand Lafayette Goodyear, ein weiteres Komiteemitglied, und sie glaubte, in dem dritten Barron Piggott zu erkennen, einen Kollegen der beiden anderen, aber sie war nicht sicher.
Gott sei Dank.
Eine Sekunde lang schloß sie die Augen, vor Erleichterung oder wie in stummem Gebet. »Bruce! Lafayette! Hilfe!«
Keiner rührte sich.
Männer, mit denen sie am selben Tisch gesessen, die sie angelächelt hatte.
Barron hatte sogar versucht, ihr den Schenkel zu tätscheln, aber sie hatte es kommen sehen und die Beine übereinandergeschlagen.
Die ganze Gruppe kräftiger, aktiver, wohlangesehener Männer stand wie angewurzelt und sah ebenso verschreckt aus wie Reed.
Es blieb ihr überlassen, ihr Kind zu retten.
Sie wollte nach Sally greifen, wollte sie an sich reißen.
»Gib sie her, verdammt! Sally, Kleines, alles wird gut. Mommy ist hier. Alles wird wieder...« Das letzte Wort hätte ›gut‹ sein sollen, aber sie brachte es nicht mehr heraus, weil sie so außer Atem war. Und außerdem hatte sie nicht den Mut. Sie glaubte es selbst nicht. Anklagend sah sie die Männer an.
Einer hatte sich einen Schritt von der Gruppe entfernt, Lafayette, der einzige Schwarze, kam auf sie zu, hatte endlich den Arsch hochgekriegt.
Aber dann ging das Tor auf.
Erschrocken fuhr sie herum und sah, daß zwei Männer Sally mitsamt der Person, die sie entführt hatte, durchs Tor gezerrt hatten.
Dann zogen sie auch Reed hinterher.
Grady fuhr seine Mutter zum Haus von Reed und Dennis; Sugar saß ganz still, statt wie üblich ununterbrochen zu reden, und starrte geradeaus. Das war erstaunlich genug, aber als sie ohne ein Wort die Treppe hinaufging und sich in eines der Gästezimmer zurückzog, war er ernstlich erschrocken. Er folgte ihr mit ihrer hastig gepackten Reisetasche in der Hand, sah, wie sie den Fernseher einschaltete und sich aufs Bett legte, vollständig bekleidet, mit leerem Blick. Er hatte sie noch nie so erlebt, und der Schock veranlaßte ihn, ungewohnt beflissen zu reagieren.
»Mutter? Mutter, kann ich dir irgendwas bringen?« Er fand, daß seine Stimme merkwürdig unterwürfig klang.
Sugar gab keine Antwort.
Sie gehörte nicht zu den Leuten, die zu etwas überredet werden konnten. Sie wußte, was sie wollte, und das war immer dasselbe: soviel Aufmerksamkeit wie möglich. Sie würde weinen und die Fassung verlieren und immer wieder dieselbe Situation provozieren – andere würden zuhören, bis sie es nicht mehr aushalten konnten, sie würden sie anschreien, alles tun, um sie endlich loszuwerden, und dann würde Sugar wieder weinen und die Fassung verlieren. Sie lechzte nach menschlichem Kontakt wie ein Kind, das unter Wölfen aufgewachsen war, und im allgemeinen verlief dies für sie ebenso unerfreulich.
»Soll ich dir was zu trinken holen?«
»Ich brauche wirklich nichts.« Sie klang nicht sonderlich überzeugend.
»Wie wäre es mit Bailey’s Irish Cream?«
Das Zeug liebte sie, wahrscheinlich, weil es wie eine Süßspeise schmeckte.
»Also gut.« Sie klang, als erwiese sie ihm einen großen Gefallen.
Er lief nach unten, erleichtert, überhaupt etwas tun zu können.
Es gab keinen Bailey’s.
Als er wieder nach oben kam, bemerkte er, daß sie die Schuhe ausgezogen hatte, was er für ein gutes Zeichen hielt. »Mutter, ich muß raus und welchen kaufen. Kommst du einen Augenblick allein zurecht?«
Sie sah ihn an. »Ich glaube schon.«
Er mußte einfach raus. »Ich schalte die Alarmanlage ein. Mach dir keine Sorgen, hier kommt keiner rein.«
Er hatte vorgehabt, sofort zum House of Blues zu gehen, aber am Ende konnte er sich doch nicht dazu durchringen, sie allein zu lassen. Außerdem mußte er sie noch zurückfahren, um das Inventar ihres verdammten Hauses durchzusehen.
Er kaufte den Likör, und als er zurückkam, klingelte das Telefon: die Polizistin bat sie zurückzukommen. Er begleitete seine Mutter, fuhr sie wieder zurück und überraschte sich dann selbst durch die Art, wie er mit ihr sprach – so, wie man es von einem braven Sohn erwartete und wie er es sonst nie tat.
»Also, Mutter, ich will, daß du dich jetzt ausziehst und ins Bett legst, und in der Zeit gieße ich dir einen Drink ein. Tust du mir den Gefallen?«
Er glaubte, so etwas wie Überraschung in ihrem Blick zu erkennen, aber sie sagte kein Wort.
»Ich werde jetzt die Tür zumachen, damit du ein bißchen Ruhe hast. Wenn ich zurückkomme, trinken wir etwas miteinander. Legst du dich jetzt hin?«
Sie nickte.
Er ließ sich Zeit, die Flasche zu öffnen und Gläser zu suchen, damit Sugar seiner Bitte in Ruhe nachkommen konnte. Als er an die Tür klopfte, sagte sie: »Herein«, und nun lag sie tatsächlich unter der Decke. Sie hatte ihr Make-up noch nicht abgewischt, aber er wollte nicht kleinlich sein.
»Gut, Mama. Du brauchst jetzt Ruhe.« Er hatte sie nicht mehr ›Mama‹ genannt, seit er zwölf gewesen war.
Im Hintergrund lief der Fernseher, und Grady befürchtete plötzlich, sie könnten in den Nachrichten über den Tod seines Vaters berichten. »Komm, wir machen das aus, ja?«
Er goß einen Schluck ein und reichte ihr das Glas. Dann bediente er sich selbst und setzte sich auf den Hocker vor dem Frisiertisch. Er wußte nicht, was er sagen sollte. Normalerweise war sie diejenige, die redete – redete und redete und redete, sehr zum Mißfallen aller anderen. Seine Beziehung zu ihr bestand im allgemeinen darin, sie auf Distanz zu halten.
Schließlich sagte sie: »Glaubst du, daß sie ihn umgebracht hat?«
»Wer?«
»Reed.«
»Reed?« Er hätte nicht weniger entsetzt sein können, wenn sie Hillary Clinton gesagt hätte. »Wieso denn Reed?«
»Es war nicht recht, was er ihr angetan hat. Dieses Mädchen wollte immer nur eins: das Restaurant leiten – und es ihrem Daddy recht machen. Und er hat alles kaputtgemacht.«
Grady spürte ein Kribbeln. O Gott, ich bin schon wieder fällig für einen Abend im House of Blues.
Das House of Blues war ein Musikclub, der beste in New Orleans. Er war kunstvoll auf funky und schäbig getrimmt, voll mit einheimischer Kunst. Die Elektronik hatte vermutlich Millionen gekostet. Hier traten nur die besten Musiker auf.
Nichts spiegelte besser das Selbstverständnis dieser Stadt wider, und irgendwie war es exakt die Art von Club, die Grady selbst eingerichtet hätte – vorausgesetzt, er hätte über einen unbegrenzten Etat verfügen können. Grady ging mindestens dreimal die Woche hin; immer, wenn er sich deprimiert fühlte.
Aber als erstes hatte ihn der Name angezogen. Er hatte es immer enttäuschend gefunden, daß es gar kein House of the Rising Sun gab. Mit zwölf oder dreizehn hatte er lange Zeit über die zweite Zeile nachgedacht: »It’s been the ruin of many a poor boy and Lord, I know I’m one.«
Der Name House of Blues, die Melancholie, die er heraufbeschwor, traf ihn ähnlich, ließ ihn an das alte Lied denken. Aber der Name bewirkte noch etwas anderes, einem Messer ähnlich, das jemand in der Wunde noch einmal herumdreht, und das erregte ihn. Es inspirierte ihn, brachte ihn auf neue Ideen.
Er hatte eine Menge Artikel geschrieben, für Gambit und das New Orleans Magazine, und jetzt hatte er begonnen, Kurzgeschichten über Vampire zu verfassen. Wenn Anne Rice das konnte, wieso nicht auch Grady Hebert? Die Metapher – die Liebe, die verschlingt und tötet, das Blutsaugen, Aussaugen, Aussaugen, Aussaugen, bis nichts mehr übrig war – hatte ihn schon als Teenager fasziniert. Heute gab er vor, es nur noch als Metapher zu sehen.
Er fand, daß Untote zu dieser Stadt paßten, also hatte er es versucht.
Ein paar der Geschichten hatte er an Horrorzeitschriften verkauft, und es hatte ihm Spaß gemacht, es seinen Eltern zu erzählen, ihre Verwirrung zu beobachten. Sein Vater hatte ihn selbstverständlich lächerlich gemacht, wie er es immer tat; Sugar hatte versucht, nett zu sein, aber am Ende hatte sie ihren Widerwillen nicht verbergen können. Grady glaubte allmählich, ähnlich zu empfinden.
Er wollte etwas schreiben, das mehr mit der Wirklichkeit zu tun hatte.
Er hatte begonnen, sein eigenes Elternhaus, Sugars und Arthurs Zuhause, als House of Blues zu bezeichnen, als habe die Hebert-Dynastie einen eigenen Namen, wie das Haus der Atriden, das Haus Tudor, das Haus Hannover.
Und er hatte gewußt, er würde über die Sache schreiben müssen. Nicht, um es zu veröffentlichen, aber er würde es aufschreiben müssen.
Und danach würde es ihm gehen wie Clea im Alexandria Quartett, der Künstlerin, die erst wirklich gut malen konnte, nachdem sie ihre Hand verloren hatte.
Er würde einen künstlerischen Durchbruch erleben.
Er wußte, daß er über die Sache schreiben mußte; der Gedanke erregte ihn auf makabre Weise, aber er wußte auch, daß es ihm noch unmöglich war. Und so ging er Abend für Abend ins House of Blues, wo die Musik ihm durch den Körper strömte, ihn läuterte.
Sugar erzählte ihm, was Arthur mit Reed gemacht hatte, wie er ihr das Restaurant wieder abgenommen hatte.
Reeds Welt, ihr Leben, ihr Weltbild, hatten Grady immer schon zur Verzweiflung getrieben.
Was er nun erfahren hatte, brachte ihn fast zum Weinen.
Es berührte ihn, wie es der Tod seines Vaters nicht getan hatte, oder jedenfalls noch nicht – er wußte, auch das würde ihn schließlich treffen. Reeds Geschichte war eher nachzuvollziehen: diese Demütigung, dieser Schlag ins Gesicht.
Aber nein, er glaubte nicht, daß sie ihren Vater getötet hatte. Das wäre das letzte, was er gedacht hätte. Er sagte seiner Mutter, er glaube, es sei ein Krimineller gewesen – jemand, der sich Einlaß verschafft hatte.
»Aber warum?« fragte Sugar. »Im Haus fehlt doch nichts.«
Warum. Er hatte über das Warum nicht nachgedacht; auf seine Weise war er ebenso betäubt wie Sugar.
Damit die Täter die anderen entführen und Lösegeld verlangen konnten.
Aber das sprach er nicht aus.
Moment mal. Jemand hatte Reeds und Dennis’ Auto weggefahren.
»Sie hatten vielleicht vor, die Bude auszuräumen, aber Dad ist durchgedreht. Du weißt doch, wie er ist. Und dann haben sie Angst bekommen.«
»Ich glaube, jetzt kann ich schlafen«, sagte Sugar. »Wie er war, meinst du.«
Sie hatten fast die ganze Flasche geleert.
Er ließ sie allein und ging ins House of Blues. Es gefiel ihm, dazustehen und Bier aus einem Plastikbecher zu trinken, zu schwanken, die Musik zu spüren. Es war eine gute Art, den Kopf zu leeren, nicht mehr an das eigene Versagen zu denken; zu vergessen, wie sehr Nina ihm fehlte, nicht mehr an den Tod seines Vaters zu denken, an die eigenartige Ruhe seiner Mutter.
Buddy Guy spielte. Eigentlich hätte Grady ein Zombie sein müssen, ausgelöscht von Musik und Alkohol, aber sein Hirn funktionierte noch immer.
Jedenfalls hätte man es so nennen können. Waren das Gedanken, waren es Ahnungen oder undeutliche Gefühle?
Er hat nie bekommen, was er wollte.
Wenn es ein Gefühl war, dann war es Schuld.
Eigentlich hätte ich an Reeds Stelle sein sollen.
Das machte ihn wütend. Er spürte Hohn in sich aufsteigen, fühlte sich abgelenkt von Buddys magischen Riffs.
»Sei ein Mann.«
»Gracie... O Gracie« – im Singsangton – »trägst du etwa Spitzenhöschen?«
»Steh auf und tu deine Pflicht ...nein, du kannst es dir nicht aussuchen. Du bist ein Hebert...«
»Reed kann es besser als du. Willst du dich etwa von einem Mädchen übertreffen lassen?« An diesem Punkt knickte sein Vater immer das Handgelenk geziert ab und sprach im Falsett weiter: »Grady Hebert. Schriftsteller-Schwuchtel. Pardon – unveröffentlichte Schriftsteller-Schwuchtel. Etepetete. Vermutlich wird die kleine Reed deine Arbeit machen müssen.«
Grady hatte jeden Sommer als Kochgehilfe im Restaurant gearbeitet und jede einzelne Sekunde gehaßt. Er hatte seine Zeit mit Gemüsehacken verbracht, und die schweren Kochmesser hatten blaue Flecke an seinen Unterarmen hinterlassen. Er hatte Kartoffeln geschält, geputzt, gefegt und gewischt, er hatte geschält und entkernt, Brühen gekocht, Krabben gepult, bis seine Finger schrumplig wurden, er hatte Krebse geknackt, Fleisch geschnitten und gehackt und gelernt, vierzig Gallonen Gumbo auf einmal zu kochen.
Wieso war Küchenarbeit männlicher als Schreiben? Er wußte, sein Vater hatte nur versucht, ihn zu schikanieren. Aber das hatte seine Spuren hinterlassen.
Grady schwitzte, und das kam nicht nur von der Menschenmenge.
Warum habe ich keine angenehmen Erinnerungen an ihn?
Er bestellte sich noch ein Bier und versuchte es.
Er strengte sich wirklich an.
Eine weitere Erinnerung stieg auf: Sein Vater im Sessel, vor dem Fernseher, die Krawatte nicht einmal gelockert, mit dem gesamten Schweiß des Tages bedeckt, wie er bestenfalls grunzte, wenn die Kinder ihn ansprachen. »Er ist müde«, sagte Sugar dann. »Er ist im Moment einfach zu müde für euch.«
Aber wenn Grady sich neben die Armlehne von Arthurs Sessel auf den Boden setzte, strich sein Vater ihm früher oder später einmal durchs Haar, zauste es. Grady hatte Evie gebeten, ihm übers Haar zu streichen, und später Nina und andere Frauen.
Er spürte, wie er rot wurde; dieser Zusammenhang war ihm noch nie aufgefallen.
Aber es war doch angenehm, oder? Wenn er mir über den Kopf gestreichelt hat?
Er konnte sich erinnern, wie warm und stark sich die Hand seines Vaters angefühlt hatte. Ihm wurde ein wenig schwindlig davon, oder vielleicht kam das von dem Bier, nach dem ganzen Bailey’s.
Ob er mir wohl fehlen wird?
Und dann eine andere Vignette: Arthur im Restaurant, im dunklen Anzug, mit weißem Hemd und Krawatte, tadellos; er sah mit seinem weißen Haar so distinguiert aus wie Walker Percy – das Ideal eines Südstaaten-Gentleman.
Damals war der große Speisesaal Grady wie ein Palast vorgekommen: Die Prismen der Kronleuchter fingen das Licht ein und warfen es aufs Silber zurück, das perfekt auf dem weißen Leinen aufgereiht war.
Das dunkle Holz der Stühle, die kleinen Kacheln am Boden, der Faltenwurf der Vorhänge, die Smokings der Kellner – es war herrschaftlich, aber auch beruhigend, so warm, wie eine Daunendecke mit Satinbezug. Wenn seine Eltern ihn dorthin mitnahmen, fühlte er sich wie ein Prinz im Schloß seines Vaters.
Arthur war König.
Gewandt bewegte er sich durch den Speisesaal, grüßte jeden, setzte sich manchmal an einen Tisch, machte einen Witz, legte Männern die Hand auf die Schulter. Er war großartig, königlich. Grady war stolz, sein Sohn zu sein.
Später hatte all dies künstlich gewirkt, und er hatte von Getue gesprochen, mit der ganzen Verachtung eines Teenagers und nur ein einziges Mal. Sein Vater hatte ihn geschlagen.
Laß es bleiben, Grady, alter Junge. Geh weiter zurück, bis in die Zeit, als du zehn oder zwölf warst.
Er sah seinen Vater, wie er durch den Speisesaal glitt, alle lächelten ihn an, und wieder hatte er dieses merkwürdige Schwindelgefühl.
Das ist es, Grady, bleib dabei. Bleib dabei und sieh, ob du ein menschliches Gefühl entwickeln kannst. Du solltest traurig sein, weil dein Vater tot ist. Wenn du das nicht kannst, iß lieber nie wieder Knoblauch.
Er war betrunken genug, im Spiegel über der Bar nachzusehen, ob er noch ein Spiegelbild hatte.
Schon gut, es ist da. Du. Bist. Noch. Nicht. Untot.
Aber wenn du noch lebst, wieso empfindest du dann nichts?
Tust du doch. Gib es doch endlich zu. Dein Hals schnürt sich zu.
O Gott, er hatte nie eine Chance, ein Mensch zu sein. Er ist gestorben, ohne die geringste Ahnung zu haben.
Schließlich kamen die Tränen. Automatisch warf er einen Blick in den Spiegel, ob Gefahr bestand, daß es jemand merkte. Aber es war natürlich zu dunkel, und bevor er sich albern vorkommen konnte, wurde er abgelenkt.
Eine Blondine stand neben ihm, im schwarzen Kleid. Eine hinreißend hagere Frau mit hohlen Wangen, ein wenig abgehärmt.
Er drehte sich um. »Evie?«
Die Blonde lächelte. »Leslie.«
Er war überrascht, daß er laut gesprochen hatte. Eigentlich sah sie Evie nicht besonders ähnlich. Sie hatte braune Augen, die lebhaft glitzerten. Evies Augen waren blaugrün und ein wenig verwaschen.
Tragisch.
Als er sie zum letzten Mal gesehen hatte, war ihr Haar schmutzig und verfilzt gewesen. Sie hatte schmutzige Jeans und ein bauchfreies Top getragen, und man hatte sehen können, wie dünn sie war, ihren ausgemergelten, jämmerlichen Körper – ihre Rippen, ihre Schultern, zerbrechlich wie Fischgräten. Er hatte versucht, ihre Ellbogenbeugen nicht anzusehen, sich dann aber doch nicht beherrschen können, und schreckliche Blutergüsse entdeckt.
Das war vor fünf Jahren gewesen.