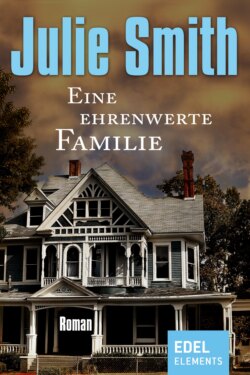Читать книгу Eine ehrenwerte Familie - Julie Smith - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеDennis’ Eltern wohnten in dem alten Viertel in der Nähe des Mercy-Krankenhauses, einer ehrbaren, aber nicht gerade prestigeträchtigen Gegend. Ihr Haus hätte zwar ein wenig frische Farbe vertragen können, war aber ansonsten ordentlich und beileibe kein Schandfleck. Es machte lediglich den Eindruck, als hätten die Besitzer den Anstrich ein Jahr zu lange aufgeschoben. Den Büschen im Garten sah man an, daß sie regelmäßig beschnitten wurden. Das Haus war im Bungalowstil gehalten, und spalierähnliche schmiedeeiserne Säulen stützten den Vorbau. Eine altmodische Fliegentür führte von der Veranda ins Haus. All das erinnerte Skip an kleine Häuser in verschlafenen Landstädtchen.
Als sie sich vorstellte, schnappte Mrs. Foucher nach Luft. »Er ist tot. Dennis ist tot, oder?«
»Oh, entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken. Wir haben noch nichts von ihm gehört. Ich bin nur hier, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Ich versuche, ihn zu finden.«
Mrs. Foucher hatte ein Papiertaschentuch in der Hand, das sie schon völlig zerknüllt hatte. Sie war übergewichtig, und ihr Gesicht wirkte, als würde sie selbst dann traurig aussehen, wenn kein Familienmitglied vermißt oder tot war. »Wirklich? Ich dachte, er wäre tot. Milton, ich dachte, er wäre tot.«
Ihr Mann sagte: »Schon gut, Josie. Es ist alles gut.« Er legte ihr einen Arm um die Schultern, wandte sich Skip zu und hielt die Fliegentür auf. »Treten Sie ein, meine Liebe. Erlauben Sie.«
Diese förmliche, altmodische Art zu reden klang fremd in Skips Ohren.
Es ist eine ganz normale weiße Familie, dachte sie. Aber die Stadt war voll solcher Familien – mit »weißen« und »schwarzen« Mitgliedern. Mrs. Foucher war hellhäutig, mit graugesträhntem braunem Haar, und ihr Mann war dunkelhaarig, ebenfalls ergrauend, und er hatte einen Schnurrbart.
Skip war überrascht, beide Fouchers an einem Wochentag zu Hause vorzufinden. Vielleicht waren sie arbeitslos oder doch einer von ihnen. Oder Dennis’ Vater war zu Hause geblieben, um auf Nachrichten von seinem Sohn zu warten. »Dürfen wir Ihnen einen Kaffee anbieten? Sie sind eine blaue Person«, sagte Milton. »Sie können verstehen, wie Josie zumute ist. Wir sind erfreut, daß Sie uns aufsuchen.«
Er verschluckte keine Silben, und seine Aussprache war so korrekt und überdeutlich, daß er, wäre er Prediger gewesen, auch ohne die Unterstützung eines Mikrofons jedes Ohr seiner andächtigen Gemeinde erreicht hätte. Skip fragte sich, ob er vielleicht Laienprediger war und gern übte – oder war er einfach verrückt?
»Eine blaue Person«, wiederholte sie. »Meinen Sie, weil ich Polizist bin?«
»Wohl kaum. Ich würde eine junge Dame nicht als ›Polizisten‹ bezeichnen. Genauigkeit ist meine Leidenschaft, und Fehler, die sich so leicht vermeiden lassen, unterlaufen mir nicht.«
Er und seine Frau hatten Skip in eine enge und trostlose Küche geführt, in der es immer noch nach dem Frühstück roch. Skip lehnte den Kaffee ab, aber sie setzte sich zu den beiden an den Tisch.
Josie schwieg. »Eine blaue Person«, sagte Milton, »ist eine Person voller Mitgefühl, jemand, der mit anderen fühlt, ein freundlicher Mensch, der helfen möchte. Josie gehört auch zu dieser Gruppe. Ich selbst bin eine grüne Person – ein Gelehrter, so etwas wie ein Einsiedler, ein Intellektueller, jemand, der das Lernen über alles liebt.«
Skip war gegen ihren Willen fasziniert. »Haben Sie dieses System selbst entwickelt?«
»Nein. Wir grünen Menschen sind zwar tatsächlich die kreativen – die Erfinder, die Wissenschaftler. Aber dies ist nicht die Frucht meiner eigenen Arbeit. Ich habe es auf einem Seminar gelernt. Ich nehme an jedem Seminar teil, dessen ich habhaft werden kann. Ich lese auch ununterbrochen. Aber selbstverständlich nur Sachbücher. Mich interessieren nur Fakten.« Hier hob er die Stimme, als wäre er entweder zornig oder auf der Kanzel und bei der wichtigsten Schlußfolgerung angelangt. »Nur Fakten!« tobte er und lief rot an.
Dann senkte er die Stimme wieder. »Was nicht mit Fakten zu tun hat, interessiert mich nicht. Aus diesem Grund sehe ich auch nicht fern.«
»Gibt es noch andere Farben?«
»Selbstverständlich. Ohne goldene Menschen könnte die Welt nicht überleben. Das sind die Aktiven, diejenigen, die alles bewegen.«
»Aha. Welcher Typ ist Dennis?«
Miltons Gesicht nahm einen merkwürdigen Ausdruck an. Skip hätte schwören können, daß er verwirrt aussah, aber Milton gehörte offenbar nicht zu den Leuten, die sich durcheinanderbringen ließen. Er erholte sich schnell.
»Er ist nicht intelligent genug, eine grüne Person zu sein. Ich würde sagen, er ist eine blaue Person, aber er hört nicht zu. Kein System ist vollkommen.«
Skip wandte sich Josie zu und lächelte. »Haben Sie seit gestern von ihm gehört?«
»Natürlich nicht«, warf Milton ein. »Sonst hätten wir es bereits erwähnt. Dennis war immer ungehorsam. Er war ein notorischer Schulschwänzer, trieb sich mit fragwürdigen Individuen herum und rauchte Marihuana. Ich war gezwungen, ihm mindestens dreimal in der Woche Prügel zu verabreichen. Oft genug hat er sich die ganze Nacht mit seinen zweifelhaften Freunden herumgetrieben.«
»Wir haben uns solche Sorgen gemacht«, fügte Dennis’ Mutter hinzu. »Dabei ist er ein kluger Junge. Er war zwei Jahre an der Universität, wußten Sie das? Aber dann ist er verschwunden und eine ganze Weile nicht heimgekommen.«
»Auf irgendeine Art hat er dann Miss Reed Hebert kennengelernt. Weder Josie noch ich haben die geringste Ahnung, wie ihm das gelungen ist. Sie hat ihn zivilisiert, wie es niemandem zuvor gelungen war. Wir haben erlebt, wie sie ihn in einen vollkommen anderen Menschen verwandelte. Im Augenblick stirbt ein sehr guter Freund von ihm an Aids, ein Junge aus der Nachbarschaft, zwei Straßen weiter. Aus diesem Viertel. Aids.
Dieser junge Mann ist ebenso männlich wie ich. Er hat sich durch den Gebrauch von Spritzen angesteckt. So ist das. In dieser Nachbarschaft. Ich betone nochmals, der Junge ist kein Homosexueller – so etwas hätte auch Dennis passieren können. Und wenn er verschont blieb, dann ist das Reed Hebert zu verdanken.«
Er kniff die Lippen fest zusammen, und Skip war nicht sicher, ob nicht ein gewisses Bedauern in seiner Stimme gelegen hatte. Er hatte Dennis vermutlich ein solches Schicksal vorausgesagt und konnte es nicht leiden, sich geirrt zu haben.
»Zufällig habe ich gerade mit Mrs. Sugar Hebert gesprochen, als die Entführung passierte. Ich wollte Dennis anrufen, um ihm von seinem Freund Justin zu erzählen – das ist der kranke Junge –, und Mrs. Hebert war ans Telefon gegangen.«
»Welche Entführung, Mr. Foucher? Was meinen Sie damit?«
»Das ist es doch, was passiert ist. Sicher hat die Polizei es auch bereits herausgefunden. Wir werden bald eine Lösegeldforderung erhalten – genauer gesagt, Mrs. Hebert wird sie bekommen. Von den Fouchers können diese Leute keinen Cent erwarten.« Er klang selbstzufrieden.
»Dieser Freund – Justin. Würden Sie mir bitte seine Adresse geben?«
»Sie möchten Justin besuchen? Warum, um alles in der Welt?«
»Ich möchte mit Justin und mit anderen alten Freunden von Dennis sprechen.«
Beide Fouchers sahen jetzt erbost aus – vielleicht waren sie verärgert, daß Skip noch mit anderen sprechen wollte, nachdem sie bereits der Welt größten Experten zum Thema Dennis Foucher, Drogensüchtiger, konsultiert hatte.
»Wir sind froh, der Polizei mit allem dienen zu können, was wir wissen«, sagte Milton. »Wir wissen allerdings nichts über weitere Freunde von Dennis.«
Seine Wut war so heftig, so offen, daß es Skip schwerfiel, noch lange genug mit ihm im selben Raum zu bleiben, um sich Justin Arceneaux’ Adresse geben zu lassen.
Wenn ich bei diesen beiden aufgewachsen wäre, dachte sie, hätte ich Drogen sicherlich auch sehr verlockend gefunden.
Sie stellte auch fest, daß sie ihr Bild von Reed revidiert hatte und jetzt einen gewissen Respekt empfand. Jungs aus solchen Familien heirateten eigentlich nie in Uptown-Familien ein.
Wie um alles in der Welt hatte Reed Dennis kennengelernt? Und vor allem, woher hatte sie den Mut genommen, ihn mit nach Hause zu bringen?
Sie mußte doch etwas von einer Rebellin in sich haben, dachte Skip, und das gefiel ihr. Aber dieser Wesenszug mußte tief vergraben sein; es paßte ganz bestimmt nicht zu all dem, was sie über Reed gehört hatte.
Als sie sich verabschiedete, sagte sie: »Darf ich Sie noch etwas fragen? Kennen Sie Nina Philips?«
Milton Foucher wurde rot. »Ich glaube nicht.«
»Sie arbeitet im Restaurant. Sie sagt, Sie seien mit ihr verwandt.«
»Das hat ihr Dennis wahrscheinlich erzählt. Ich fürchte, der Junge hat kein Verhältnis zur Wahrheit. Wenn er jetzt hier wäre, würde ich ihn schon wieder auspeitschen müssen.«
Skip warf Josie einen verstohlenen Blick zu. Ihr Gesicht sah so verbraucht aus wie das Papiertaschentuch, das sie in der Hand hatte.
Familie und Freunde von Justin Arceneaux hatten sich im Wohnzimmer versammelt, als wäre er schon gestorben. Auf dem Eßzimmertisch türmten sich die Speisen. Trauer hing in der Luft wie schwerer Nebel über einem Fluß.
Als Skip das Haus betrat, hätte sie sich am liebsten umgedreht und wäre wieder weggerannt oder hätte behauptet, sie sei die Avonberaterin – alles, um nicht erklären zu müssen, wieso sie wirklich hier war.
Wie kann ich sagen, ich bin Polizistin? Das ist im Augenblick das Letzte, was sie brauchen.
Sie hörte die Anspannung und Verlegenheit in ihrer Stimme. »Könnte ich vielleicht mit Justin sprechen?« hörte sie sich sagen, und sie schämte sich ihrer Arroganz. Wie konnte sie, eine Fremde, seine vielleicht letzten Minuten beanspruchen?
»Er ist sehr, sehr krank«, sagte seine Mutter. »Wir erwarten jeden Moment...« Sie beendete den Satz nicht, sondern schluchzte laut.
»Ich würde nicht darum bitten, wenn es nicht ausgesprochen wichtig wäre. Es geht um Dennis Foucher.«
»Dennis?« Verwundert sah sie sich um. »Dennis ist nicht hier.«
Wahrscheinlich hatten sie keine Zeitung gelesen und den Fernseher nicht eingeschaltet.
»Er ist verschwunden. Zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter.«
»Dennis? Aber Justin hat ihn seit Jahren nicht mehr gesehen.« Sie sah so verwirrt und verzweifelt aus, als hätte Skip ihren Sohn auf dem Totenbett eines Verbrechens bezichtigt. Des Verrats vielleicht oder mehrfachen Mordes.
»Es tut mir sehr leid, Sie jetzt stören zu müssen.« Sie hatte das schon einmal gesagt, aber sie nahm an, daß Mrs. Arceneaux im Augenblick nur bruchstückhaft hörte. »Könnten Sie Justin vielleicht fragen, ob er mit mir sprechen möchte?«
Skip hoffte, daß er nicht schlief. Sie wollte nicht, daß seine Mutter ihn weckte.
Als Mrs. Arceneaux zurückkam, sah sie aus, als würden die Falten in ihrem Gesicht von unsichtbaren Gewichten nach unten gezogen. »Er sagt, er würde gern mit Ihnen sprechen. Aber er ist sehr, sehr krank – es ist jetzt das zweite Mal, daß wir glaubten, er würde den nächsten Morgen nicht mehr erleben. Aidskranke gehen sehr, sehr langsam von uns – man weiß es wirklich nie –, aber er ist immer noch vollkommen klar.« Sie nickte. »Vollkommen klar. Er kann sprechen, wenn er nur... wissen Sie, er hat fast keine Kraft mehr.«
Skip ließ sich ins Schlafzimmer führen und hatte dabei das Gefühl, ihrem eigenen Tod entgegenzugehen. Vor der Tür sagte Mrs. Arceneaux: »Erschrecken Sie nicht. Er wiegt nur noch vierundachtzig Pfund.«
Der Vorhang der Trauer, der Nebel, hatte sich wie ein dichtes Netz über Skip gesenkt, und sie konnte ihm nicht entkommen.
Das erste, was sie sah, war das Gestänge, das Justins Infusionen hielt, und dann die Menschen im Zimmer. Eine junge Frau, die am Bett saß, aufrecht, mit wachsamem Blick. Ihr Haar war weißblond, kurz und wellig, ihr Gesicht schmal und hager, aber Skip sah, daß dies von der Anstrengung kam. Sie sah außergewöhnlich aus, diese junge Frau; selbst in dieser Stadt der schönen Frauen hätten sich viele nach ihr umgedreht. Aber sie war starr und müde, und unter der äußeren Ruhe beinahe panisch vor Anstrengung, sich zusammenzunehmen.
Neben ihr, auf dem Boden, lag ein kleines Mädchen, ebenfalls blond; ihr Kleid war hochgerutscht, so daß man das Höschen sehen konnte; sie hatte eine Hand ausgestreckt und streichelte einen Spielzeugdinosaurier, sah ihn aber nicht an. Statt dessen warf sie Skip einen uninteressierten Blick zu. Sie war offensichtlich fast zu Tode gelangweilt, nachdem sie Stunden, vielleicht auch Tage hier verbracht hatte.
Und dann Justin selbst. Später konnte sich Skip kaum mehr an Einzelheiten erinnern, nur daran, daß sein Haar die Farbe von Sand gehabt hatte, seine Haut Sommersprossen, und daß seine Augen in dem eingefallenen Gesicht wie Löcher ausgesehen hatten. Trotz der Vorwarnung war sie beinahe sprachlos vor Entsetzen über die ausgemergelte Gestalt. Er trug keine Schlafanzugjacke, so daß Skip seine papierdünne Haut sehen konnte, Haut wie Plastikfolie, gespannt über einen Rahmen, der zu klein für einen erwachsenen Mann schien.
»Hallo«, flüsterte er. »Das ist Janine, meine Frau. Und meine Tochter.«
Skip nahm an, er habe auch den Namen der Tochter noch sagen wollen, dann aber beschlossen, sich die Anstrengung zu ersparen. Er verzog das Gesicht, als bereite ihm das Sprechen Schmerzen, aber Janine sagte: »Es ist das Laken. Es tut ihm manchmal an den Schultern und den Füßen weh. Er ist überempfindlich, weil die Nerven absterben.«
»Ich weiß, was es ist«, warf das kleine Mädchen ein. »Es heißt Neuropathie.« Skip fand, das Kind sei viel zu jung, um so etwas zu wissen.
Janine stand auf und wischte Justins Mund mit etwas, das wie ein großer Q-Tip aussah. Sie steckte ihm ein Stück Eis zwischen die Lippen.
Skip trat einen Schritt näher, wollte nicht in seine Sphäre eindringen, aber sie war nicht sicher, ob er sie aus größerer Entfernung verstehen konnte. Wieder sagte sie, es tue ihr leid, ihn stören zu müssen, und sie erzählte ihm, daß Dennis verschwunden war. Diesmal erwähnte sie Reed und Sally nicht; das kam ihr zu grausam vor.
»Dennis«, sagte Justin. »Er war immer ein Nadelfreak. Wir haben unsere Spritzen geteilt. Aber er ist davongekommen.« Die Worte fielen langsam, eines nach dem anderen, schmerzhaft. Seine Lippen sahen aus, als hätte er Wochen in der Sahara verbracht – das waren keine normalen Risse, sondern etwas viel Schlimmeres. Wenn er sprach, konnte Skip sehen, daß sein Mund innen totenblaß war, die Zunge und alles, als hätte er kein Blut mehr.
Skip wartete einen Augenblick. »Gibt es einen Freund, an den er sich wenden würde, wenn er in ernsthaften Schwierigkeiten steckte?«
»Mich. Mich, Mann.«
»Ist er hiergewesen? Hat er angerufen?« Es hörte sich lächerlich an, aber sie mußte fragen.
»Weiß ich nicht«, flüsterte er.
Janine wandte Skip die geschwollenen, blutunterlaufenen
Augen zu und schüttelte den Kopf.
»Wenn er Probleme hat, wird er zu Delavon gehen.«
»Delavon?«
»Sein Dealer.«
»Wollen Sie sagen, daß Delavon ein Freund ist – oder wird er nur was kaufen wollen?«
»Um sich zu ruinieren.«
»Er ist lange Zeit clean gewesen.«
Justin schüttelte den Kopf, oder genauer gesagt, er drehte ihn ein- oder zweimal auf dem Kissen hin und her. »Diesen Dennis kenne ich nicht. Nur den anderen. Er braucht die Wärme, den Kokon.«
»Was meinen Sie?«
»Dope.«
»Welcher Art?«
»Nur eine Sorte. Er konnte Koks nicht ausstehen, er mochte nicht, daß man davon so aufgedreht wird.«
»Heroin?«
Justin schwieg, als habe die Frage keine Antwort verdient.
»Wo kann ich Delavon finden?«
»Treme. Kein Nachname. Ich kenne Dennis. Er wird auch zu Kurt’s gehen.« Die Worte kamen stockend, jedes kostete Anstrengung.
»Wer ist Kurt?«
»Kein Typ. Eine Bar.«
»Können Sie mir sagen, wo?« Sie kam sich wie ein Inquisitor vor.
»Dumaine. Nähe Rampart.«
»Danke. Noch etwas?«
Justin schloß die Augen, bewegte wieder den Kopf.
»Ich danke Ihnen«, sagte Skip, und dann wiederholte sie es, diesmal im Flüsterton. Janine sah sie an, ohne eine Miene zu verziehen. Das kleine Mädchen hatte sich auf den Bauch gedreht. Skip fragte sich, ob die Frau und das Kind den Virus ebenfalls hatten.
Selbst draußen, in ihrem Auto, konnte sie dem Nebel der Trauer nicht entkommen.
Sie fuhr wieder zum Revier, um mit ihrer Vorgesetzten, Sylvia Cappello, über den Fall zu reden. Als Skip hereinkam, warf Sylvia gerade eine Akte auf den Tisch. »Scheiße!«
Sie sah einem Officer nach, der eben das Zimmer verließ. Maurice Gresham.
»Was ist denn?«
»Verdammt, es ist schon wieder ein Beweisstück verschwunden. Ich hab dermaßen die Schnauze voll von all diesen Kleinigkeiten, die passieren, wenn...« Sie hielt inne, starrte aber weiter Gresham hinterher, zeigte auf ihn.
»Was ist denn, Sylvia?«
»Hier passiert zuviel Mist, das ist alles. Wir stehen mit einem Haftbefehl vor der Tür, aber niemand ist zu Hause. Wir verlieren ein kleines Beweisstück, und dann stellt sich raus, daß jemand« – und wieder starrte sie dorthin, wo zuvor Gresham gestanden hatte – »es überprüft hat, und stell dir vor, sie haben es verloren.«
Cappello war wütender, als Skip sie je zuvor gesehen hatte. Was sie sagte, grenzte ans Unprofessionelle, und Cappello war sonst nie unprofessionell. Sie tat nie etwas Unüberlegtes, sie dachte nach, bevor sie den Mund aufmachte, aber eben jetzt machte sie einen ihrer Mitarbeiter vor einer Kollegin schlecht.
Skip wies mit dem Kinn auf den längst verschwundenen Gresham. »Glaubst du, er hat Dreck am Stecken?«
»Wer hat das nicht, in dieser verfluchten Stadt? Liest du keine Zeitung? Ist dir schon aufgefallen, daß sich jeden Tag irgendein Verwandter eines Politikers auf der Gehaltsliste irgendwelcher Kasinobetreiber wiederfindet? Alle lassen sich bestechen, alle haben kleine Betrügereien laufen, alle wollen ihr Schäfchen ins trockene bringen – und das interessiert längst keinen mehr. Du kannst gestern noch in einen Skandal verwickelt gewesen sein, der auf allen Titelseiten stand, und morgen schon in ein hohes Amt gewählt werden – oder sogar berufen, weil du Beziehungen hast.«
»Wieso läßt du ihn nicht einfach versetzen?« Sie vermied immer noch, Greshams Namen auszusprechen.
»Glaubst du denn, er wäre der erste? Oder der einzige? Was ist, wenn ich den loswerde? Es kommt ein anderer. Oder ein ganzer Schwarm davon, wie bei Küchenschaben. Skip, ich halte es einfach nicht mehr aus. Ich schwöre, ich schmeiße alles hin.«
Skip setzte sich. Sie hatte das Gefühl, jemand hätte ihr den Boden unter den Füßen weggezogen. »Hinschmeißen? Du meinst kündigen?«
»Ich meine kündigen und aus der Stadt wegziehen und wahrscheinlich sogar aus diesem Bundesstaat.« Sie überlegte einen Moment. »Vielleicht werde ich Jura studieren.«
Skip war sprachlos.
»Weißt du, was dieses Kasino bedeutet? Es bedeutet, daß sieben Milliarden Dollar bereitstehen. Ich sagte Milliarden. In Form von Konzessionen und Restaurants und Arbeitsstellen und Parkplätzen und all den anderen Stücken vom großen Kuchen. Du hast vielleicht geglaubt, diese Stadt wäre schon korrupt, aber das waren nur Vorübungen für die Betrügereien, die jetzt losgehen. Ich möchte nicht, daß meine Kinder an einem solchen Ort aufwachsen.«
Skip verstand, was ihre Vorgesetzte meinte. Sie wußte, daß Gresham korrupt war. Es gab nichts, was Cappello hätte beweisen können, und sie konnte nichts dagegen tun, außer ihn von bestimmten Fällen fernhalten.
Aber da sie nicht wußte, in wessen Sold er stand und welche Fälle mit den Leuten zu tun hatten, die ihn bezahlten, war auch das schwierig.
Und dann war da noch das Problem, daß Gresham ohne Schwierigkeiten Dinge aufschnappen und bestimmten Leuten Tips geben konnte.
Sylvia Cappello konnte nichts dagegen tun, und Gresham war nur ein Symptom. Der Dreck, die Käuflichkeit, die Betrügereien konnten einen zermürben; sie zermürbten alle, die bei der Stadt angestellt waren und versuchten, gute Arbeit zu leisten, und besonders hart traf es die Polizisten.
»Ach, verdammt, du hast recht«, sagte Cappello. »Ich lasse ihn versetzen.«
Skip überprüfte ›Delavon‹ – als Vor- und Nachnamen –, ohne Erfolg. Da es fast Mittagszeit war, hatte sie wenig Hoffnung, als sie beim Drogendezernat anrief, aber ihr alter Freund Lefty O’Meara ging an den Apparat, den Mund noch voll. »Lefty! Wenn ich gewußt hätte, daß du da bist, wäre ich rübergekommen.«
»Wenn du geglaubt hast, ich wäre nicht hier, wieso hast du dann angerufen?«
»Man darf eben die Hoffnung nie aufgeben. Kennst du jemanden, der Delavon heißt?«
»Nein. Wer soll das denn sein?«
»Ein großer Dealer. Wahrscheinlich Heroin.«
»Davon gibt’s hier nicht viel.«
»Ich habe gehört, Delavon hätte einiges.«
»Glaub mir, es gibt keinen Delavon.«
Sie glaubte ihm, es war nur so, daß O’Meara Delavon wahrscheinlich unter einem Namen wie George Bourdreaux oder ›Tiny‹ kannte – ohne Nachnamen.
Sie saß an ihrem Schreibtisch und starrte das Telefon an. Sie mußte mit jemandem reden, aber nicht mit Sylvia – nicht jetzt –, sondern mit jemandem, der sie nicht deprimieren würde.
Sie rief ihre Freundin Cindy Lou an und hoffte, sich mit ihr zum Essen verabreden zu können. Aber niemand ging ans Telefon.
Sie rief Steve an, damit der sie ein wenig aufheiterte – aber sie hörte nur ihren eigenen Anrufbeantworter.
Sie rief ihren Vermieter und besten Freund Jimmy Dee Scroggin an, aber seine Sekretärin sagte, er sei am Gericht.
Desorientiert, beinahe schwindlig, stand sie auf, holte sich ein Sandwich, das sie aß, ohne etwas zu schmecken, und dachte daran, wie sich Justin Arceneaux’ Knochen unter der Haut abgezeichnet hatten.