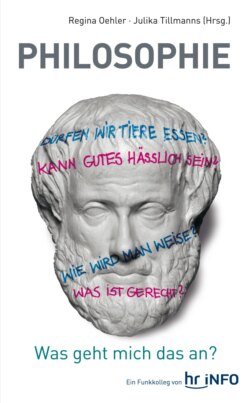Читать книгу Philosophie - Was geht mich das an? - Julika Tillmanns - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление04 GIBT ES WIRKLICH KEINE ALTERNATIVEN ZUR DEMOKRATIE?
Von Mario Scalla
Die Demokratie zählt zu den größten Errungenschaften der menschlichen Zivilisation. Neben dem Faustkeil des Homo sapiens, dem Rad und der Dampfmaschine zählt die demokratische Staatsform zu einem der wichtigsten kulturellen Güter, die je entwickelt wurden. Doch im Gegensatz zum Rad und der Dampfmaschine funktioniert sie nicht immer wie geschmiert, ist vielmehr ausgesprochen fehleranfällig. Wäre die Demokratie im neuen Jahrtausend ein Patient, läge sie auf der Intensivstation und wäre von einer Menge von Medizinern umgeben, die alle hektisch diskutieren, was unternommen werden muss.
Diese Situation ist nicht neu. Seit Menschen darüber nachdenken, welche Staatsformen ein gutes Zusammenleben der Menschen fördern oder unterbinden, steht die Demokratie im Zentrum kontroverser Debatten. Das Verhältnis von Demos, dem Volk, und Kratos, der Herrschaft, erschien nie unproblematisch, der Krisengedanke war der Demokratie selten fern, nur gegenwärtig scheint ein akuter Notstand ausgebrochen. Der deutsche Philosoph Jürgen Habermas spricht von einer „Fassadendemokratie“, der englische Politologe Colin Crouch von einer „Postdemokratie“, Bücher zur Krise der Demokratie füllen die Regale in den Buchläden, und als Kanzlerin Merkel von einer „marktgerechten Demokratie“ sprach, schien nun auch regierungsoffiziell bestätigt zu sein, dass der Markt wichtiger ist als ‚demos‘, das Volk.
Vor allem der Begriff der Postdemokratie befeuerte die Diskussionen, impliziert er doch das weit verbreitete Gefühl, dass die Ära der westlichen Nachkriegsdemokratien zu einem Ende gekommen ist, dass diese Gesellschaften sich in etwas verwandeln, das noch keine klare Gestalt und keinen Namen trägt. Colin Crouch, Erfinder des Begriffs: „Die demokratischen Institutionen sind geblieben, aber die demokratische Energie ist in andere Sphären gewandert. Wir müssen hier über die Macht der großen internationalen Konzerne reden. Diese demokratische Energie ist heute eher in dem geheimen privaten Diskurs zwischen diesen Konzernen und den Regierungen zu finden als in den alten demokratischen Institutionen.“
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich in Europa eine westliche Demokratie etabliert, die langfristig stabil erschien. Nach dem Wiederaufbau in den 50er Jahren und dem Marsch der rebellischen Generation durch die Institutionen in den 60er Jahren herrschte das allgemeine Gefühl: Demokratie ist das, was einfach da ist, so selbstverständlich wie der morgendliche Postbote. Regierung und Opposition wechselten wie schönes und wie schlechtes Wetter, und alles spielte sich mehr oder weniger in einer saturierten Mitte ab. Willy Brandt aber versprach: „Wir wollen mehr Demokratie wagen.“
Diese Aufbruchsstimmung verpuffte nach wenigen Jahren. Spätestens seit der Jahrtausendwende geht die Angst um, dass durch die Globalisierung und die Euro- und Finanzkrise demokratische Verfahren abgebaut werden und eine Expertokratie herrscht, die gar keine Beteiligung der Bürger mehr wünscht. Die Wahlbeteiligung geht in Deutschland und Europa stetig zurück, immer weniger Menschen engagieren sich in Parteien oder Verbänden.
Demokratie ist nicht mehr selbstverständlich – und so gedeihen Diskussionen darüber, was ihr eigentlicher Kern ist, warum das Volk mal mehr, mal weniger herrscht, und vor allem, was gegen die grassierende Entdemokratisierung unternommen werden könnte.
Was also ist Demokratie? Die Antwort fällt schwer. Volksherrschaft lautet die wörtliche Übersetzung. Aber wer ist das Volk? Alle? Oder nur die Volljährigen? Oder die Experten, oder vielleicht besser die Menschen mit der richtigen Moralvorstellung? Und wie sollen sie herrschen?
In der griechischen Antike wurde unter den Philosophen bereits gerätselt, was den Kern der Demokratie ausmacht. Aristoteles schrieb: „Der Punkt, in dem sich Demokratie und Oligarchie voneinander unterscheiden, ist Armut und Reichtum.“
Allerdings ist diese bemerkenswerte Aussage des Philosophen nicht so zu verstehen, dass auch die Armen regieren sollten und der Demos das ganze Volk umfassen müsse. Die Vorstellung der Agora, des antiken Marktplatzes von Athen, auf dem alle Bürger der Stadt zusammen kommen, gesittet ihre Probleme beraten und endlich etwas beschließen, das gut für alle ist und den Gemeinwillen ausdrückt, hat zwar bis heute nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Sie drückt ein demokratisches Ideal aus. Aber sie beruht auf einem Missverständnis. Christoph Menke, Professor für Philosoph an der Goethe-Universität Frankfurt: „Es geht nicht einfach um die Selbstregierung des Volkes. Der Begriff der Tugend, der tugendhaften Selbstregierung ist entscheidend in der antiken Philosophie. Nicht alle haben diese Fähigkeit der Tugend, sie ist in der Polis unterschiedlich verteilt. Deshalb sagt Aristoteles: Es sollen diejenigen regieren, die mehr Tugend haben als andere.“
Und das sind die Aristokraten. Die antiken Philosophen hatten eine gehörige Portion Skepsis gegenüber einer Herrschaft des ganzen Volkes, selbst der aller männlichen freien Bürger. Schließlich könnte das weniger tugendhafte gemeine Volk von Demagogen verführt werden – eine schlechte Regierung wäre das wenig erfreuliche Ergebnis.
Doch Aristoteles‘ Verdienst besteht darin, drei Formen politischer Machtverteilung benannt zu haben, die bis heute anerkannt sind: Monarchie, Aristokratie und Politie. Letztere ist eine gemäßigte Form der Demokratie, eine, die Elemente aristokratischer Herrschaft enthält und die Regierung durch Tugendhafte ermöglicht. Demokratie hingegen ist nach Aristoteles eine Abirrung von dieser Staatsform, eine, in der sich der Pöbel und die Besitzlosen von demagogischen Aufrührern aufstacheln lassen und die tugendhaften Bürger entmachten. Die Agora-Fantasie des offenen Marktplatzes ist eine moderne Erfindung.
Dennoch hat die antike Philosophie das Nachdenken über eine gute Verfassung bis heute stark geprägt – auch weil sie eine weitere grundlegende Unterscheidung einführt: Die zwischen repräsentativer und direkter Demokratie, zwischen Institutionen wie ein Parlament, an das Macht delegiert wird, und direkten Formen der Mitsprache, nach denen sich die Bürger unmittelbar versammeln, beraten und sich selber regieren.
Vorstellungen von einer Agora oder einem römischen Forum, wo Viele sich versammeln und über wichtige Fragen ihrer Gemeinschaft beraten, sind feste Bestandteile philosophischen Nachdenkens über eine gute Staatsform. Allerdings waren nach dem Untergang der antiken Kulturen lange Jahrhunderte nötig, um diese Tradition wieder aufzunehmen. Im Mittelalter verstummten diese Diskussionen, um erst nach der Renaissance wieder aufzuflammen.
Für die „moderne“ Form der Demokratie ist ein Impuls entscheidend, den Christoph Menke auf die frühe Neuzeit datiert: „Die Frage ist: wer ist in der Lage zu urteilen? Der Philosoph, der die moderne Vorstellung von Demokratie entscheidend prägte, ist Descartes. Wir Modernen sagen seit Descartes: Jeder ist gleichermaßen befähigt zu urteilen. Eigentlich gibt es so etwas wie radikale Demokratie erst mit diesem Satz: Alle können gleichermaßen urteilen.“
Damit war allerdings noch nicht die Frage entschieden, ob die direkte oder die repräsentative Form der Demokratie den Vorzug erhalten soll. Demokratie betrifft die Frage, wie die Macht in einer Gesellschaft verteilt und wie sie ausgeübt werden soll. Seit der Zeit Descartes, seit dem frühen 17. Jahrhundert, war zwar die Überzeugung in der Welt, dass alle Menschen zur Mitsprache befähigt sind. Der Philosoph war überzeugt, dass alle Menschen fähig sind, zu denken und zu urteilen und setzte damit die aufklärerische Folgerung in die Welt, dass alle über sich selbst befinden können, sowohl in ihren persönlichen Angelegenheiten als auch in denen, die das Gemeinwesen betreffen. Revolutionäre Bewegungen sollten diesen revolutionären Gedanken in die Tat umsetzen.
Der Genfer Philosoph Jean Jacques Rousseau hat Descartes Gedanken radikalisiert. Der Begriff der Volkssouveränität geht auf ihn zurück. Wirkliche Demokratie, so schrieb der Genfer Bürger in seinem „Gesellschaftsvertrag“, kann nur auf direkte Weise praktiziert werden: „Ich sagte daher, dass die Souveränität, da sie nichts anderes ist als die Ausübung des Gemeinwillens, niemals veräußert werden kann, und dass der Souverän, der nichts anderes ist als ein kollektives Wesen, nur durch sich selbst dargestellt werden kann; die Macht kann wohl übertragen werden, nicht aber der Wille.“
Macht zu delegieren – an Repräsentanten in einem Rat oder einem Parlament – ist in dieser Theorie ein Verrat an der wahren Demokratie. Rousseaus Modell war sehr einflussreich und wird auch in den aktuellen Debatten über eine „Krise der Demokratie“ vielfach aufgegriffen. Frank Deppe, emeritierter Professor für Politikwissenschaft in Marburg und Autor des Buches „Autoritärer Kapitalismus. Demokratie auf dem Prüfstand“: „Das rousseaueanische Modell wurde von den Jakobinern in der Französischen Revolution und in radikalen Phasen der Geschichte, in denen es um Selbstorganisation ging, aufgegriffen. Hannah Arendt hat darauf hingewiesen, dass es in allen Revolutionen eine Rolle spielte. Zu verschiedenen Zeiten im 19. und 20. Jahrhundert hat es etwa Rätebewegungen gegeben und Selbstverwaltungsorgane wurden gebildet. Oft hatten sie andere Namen, aber im 19. Jahrhundert hießen sie Räte.“
Im Laufe der Geschichte verband sich die Idee der Volkssouveränität mit anderen Theorien, etwa mit Vorstellungen von Egalité, also sozialer Gleichheit oder Gerechtigkeit. Auch Kritiker der bürgerlichen, repräsentativen Form der Demokratie riefen häufig nach direkten Formen demokratischer Machtausübung. Frank Deppe: „Das ist eine andere Vorstellung von Demokratie. Eine direkte Demokratie bezieht sich sehr viel stärker auf die soziale Basis und impliziert auch die radikale Veränderung der Eigentumsordnung sowie die Aufhebung der Trennung von Exekutive und Legislative. Dieses Modell hat sich im 20. Jahrhundert in Teilaspekten durchgesetzt.“
Im 20. Jahrhundert wurde etwa die Idee der Wirtschaftsdemokratie geboren. Nun sollte Mitbestimmung auch in einen gesellschaftlichen Bereich eingeführt werden, der bislang noch diktatorisch, als Herrschaft eines Mannes über alle, verfasst war. Das deutsche Betriebsverfassungsgesetz regelte nach dem Zweiten Weltkrieg die Mitsprache der Arbeitnehmer innerhalb ihres Unternehmens. Auch andere Formen direkter Demokratie entstanden. Die kommunale Mitbestimmung in Städten, Stadtteilen oder Gemeinden ist ein Beispiel für die direkte Mitsprache der Bürger und Bürgerinnen in Angelegenheiten, die sie unmittelbar betreffen. Volksentscheide oder Bürgerbefragungen zu großen gesellschaftlichen Problemen sind ebenfalls Elemente einer direkten Demokratie. Aber dieses Modell hat Grenzen. Rousseaus Theorie von Volkssouveränität wurde vielfach kritisiert, weil sie nur für überschaubare kleine Einheiten tauge, – für eine kleine Stadt wie Genf etwa – und nicht für große politische Strukturen wie Nationalstaaten oder gar für globale Dimensionen. Im Grunde basieren moderne Demokratien auf einer Mischung direkter und repräsentativer Elemente – wobei letztere eindeutig dominieren.
Eine direkte Demokratie brach sich in der Geschichte immer dann Bahn, wenn Unterdrückung und Herrschaft unerträglich geworden waren und ‚das Volk‘ auf die Barrikaden ging. Revolutionen wie sie 1688 in England, 1789 in Frankreich, 1917 in Russland ausbrachen, sind Ausdruck direkter Demokratie. Sie bescherten einem feudalen monarchischen System die letzten Stunden. Direkte demokratische Aktionen müssen aber nicht immer und notwendig die ganze Gesellschaft umstürzen. Sie können konfrontativ sein, aber nur einen Teil des Systems betreffen, also auch innerhalb einer repräsentativen Demokratie wirken: Besetzungen von Häusern oder Fabriken, Blockaden, Demonstrationen, die verboten wurden, aber trotzdem stattfinden. Die Studenten der 68er Zeit scherten sich nicht um Verbote, genauso wenig wie die Spontis, die nach der Devise „legal, illegal, scheißegal“ ihren Protest nicht danach ausrichteten, was erlaubt oder verboten war. Bei ihnen ging es darum, die Grenzen des demokratischen Systems zu erweitern und in Bereichen mitzubestimmen, die der Partizipation entzogen waren. Die Anti-AKW-Bewegung der achtziger Jahre oder auch die Proteste gegen Konzernherrschaft und Finanzwirtschaft im beginnenden 21. Jahrhundert verfahren nach diesem Prinzip.
Die Blockaden der Castor-Transporte durch Anti-AKW-Aktivisten waren gesetzwidrig. Aber sie trugen zur öffentlichen Meinung bei und führten letztlich auch dazu, dass gesellschaftliche Mehrheiten sich änderten und die Kernkraft politisch verabschiedet wurde. Doch diese Formen haben Grenzen. Frank Deppe: „Es gibt durchaus auch andere Formen von Wirtschaftsdemokratie in fast allen europäischen Ländern. Das ist das Ergebnis von Kämpfen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch Kommunalverfassungen beruhen auf einer langen Tradition von Selbstverwaltungsorganen. Wir haben also Mischformen in der Verfassungsrealität – aber eine eindeutige Dominanz des repräsentativen Modells.“
So heißt es im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Paragraph 20: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ Aber danach ist sie dann woanders. Denn weiter lautet es: „Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.“
Im Westen setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg das repräsentativ-demokratische Modell durch. Es gilt so sehr als Erfolgsmodell, dass nach 1989 und dem Untergang des sowjetischen Imperiums das „Ende der Geschichte“ ausgerufen wurde. Die westlichen Demokratien in den USA und Europa wurden als Gipfel der historischen Entwicklung gefeiert.
Doch spätestens die Banken- und Eurokrise ließ den Triumph vergessen. Die Verfahren der Demokratie: Wahlen auf verschiedenen politischen Ebenen, Willensbildung durch Parteien und Verbände, funktionierten nicht mehr wie gewohnt. Die Demokratie geriet, wie es der Untertitel von Frank Deppes Buch sagt, „auf den Prüfstand“: „Die Theorie von der Demokratie als Verfahren – durch Wahlen oder eine politische Führung – findet sich vielerorts, etwa bei Max Weber und anderen, die über die Auswahl von politischen Führungsgruppen nachdenken. Im Hintergrund lauert oft ein normativer Kern. In einer Krise der Demokratie setzt sich dann der Gedanke durch, dass der Anspruch der Repräsentation in Kollision mit der Realität gerät. Sinkende politische Partizipation, Krise der Repräsentation und andere Erscheinungen sind die Anzeichen.“
Spätestens mit der Finanzkrise und diversen Banken-Crashs wurde deutlich, dass „Demokratie“ nur ein möglicher Name für dieses Gesellschaftssystem ist. Ein anderer lautet „Kapitalismus“. Der Philosoph Christoph Menke, der an der Goethe-Universität in Frankfurt ein Seminar über „Demokratie und Kapitalismus“ veranstaltet hat: „Kapitalismus und Demokratie sind nicht notwendig miteinander verbunden. Nicht, weil formale Regeln des Regierens abgeschafft würden. Aber seit der Finanzkrise ist die Frage, inwieweit es noch möglich ist, den Kapitalismus politisch zu steuern. Der Eindruck entsteht, und das meint ja auch der Begriff „Postdemokratie“, dass Demokratie nur mehr eine formelle Veranstaltung ist, und Sachfragen, die unser Leben bestimmen, nicht mehr zur Entscheidung stehen können.“
Formal besteht also „unsere“ hochgeschätzte und in aller Welt gepriesene Demokratie weiter. Gewählt wird dauernd. Aber die entscheidenden Fragen stehen nicht mehr zur Wahl. Das TINA-Wort von Margaret Thatcher – There is no Alternative – ist politische Realität geworden in einer Zeit, in der Opposition und Regierung sich zu einer informellen oder einen realen Großen Koalition verbinden und eine politische Alternative nicht mehr zur Wahl steht. Entpolitisierung und sinkende Wahlbeteiligung sind die Folgen. Die formalen Verfahren der Demokratie funktionieren nicht mehr. Die ökonomischen Eliten haben sich einen privilegierten Zugang zu den politischen Entscheidungsträgern geschaffen, ihre Lobbyarbeit hat reiche Früchte getragen.
Damit werden die Prozesse demokratischer Willensbildung von unten nach oben, von Parteibasis zur Spitze, von Parlament zu Regierung, ihrer Substanz beraubt. Christoph Menke: „Die Grundsatzfrage ist: wie kann eine immanente Tendenz des Kapitalismus gebrochen werden, die Ökonomie von allen normativen Fragen frei zu setzen? Den traditionellen ökonomischen Fragen nach gerechter Verteilung, einem guten Leben, der Schaffung von Sinnvollem und Nützlichem, verdankt der Kapitalismus seit dem 17. Jahrhundert seine rasante Karriere. Aber der Kapitalismus möchte nicht kontrolliert, sondern von jeder politischen Kontrolle freigesetzt werden. Die Frage ist also, ob es einen politischen Rückgewinn der Regulierung ökonomischer Bereiche geben kann. Daran hängt das allein und vollkommen.“
Demokratische und ökonomische Entwicklungen sind nicht synchron verlaufen. Die Ökonomie konnte sich leicht globalisieren, die Demokratie nicht. Konzerne und Banken können die neuen Technologien leicht für ihre Zwecke nutzen, um sich international zu vernetzen und zu organisieren. Für Nationen mit ihren parlamentarischen Apparaten und Prozeduren ist das ungleich schwerer. Eine ökonomische Globalisierung existiert; eine demokratische allenfalls in zarten Ansätzen. Colin Crouch, Erfinder des Begriffs „Postdemokratie“: „Für die Demokratie ist es äußerst schwierig, auf höheren Ebenen als denen des Nationalstaats zu funktionieren. Als eine Konsequenz findet die politische Elite sich selbst zunehmend losgelöst von ihren Wählern und verkehrt mit ihnen nur noch auf sehr künstliche Weise. Sie spricht mit ihren Wählern wie ein Betrieb, der irgendwelche Produkte verkauft. Sie verkehren mit ihnen nicht mehr wie mit Wählern, sondern wie mit Kunden einer politischen Serviceleistung.“
Das verträgt sich allerdings nicht mit Ideal und Praxis einer Demokratie. Begriffe wie Re-Feudalisierung oder Elitenherrschaft illustrieren, wie weit sich die Staaten Europas oder der USA von ihren demokratischen Prinzipien verabschiedet haben. Ein Wort Walter Ulbrichts könnte als Motto aktueller Politik dienen: „Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.“
„Wir sind die 99 Prozent“ skandierten dagegen etwa die Aktivsten von „Occupy“. Die Mehrheit der Bevölkerung, so ihre Botschaft, ist von den großen politischen Entscheidungen ausgeschlossen. In Geheimoperationen wurden Hunderte Milliarden Euro und Dollar zur Bankenrettung ausgegeben. Gleichzeitig schrumpft der Sozialetat, und alle großen Parteien erklären diese Politik für „alternativlos“. Doch wie soll eine Mitsprache der 99 Prozent durchgesetzt werden? Auch die Philosophen sind sich uneins. Christoph Menke: „Gerade in jüngerer Zeit gab es, was es lange nicht gab, eine starke Theorie der radikalen Demokratie. Diese Theoretiker denken Demokratie von der Bewegung der Demokratisierung her. Jede Herrschaftsordnung enthält elitäre ausschließende Elemente, eine Hierarchie. Demokratie wird als immer wieder zu aktivierendes Ideal der Demokratiesierung verstanden.“
Der Schwerpunkt wird also jetzt auf den Prozess der Demokratisierung gelegt. Die Theoretiker der radikalen Demokratie berufen sich darauf, dass Demonstrationen nicht mehr national geplant werden, sondern eine internationale Koordination etwa in der Eurokrise einsetzte. Sie verweisen auf Weltsozialforen, auf denen sich zahlreiche auf dem Globus verstreute Basisinitiativen organisieren. Auch Frank Deppe hat beobachtet: „Immer dann, wenn von einer Krise der Demokratie gesprochen wird oder reale Bewegungen diese Krisen zum Gegenstand machen, wird eine Demokratisierung der Politik gefordert und damit der normative Kern des Demokratiebegriffs, die Volkssouveränität, wieder in den Mittelpunkt gerückt. Die herrschende Demokratietheorie hat sich von diesem normativen Kern verabschiedet.“
Soziale Bewegungen wie Occupy oder Blockupy, griechische, portugiesische oder spanische Demonstranten gegen die Troika-Politik in der Euro-Krise setzen auf direkte Demokratie. Sie haben allerdings das Problem, dass in der Theorie ihr basis-demokratischer Impuls gewürdigt, in der großen Politik jedoch weitgehend ignoriert wird.
Es gibt durchaus Träger einer neuen direkten Demokratie. Die Basisorganisation „Occupy“ etwa hat sich das Motto „Wir sind die 99 Prozent“ gegeben. Die Aktivisten wenden sich gegen die einseitige Beeinflussung der Regierungen durch die ökonomischen Eliten. Mit ihren Parkbesetzungen oder Demonstrationen drücken sie aus: „Wir“ sind auch noch da. Und „wir“ sind die Mehrheit. In der Tat ergeben sich in Umfragen häufig breite Zustimmungen zu ihren Forderungen. Bereits wenige Wochen nach Beginn von „Occupy Wall Street“ lag die Unterstützung durch die Bevölkerung bei 54 Prozent. Und das, obwohl die Bewegung nicht landesweit bekannt war und obwohl in den etablierten Medien eine breite Ablehnungsfront herrschte. Bei einer Umfrage vom Oktober 2011 in Deutschland antworteten 87 Prozent auf die Frage „Haben Sie Verständnis für den Anti-Banken Protest?“ mit „Ja“.
Doch diese Zahlen sind bislang nicht mehr als eine Behauptung einer überwältigenden Mehrheit. Ihre theoretische oder politische Umsetzung steht noch aus. Theoretische Konzepte oder stabile, langfristig relevante politische Strukturen existieren nicht. Unmittelbaren, direkten, basisnahen Bewegungen Vieler wird vielfach zugetraut, als Antriebsmotor und Initiator einer neuerlichen Demokratisierung zu wirken – wobei die Betonung auf dem Prozess liegt, an dessen Ende eine neue Kombination aus Volksouveränität und Repräsentation liegen könnte.
In globalen, weltbürgerlichen Zuständen ist eine reine Form direkter Demokratie pure Illusion. Um die viel beschworene Krise der Demokratie abzuwenden, ist eine neue Mischform aus direkter und repräsentativer Demokratie nötig. Wie eine aussehen könnte, ist allerdings eine Frage, auf die auch die Philosophen noch keine schlüssige Antwort gefunden haben. Frank Deppe jedenfalls ist sich sicher: „Dieser normative Kern der Demokratie als Volkssouveränität ist immer verbunden mit der Kritik an der Machtasymmetrie in der Klassengesellschaft.“ Ansonsten droht der französische Schriftstellers Romain Rolland Recht zu behalten: „Demokratie, das ist die Kunst, sich an die Stelle des Volkes zu setzen und ihm feierlich in seinem Namen, aber zum Vorteil einiger guter Hirten die Wolle abzuscheren.“