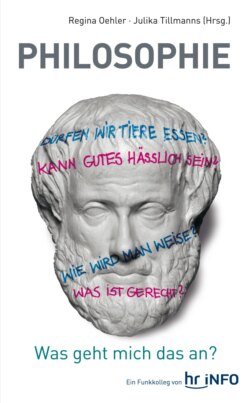Читать книгу Philosophie - Was geht mich das an? - Julika Tillmanns - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление02 LEIHMUTTERSCHAFT, ADRESSHANDEL, PRIVATSCHULEN – DÜRFEN WIR ALLES ZUR WARE MACHEN?
Von Ruth Fühner
- Zellen-Upgrade im Knast: 82 Dollar pro Nacht
- Kosten für das Austragen eines Embryos durch eine indische Leihmutter: 6.250 Dollar
- Vermietung der Stirn (oder anderer Körperteile) zu Werbezwecken: 777 Dollar
- In Somalia oder Afghanistan für ein privates Militärunternehmen kämpfen: von 250 Dollar pro Monat bis 1.000 Dollar pro Tag
Sie klingen schockierend, die Preisschilder, die Michael J. Sandel, Professor für politische Philosophie an der Harvard-Universität, in seinem Buch „Was man für Geld nicht kaufen kann“ aufzählt. Und leben wir nicht tatsächlich in einer Zeit, in der fast alles verkauft und gekauft werden kann?
Allerdings: Schon um das Jahr 1606 legte der englische Dichter William Shakespeare einem gewissen Timon, Bürger des antiken Athen, eine Verfluchung von Gold und Geld in den Mund.
„Gold? Kostbar, flimmernd, rotes Gold?
(…) So viel hievon macht schwarz weiß, häßlich schön;
Schlecht gut, alt jung, feig tapfer, niedrig edel.
Dies lockt (…) den Priester vom Altar;
Reißt Halbgenesnen weg das Schlummerkissen:
Ja, dieser rote Sklave lost und bindet
Geweihte Bande; segnet den Verfluchten;
Er macht den Aussatz lieblich, ehrt den Dieb
Und gibt ihm Rang, gebeugtes Knie und Einfluß
Im Rat der Senatoren; dieser führt
Der überjähr’gen Witwe Freier zu;
(…) Verdammt Metall,
Gemeine Hure du der Menschen, die
Die Völker tört.“
Scharfe Worte. Aber wogegen genau richten sie sich? Klar verabscheuen wir es, wenn einer sein Geld unrechtmäßig erworben hat – und sich gar noch politischen Einfluss damit erkauft. Aber was ist dagegen einzuwenden, wenn ein Aussätziger nicht ausgestoßen, sondern gepflegt wird – oder eine alte Frau eine späte Liebe findet? Eigentlich nichts. Nur dass der Kranke und die Witwe krank und allein bleiben müssen, wenn sie kein Geld haben. Reichtum aber erkauft ihnen, so Timon, eine Zuwendung, die ihnen keiner schenken würde.
Timons Kritik an der Macht des Geldes zitiert im Jahr 1844 Karl Marx in seinen „Ökonomisch-philosophischen Manuskripten“. Für ihn ist Geld ein „Kuppler zwischen dem Bedürfnis und dem Gegenstand, zwischen dem Leben und dem Lebensmittel des Menschen“. Und als Kuppler korrumpiert es moralische Werte, ja, es kann sie in ihr Gegenteil verkehren.
„Als diese verkehrende Macht erscheint das Geld dann auch gegen das Individuum und gegen die gesellschaftlichen Bande, die für sich Wesen zu sein behaupten. Es verwandelt die Treue in Untreue, die Liebe in Haß, den Haß in Liebe, die Tugend in Laster, das Laster in Tugend, den Knecht in den Herrn, den Herrn in den Knecht, den Blödsinn in Verstand, den Verstand in Blödsinn.“
Zweierlei fällt hier auf: wenn Geld Laster in Tugend verwandeln kann, kann es ja durchaus auch segensreich wirken. Vor allem aber: Marx polemisiert hier nicht gegen den Markt generell, also gegen den Austausch materieller Güter oder Dienstleistungen. Es geht hier nicht um die „Verkehrung“, sagen wir, von Milchtüten in Flachbildschirme.
Es geht vielmehr um ganz bestimmte, nämlich immaterielle Werte. Es geht um Moral, um Politik – und die Frage, was wir als wahr ansehen. Dass das Geld auch hier eine Rolle spielt, dass das Warendenken, wenn man es lässt, in alle Lebensbereiche hineinregiert – das ist kritikwürdig.
Demokratische Gesellschaften haben in den vergangenen Jahrhunderten Blockaden gegen die Käuflichkeit errichtet.
Sie haben politische und moralische Grenzlinien gezogen, jenseits derer der Markt keine Macht haben soll – und Güter definiert, die, im Sinn des Gemeinwohls, nicht zur Ware gemacht werden dürfen. Der amerikanische Philosoph Michael Walzer nennt in seinem Buch „Sphären der Gerechtigkeit“ unter anderem:
„Menschen dürfen nicht ge- und verkauft werden.
Politische Macht und politscher Einfluss dürfen nicht gekauft und nicht verkauft werden.
Strafjustiz und Rechtsprechung sind unverkäuflich.
Rede-, Presse-, Religions- und Versammlungsfreiheit (…) kommen jedem Bürger zu.
Elementare Wohlfahrtsleistungen, wie polizeilicher Schutz oder die Erziehung an Grund- und Oberschulen, sind nur an ihren Rändern käuflich.
Preise und Ehrungen, öffentliche wie private, können nicht käuflich erworben werden.
Und schließlich gibt es eine lange Liste von kriminellen Verkaufsaktivitäten, die streng verboten sind und unter Strafe stehen.“
Überschreitungen dieser Grenzen und Verbote hat es immer gegeben. Wer sie übertrat, musste und muss mit Strafverfolgung rechnen – oder zumindest mit scheelen Blicken. In verschiedenen Bereichen aber bröckelt aus verschiedenen Gründen die Blockade. Es werden Dinge zur Ware – sind also für Geld zu haben – die früher umsonst waren, verschenkt oder nach ganz anderen Kriterien vergeben wurden.
Der Markt ist genial, wenn es darum geht, die Produktion und Verteilung von Gütern zu organisieren, Überfluss und Wohlstand sind ohne ihn nicht denkbar. Aber sollen wir ihm wirklich alle Lebensbereiche überlassen? Dient „die unsichtbare Hand“ des Marktes wirklich dem Gemeinwohl, wie manche Ökonomen behaupten?
Wie wollen wir leben? Fragen wie diese sind das angestammte Terrain der Philosophie. Michael Sandel formuliert die Ausgangslage so:
„Wir sind von einer Marktwirtschaft zu einer Marktgesellschaft geworden. Eine Marktwirtschaft ist ein wertvolles und effizientes Instrument, um Produktivität zu organisieren. Aber in einer Marktgesellschaft steht so gut wie alles zum Verkauf. Seit drei Jahrzehnten treiben wir in diese Richtung. Wir müssen uns fragen, ob die Märkte dem Gemeinwohl dienen – und wo sie nicht hingehören, wo sie andere Werte und Güter beschädigen, die uns wichtig sind. Ich nenne das den Triumphzug des Marktes, den Glauben, dass die Märkte das wichtigste Instrument sind, das Gemeinwohl zu verwirklichen.“
Der Triumphzug des Marktes, den Sandel beschreibt, fällt mit einem ziemlich genau datierbaren historischen Ereignis zusammen, sagt die Philosophin und Sozialwissenschaftlerin Dr. Lisa Herzog von der Universität Frankfurt: „Nach dem Fall der Mauer 1989 herrschte die Auffassung, dass Demokratie und Kapitalismus eine sehr stabile Union eingehen könnten und man das beste Wirtschaftssystem gefunden habe und nicht weiter drüber nachdenken müsste. Und dann gab es die große Finanzkrise. Außerdem zeigt sich, dass die Ungleichheit innerhalb kapitalistischer Gesellschaften größer wird, und da stellt sich neu die Frage: Haben wir wirklich ein System, das mit Werten wie Gleichheit und Gerechtigkeit vereinbar ist – oder müssen wir an dem derzeit herrschenden Finanz- und Wirtschaftssystem einiges ändern?“
Viel kam in den vergangenen Jahrzehnten zusammen.
Die Finanzkrise erschütterte das Vertrauen, dass man den Märkten freien Lauf lassen darf. Die Globalisierung, das Internet und der wissenschaftliche Fortschritt haben Dienstleistungsangebote mit sich gebracht, an die vorher im Traum nicht zu denken war: die sogenannte Leihmutterschaft etwa oder den exzessiven Handel mit Daten.
Nach welchen Maßstäben sollen wir in all diesen Fällen urteilen, die ja extrem unterschiedlich gelagert sind? In einem Interview der BBC von 2013 schlägt Michael Sandel zwei Kriterien vor: „Das eine Kriterium hat etwas mit Nötigung zu tun. Ist der Austausch wirklich freiwillig – wie es das Gesetz des Marktes fordert? Wenn wir einen freien Markt für Nieren hätten, und es stellte sich heraus, dass nur verzweifelte, verarmte Bauern ihre Nieren verkaufen, müssten wir uns fragen, ob diese Transaktion wirklich freiwillig wäre oder schlicht von wirtschaftlicher Not und Verzweiflung erzwungen.“
Der Tausch Geld gegen Ware kann also, erstens, ungerecht sein, weil die angeblich gleichen Partner in Wirklichkeit mit höchst unterschiedlichen Voraussetzungen in den Handel gehen.
Oder, zweites Kriterium: er kann Werte und gesellschaftliche Normen beschädigen, die für das Selbstverständnis von Demokratien wesentlich sind. Michael Sandel: „Das andere Kriterium ist: Verdrängt die Transaktion Haltungen und Werte, die uns wichtig sind? Im Fall der Nieren: Wird sie dazu führen, dass wir unsere Körper als Ersatzteillager ansehen – und wie ist das mit der Menschenwürde zu vereinbaren?“
Die Annahme radikaler – oder neoliberaler – Vertreter der Marktwirtschaft, der Mensch sei ein „homo oeconomicus“, der sich strikt rational an seinem (geldwerten) Vorteil orientiert, ist dabei längst widerlegt. Experimente zeigen, dass Menschen bestimmte Güter viel höher einschätzen als ihren Geldwert. Noch einmal Michael Sandel:
„In der Schweiz suchte man einen Ort für ein Atommülllager und fand eine geeignete kleine Stadt in den Bergen. Nun musste man noch ihre Zustimmung einholen – denn Atommüll im eigenen Hinterhof will ja keiner. Man fragte also: Wenn das Parlament sagt, dies ist der geeignete Ort – würdet ihr das akzeptieren? 51 Prozent sagten ja.
Dann stellte man eine weitere Frage, um den Handel zu versüßen. Angenommen, eure Stadt wird ausgewählt, und die Regierung bietet jedes Jahr jedem Bürger eine finanzielle Entschädigung. Und nun stieg die Zustimmung nicht etwa – sie sank auf 25 Prozent. Aus ökonomischer Sicht ist das ein Paradox. Die Leute waren bereit, das Atommülllager aus staatsbürgerlicher Verantwortung zu akzeptieren, aber bestechen lassen wollten sie sich nicht.“
Nicht alles also lässt sich folgenlos in Ware ummünzen – im Gegenteil, manches wird beschädigt, sobald Geld ins Spiel kommt. Güter können auf ganz unterschiedliche Weise problematisch werden, sobald sie als Ware gehandelt werden. Das soll im Folgenden an drei Beispielen gezeigt werden: Adressen, Schulbildung und Mutterschaft.
Beispiel 1: Adresshandel
Die ersten Büros, die mit Adressen handelten, entstanden im 17. Jahrhundert. Auch der deutsche Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz wünschte sich ein „Notiz-Amt“ – um das chaotische Marktgeschehen zu ordnen und Suchende mit Anbietern zusammenzubringen:
„Findet offt einer was er suchte, bekomt auch offt gelegenheit etwas zu suchen und zu verlangen, darauff er sonst nicht gedacht hätte.“
Eine Aufgabe, die sich auch die Datenkrake Google auf die Fahnen geschrieben haben könnte. Adressen werden also schon seit langem als Waren gehandelt. Gleichzeitig sind sie ein wichtiges Steuerungsinstrument für Polizei und Obrigkeit. Nicht nur Geheimdienste, auch die Meldeämter der Gemeinden sammeln Daten zum Zweck der politischen Kontrolle. Diese behördlich registrierten Daten weckten die Begehrlichkeit der Werbewirtschaft.
2012 beschloss der Bundestag überraschend, dass Meldedaten für gewerbliche Zwecke weitergegeben werden dürften, wenn die Betroffenen nicht Widerspruch einlegten. Verfügte eine Firma aber bereits über Daten, hätte sie sich diese von der Meldestelle bestätigen oder berichtigen lassen können – und zwar egal, ob die betroffene Person Widerspruch einlegte oder nicht. Da für solche Auskünfte Gebühren anfallen, sah es außerdem so aus, als ob die Kommunen mit dieser Regelung ihre leeren Kassen auffüllen könnten. Datenschützer und Öffentlichkeit liefen Sturm, das Gesetz wurde geändert.
Seit 2015 dürfen Namen und Anschriften aus den Melderegistern nur noch dann zu Werbezwecken weitergegeben werden, wenn die Betroffenen ausdrücklich zugestimmt haben. Außerdem dürfen Meldedaten nur noch für den angegebenen Zweck verwendet werden und sind anschließend zu löschen.
Doch der Bürger liefert ja nicht nur den Behörden seine Daten. Er tut das – freiwillig oder unfreiwillig – zum Beispiel auch bei Bestellungen im Internet, wo sich vieles im Kleingedruckten verbirgt. Lisa Herzog:
„Das ist nicht die Form von Zustimmung, die dem Ideal des aufgeklärten Kunden entspricht, der genau weiß, was er tut, und sich genau dafür entscheidet. Ein anderes Problem ist, dass Adressen in falsche Hände geraten können. Solang einem nur Werbung zugeschickt wird, mag das noch einigermaßen harmlos sein. Aber wenn z.B. Geheimdienste solche Adressen kaufen oder Leute, die einen stalken wollen, persönliche Fehden führen wollen, ist das eine gewisse Gefahr.“
Privatheit als Verfügungsgewalt über die eigene Intimität, als Raum, der sicher ist vor sozialer Kontrolle, steht prinzipiell in Spannung zur Wissbegier von Industrie und Handel, Versicherungen oder Banken. Wer weiß, wie wir ticken, wie wir entscheiden, kann uns schließlich alles verkaufen – auch Dinge, die uns schaden.
Mit Big Data ist hier nur eine neue Dimension erreicht. Je mehr unsere Daten – von der Adresse über den Energieverbrauch unseres smarten Hauses bis zur Nutzung des Schlafzimmers – zur Ware werden, desto schwieriger wird der Schutz der Privatsphäre. Ja, das soziale Klima ist schon so weit verändert, dass sogar zur Debatte steht, ob die Privatsphäre wirklich ein zu schützendes Gut ist – oder ein veraltetes Konzept.
Beispiel 2: Privatschulen
Privatschulen sind in Deutschland lange nicht so verbreitet wie in anderen Ländern. Doch immer häufiger nehmen auch hierzulande Eltern, die es sich leisten können, Abschied vom öffentlichen Schulsystem. Vielleicht weil sie fürchten, ihre Kinder kämen nicht voran, wenn in der Klasse viele kein Deutsch sprechen. Oder um dem Nachwuchs generell eine bessere Startposition in einer extrem karriereorientierten Gesellschaft zu verschaffen. Bildung wird so auch in der Bundesrepublik tendenziell zu einer Ware, von der sich mehr und Besseres kaufen kann, wer mehr Geld hat.
Die Frankfurter Philosophin Lisa Herzog nennt die Debatte um Privatschulen ein gutes Beispiel dafür, wie Akteure am Markt, auch ohne es zu wollen, gesellschaftliche Werte beschädigen: indem sie die sozialen Bindekräfte, die Kohäsion schwächen.
„Das Problem ist, dass, wenn reiche Eltern zusätzliche Leistungen für ihre Kinder einkaufen können, die weniger betuchten Familien abgehängt werden, und dass dann aus der Summe von sehr viel gut gemeinten Handlungen strukturell ein Problem entsteht: Diejenigen, die nicht so begütert sind, geraten ins Hintertreffen. Das ist der typische Fall eines sozialen Dilemmas, wo eine reine Marktlösung dazu führt, dass ganz fundamentale Werte untergraben werden: Chancengleichheit zum Beispiel oder soziale Kohäsion. Dass sich Kinder aus unterschiedlichen sozialen Schichten kennenlernen – das funktioniert nicht, wenn sich reiche Eltern systematisch aus der öffentlichen Schule herausziehen.“
Demokratie beruht ja auch darauf, dass Bürgerinnen und Bürger einander im öffentlichen Raum begegnen und sich nicht voneinander abschotten, bis die einen in „Gated Communities“ leben, die andern im Ghetto. Erst recht besteht diese Gefahr, wenn Schulbildung oder persönliche Sicherheit mit Geld gekauft werden können. Wenn in immer mehr Sphären immer mehr für Geld gekauft werden kann, wird das Leben immer ärmer für die, die wenig Geld haben, und die soziale Spaltung wächst.
Für Lisa Herzog ein Grund, eine politische Regelung einzufordern:
„Dadurch, dass es nicht das egoistische oder böse Verhalten einzelner ist, sondern ein soziales Dilemma, ist dies ein typischer Fall, wo politisches Handeln gefragt ist und der Markt politisch strukturiert und geordnet werden müsste. Die öffentlichen Schulen müssten so gut sein, dass alle Eltern ihre Kinder gern dahin bringen und ein gewisser sozialer Zusammenhalt in diesen Schulen entstehen könnte.“
Beispiel 3: Leihmutterschaft
Im Streit um die Leihmutterschaft treffen der Triumphzug des Marktes und der rasante Fortschritt der Reproduktionstechnologie zusammen. Mit dem Kinderwunsch lässt sich viel Geld verdienen – und scheinbar ist seine Erfüllung ein gutes Geschäft für alle. Für die Mediziner, für die werdenden Eltern – und für die Frauen, die an ihrer statt die Kinder austragen. Für sie kann – wenn die Vermittlungsagenturen ihnen keinen Strich durch die Rechnung machen – das Geld, das sie erhalten, den Start in ein neues Leben bedeuten.
Für Professor Petra Gehring, die Philosophie an der TU Darmstadt lehrt, ist schon der Begriff „Leihmutter“ ein politischer – und überaus fragwürdig: „Sprachpolitisch würde ich vorschlagen, nicht von Leihmutterschaft zu sprechen, sondern von Schwangerschaftskauf. Das würde deutlich markieren, dass es hier um Geldflüsse geht. Hier wird nicht einfach ein Körper benutzt, und der ist hinterher so wie vorher, sondern es ist eine gravierende Sache. Eine Schwangerschaft ist immer auch ein gesundheitliches Risiko.“
Wenn an einem Kind vor allem interessiert, dass es das Genmaterial von Vater und Mutter weitergibt, wird damit auch eine bestimmte Einstellung zur Elternschaft favorisiert: „Was wäre die Alternative? Ein Kind zu adoptieren, in der Familie wie auch immer mit Kindern zu tun zu haben? Alle Varianten von sozialer Elternschaft werden damit zurückgewiesen. Was man eigentlich bezahlt, ist nicht die Elternschaft schlechthin, sondern die biologische Elternschaft, insbesondere in dem Fall, wo Ei und Sperma beider biologischer Eltern in vitro zusammengebacht werden und eine dritte Person austragen soll. Was eigentlich bezahlt wird, ist diese biologische Abstammung im Kind – nicht das Kind.“
Darüber hinaus kann beim Schwangerschaftskauf von gleichen Ausgangsbedingungen für Kunden und Verkäuferin keine Rede sein, sagt Petra Gehring: „Personen, die sich das Recht nehmen, Geld anzubieten für so eine „Dienstleistung“, müssen sich fragen, ob das auch umgekehrt denkbar wäre. Und sich überlegen, wie sehr sie hier ein Armuts-Reichtums-Gefälle ausnutzen.“
Ein Handel, so hieß es oben, ist ungerecht, wenn die eine Seite ihn nur aus Not eingeht – und das ist bei der sogenannten Leihmutterschaft der Fall. Sie ist aber nicht nur unfair – sie beschädigt auch ein hohes Gut: die Menschenwürde. Petra Gehring: „Das sind Situationen, die wir mit Sklaverei assoziieren, mit Leibeigenschaft, oder überhaupt mit Eigentumskategorien, die auf den lebendigen Körper angewandt werden. Situationen, die in der Zeit der Aufklärung abgeschafft oder zumindest zurückgedrängt wurden. Rechtsphilosophisch wurde das im sogenannten Instrumentalisierungsverbot formuliert – man darf einen Menschen nie als Zweck für etwas nutzen, sondern er muss immer um seiner selbst willen auch respektiert werden – das ist es, was wir Würde nennen.“
Wie wollen wir leben?
Wie viel ist uns unsere Privatsphäre wert?
Ist es uns gleichgültig, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufklafft?
Dürfen wir die Menschenwürde über Bord werfen, wenn wir dafür Geld bezahlen?
Fragen, auf die es innerhalb unserer Gesellschaft sehr unterschiedliche Antworten gibt.
Und Lisa Herzog warnt, bei allem Engagement, vor philosophischer Parteinahme: „Das ist schon ein heikles Thema, dass man als Philosoph glaubt, besser zu wissen, was die Leute zu wollen haben – das hätte etwas Paternalistisches.“
Es sind sich ja nicht einmal die Philosophen einig darüber, „was Menschen zu wollen haben“. Langsam aber wächst zumindest das Bedürfnis an öffentlichen Debatten über die Grenzen des Marktes. Diese Debatten sind, so Michael Sandel, unter dem Druck der Kommerzialisierung zu lange aufgeschoben worden: „An der gegenwärtigen politischen Debatte fällt auf, dass wir diese Fragen nicht einmal stellen. Wir haben tatsächlich unser moralisches Urteil an die Märkte delegiert – nach dem Motto: Da sind wir uneins, also lassen wir die Märkte – neutral, wie wir glauben – entscheiden. Ich glaube, es ist ein entscheidender Mangel, dass wir nicht politisch darüber diskutieren, wo der Markt dem Gemeinwohl dient und wo nicht.“
Wenn uns die Menschenwürde wichtig ist, wenn wir Politik als lebendige Auseinandersetzung über grundsätzliche Fragen, über Werte und Allgemeinwohl verstehen wollen, dann kann die Antwort auf unsere Ausgangsfrage nur lauten:
Nein, wir dürfen nicht alles zur Ware machen.
Romantischer formuliert es ausgerechnet Karl Marx:
„Setze den Menschen als Menschen und sein Verhältnis zur Welt als ein menschliches voraus, so kannst du Liebe nur gegen Liebe austauschen, Vertrauen nur gegen Vertrauen etc. Wenn du die Kunst genießen willst, musst du ein künstlerisch gebildeter Mensch sein; wenn du Einfluss auf andre Menschen ausüben willst, musst du ein wirklich anregend und fördernd auf andere Menschen wirkender Mensch sein.“
Jener von Marx zitierte Shakespeare übrigens, der seinen Timon gegen die Macht des Geldes wüten ließ, war selbst ein begnadeter Vermarkter seiner Kunst. Von dem Geld, das er mit seiner Londoner Theatertruppe verdiente, konnte er sich nach seinem Rückzug in Stratford-upon-Avon ein luxuriöses Anwesen und ein finanziell sorgloses Alter kaufen.