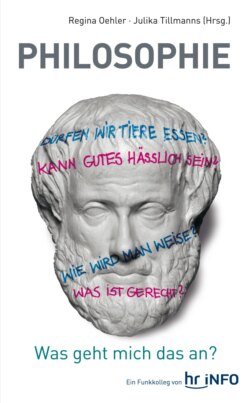Читать книгу Philosophie - Was geht mich das an? - Julika Tillmanns - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление05 WISSEN WIR MEHR ALS WIR GLAUBEN?
Von Mischa Erhardt
„Der gesunde Menschenverstand ist die gerechtest verteilte Sache der Welt; denn alle Leute meinen, damit so gut ausgestattet zu sein, dass sie sich nicht mehr davon wünschen, als sie haben.“
So urteilte der Philosoph René Descartes. Und in der Tat sprudelt förmlich jeder von uns über von Wissen: Wir wissen, wie man spricht oder telefoniert, wissen, wie viel Uhr es ist, wissen, wie viel Monate ein Jahr hat, wissen, dass sechzig Minuten eine Stunde sind.
Wir wissen unseren eigenen und viele andere Namen, wir wissen dass 2 und 2 gleich 4 ist, und wir wissen, dass die Erde eine Kugel ist und keine Scheibe.
Eine ganze Menge dieses Wissens eignen wir uns sehr früh an, saugen es quasi mit der Muttermilch auf: So wissen wir, dass sich Stein hart anfühlt und Gras weich; oder dass die Herdplatte gefährlich ist, wenn sie heiß ist. Oft erwerben wir Wissen mit viel Zeit und Aufwand – zunächst in der Schule, später dann in Ausbildung und Beruf oder an Hochschulen und Universitäten. Ja wir leben sogar, wie manche Sozialwissenschaftler behaupten, in einer Wissensgesellschaft.
Und doch gibt es seit Anbeginn der Philosophie auch Philosophen, die an unserem vermeintlichen Wissen zweifeln. Wie der griechische Philosoph Sokrates, dem der berühmte Ausspruch zugeschrieben wird: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“ Und dabei wurde Sokrates von der höchsten Autorität im alten Griechenland als der „Weiseste aller Athener“ bezeichnet.
„Sokrates berichtet, dass ein Freund das delphische Orakel gefragt hat, wer der Weiseste aller Griechen sei“, erzählt Marcus Willaschek, Philosophie-Professor an der Universität Frankfurt. „Die Antwort des Orakels lautete: Sokrates. Der erwidert, das kann nicht sein, ich weiß nicht viel, es gibt Experten, die viel mehr wissen als ich. Aber das Orakel kann sich nicht irren, also sucht er verschiedene Personen auf, Feldherren, Priester und so weiter. Und er stellt fest, dass die zwar beanspruchen, etwas zu wissen, in Wirklichkeit aber wissen sie gar nichts. Und so kommt er zur Aussage, dass er zumindest weiß, dass er nicht weiß, und insofern vielleicht weiser ist als die anderen.“
Sokrates und sein Schüler Platon gehören in der Philosophiegeschichte zu den Ersten, von denen überliefert ist, dass sie systematisch nach einer Definition von Wissen gesucht haben. Bis heute beschäftigen sich Philosophen mit der Frage, was Wissen eigentlich ist. Denn wenn man in verschiedenen Bereichen Wissen haben kann – etwa dem Schreinerhandwerk, der Schuhmacherkunst oder dem Hausbau – dann stellt sich die Frage, ob es eine Wesensdefinition von Wissen gibt, die auf all diese Bereiche zutrifft. Ob es also bestimmte Eigenschaften gibt, die bei allen Wissensformen gleich sind. Sokrates wollte in einigen seiner philosophischen Gespräche genau das herausfinden. Er und sein Schüler Platon, der diese Gespräche in seinen Werken festgehalten hat, haben ein bleibendes Erbe hinterlassen. Ihre Definition von Wissen hat bis ins 20. Jahrhundert überdauert: Wissen sei begründete wahre Meinung.
Was damit gemeint ist, erklärt der Philosoph Marcus Willaschek: „Wissen ist begründete wahre Meinung: Erstens ich halte etwas für wahr, zweitens es muss wahr sein, und drittens ich muss gute Gründe dafür haben, dass ich es für wahr halte. Es muss gerechtfertigt oder abgesichert sein. Das ist die Standarddefinition, die 2000 Jahre mehr oder weniger unangefochten überdauert hat.“
2000 Jahre, bis der Philosoph Edmund Gettier auf den Plan trat. Denn der machte sich zu Beginn der 1960er Jahre intensiv Gedanken über diese Definition von Wissen. Das Ergebnis seiner Grübeleien ist einer der folgenreichsten Aufsätze der Philosophiegeschichte; zumindest, was die Wirkung gemessen an der Seitenzahl betrifft! Auf knapp drei Seiten hat Edmund Gettier auf ein Problem aufmerksam gemacht, an dem die Philosophen nach ihm bis heute knabbern: Ausgehend von der Standarddefinition von Wissen als „wahrer, gerechtfertigter Meinung“ gibt Gettier Beispiele, bei denen die Bedingungen für Wissen zwar gegeben sind, bei denen wir den Akteuren aber trotzdem kein Wissen zuzusprechen würden.
Sein Einwand lautet: Wenn jemand nur zufällig Wissen äußert, würden wir ihm echtes Wissen über den Sachverhalt nicht zusprechen.
Professor Thomas Grundmann von der Universität Köln gibt ein Beispiel: „Also stellen Sie sich vor, Sie schauen um drei Uhr auf die Uhr, und die Uhr zeigt drei Uhr an. Aber die Uhr ist stehen geblieben. Sie schauen also auf die Uhr und kommen zur gerechtfertigten und wahren Meinung, es sei drei Uhr. Aber hätten Sie nur fünf Minuten früher oder später darauf geguckt, hätten Sie eine falsche Meinung gehabt. Das scheint uns intuitiv kein Wissen zu sein. Und das ist in gewisser Weise der Kern des Gettier-Problems.“
Edmund Gettier nennt in seinem kurzen Aufsatz andere Beispiele. Für Nicht-Philosophen mögen die konstruiert erscheinen; ihre logische Schlussfolgerung aber ist eindeutig: Wir müssten nach der Standarddefinition von Wissen auch das Wissen nennen, was durch Zufall oder Glück gewonnen wurde. Aber das entspricht nicht unserem alltäglichen Verständnis. Philosophen nach Gettier versuchen deswegen bis heute, dem Zufall zu Leibe zu rücken, sie suchen Auswege aus der Definitionskrise.
Sie versuchen zum Beispiel, die Standarddefinition von Wissen so zu ergänzen, dass zufälliges Wissen nicht mehr darunter fällt. Oder sie denken – wie es Philosophen gerne und intensiv tun – genauer über die Begriffe nach, die sie bisher verwendet haben.
Elke Brendel ist Fachfrau auf diesem Gebiet. Die Professorin an der Universität Bonn hat ein Buch über „Wissen“ geschrieben. Sie sagt: „Es ist ein typisches Phänomen in der Philosophie: Man startet bei einer einfachen Frage – was ist Wissen? Und dann landet man bei ganz anderen Fragen, nämlich – was ist Rechtfertigung? Was ist Zufall? Und genau das ist jetzt die Schwierigkeit, zu einer Definition von Wissen zu kommen, bei der der Zufall ausgeklammert ist. Andere Ansätze wären zu sagen: Wissen ist zwar eine wahre Meinung, aber der Meinungsbildungsprozess davor muss zuverlässig sein, darf nicht zu falschen Überzeugungen führen.“
Das ist auch der Ansatz, den Elke Brendel selbst in ihrer philosophischen Arbeit verfolgt: Sie versucht das Augenmerk bei der Frage nach Wissen auf die Methoden zu legen, mit denen wir Wissen erlangen.
Eine andere Denkrichtung, die vielversprechend erscheint, ist der so genannte Kontextualismus. Der rückt die Situation der Menschen ins Rampenlicht, die von sich behaupten, Wissen zu besitzen. So ändern sich je nach Situation und Kontext die Kriterien, ob echtes Wissen vorliegt oder nicht. Elke Brendel erklärt diesen Ansatz am Beispiel „Scheunenattrappen“: „Henry fährt durch eine Landschaft, in der viele Scheunenattrappen stehen, weil gerade ein Film gedreht wurde, und sieht eine echte Scheune und meint, das sei eine echte Scheune. Intuitiv würden wir sagen: Das ist kein Wissen, sondern Zufall. Ob jemand etwas weiß oder nicht, hängt vom Kontext ab, von der Umwelt, in der sich jemand befindet.“
Ein anderer Gesichtspunkt bei der Abgrenzung von verlässlichem Wissen ist die Frage, was von dem Wissen abhängt, wie wichtig es also ist, sich darauf verlassen zu können. „Wenn viel auf dem Spiel steht, dass meine Meinung sich als wahr heraus stellt, bin ich weniger geneigt zu behaupten, dass ich wüsste“, sagt Elke Brendel und nennt wieder ein Beispiel: „Wenn ich aus dem Haus gehe um Brötchen zu holen, dann bin ich eher geneigt zu sagen, ich weiß, ich habe die Kaffeemaschine ausgemacht; wenn ich aber für zwei Jahre auf eine Weltreise gehe, dann bin ich weniger geneigt zu sagen, ich weiß, dass ich sie ausgemacht habe, dann gehe ich lieber noch einmal zurück und schaue nach. Das scheint plausibel zu sein, zumindest was unsere eigenen Wissensansprüche angeht, dass das auch davon abhängt, wie wichtig es für uns ist. Insofern ist Wissen eben auch vom Kontext abhängig.“
Bei einer Frage, die über Leben oder Tod entscheidet, werden wir uns kaum darauf verlassen, dass irgendjemand behauptet, er wisse Bescheid. Nach einem Atomunfall etwa werden wir uns ungern nur auf die Meinung des Kraftwerksbetreibers verlassen, wenn der sagt, er habe die Sache unter Kontrolle, und es bestünde seines Wissens keine Gefahr. Wir würden wahrscheinlich ruhiger schlafen, wenn unabhängige Wissenschaftler Messungen durchführen und bestätigen würden, dass keine Gefahr besteht. Was übrigens auf einen weiteren Aspekt verweist, der in der aktuellen Debatte über Wissen in der Philosophie diskutiert wird: Wissen wird heute auch als ein soziales Phänomen diskutiert.
Thomas Grundmann: „Zuerst muss man sich klar machen, wieweit das eigene Wissen von anderen abhängt. Wir wissen ja nicht mal unseren eigenen Namen, ohne dass er uns gesagt wird; indirekt hängt alles, was wir wissen, von anderen ab. Und ein zentrales Problem ist: Wie bekommt man die Abhängigkeit von anderen im sozialen Bereich mit dem Gedanken der epistemischen Autonomie in Einklang; dass wir also selbst denken und kritisch beurteilen sollen. Es ist in gewisser Weise eine Demütigung des autonomen Subjektes, dass man diese Abhängigkeit von anderen anerkennen muss, aber ich denke dafür ist es höchste Zeit. Und in den vergangenen dreißig Jahren hat es eine starke Einsicht gegeben, dass diese soziale Dimension des Wissens eine zentrale Rolle spielt.“
Wer aber diese soziale Dimension des Wissens untersucht, der muss sich auch mit den Medien befassen, die Menschen nutzen, um an Wissen zu gelangen. Und das sind in modernen Gesellschaften vor allem elektronische Medien und das Internet. Philosophen auf der Suche nach Wissensquellen untersuchen diese Medien aus einem speziellen Blickwinkel heraus. „Die Erkenntnistheorie würde schauen: Wann sind wir gerechtfertigt? Wenn wir Methoden verwenden, die mehrheitlich zu wahren Überzeugungen führen“, sagt Grundmann. „Und nun kann man das Internet, die Zeitungen und das Fernsehen daraufhin untersuchen, wie zuverlässig deren Informationen sind. Das ist eine empirische Untersuchung. Man kann dann auch schauen, ob man Indikatoren dafür hat, dass man bestimmten Bereichen im Netz mehr trauen kann als anderen Bereichen. Etwa Wikipedia, das ist mittlerweile eine sehr gute Informationsquelle. Aber es gibt Bereiche, wo es ganz schlecht ist. Und man kann durch die Dokumentation, wie Debatten abgelaufen sind, sehen, wie fragil das ist. Daran können Sie sehen, wie sich nun empirische Untersuchungen und erkenntnistheoretische Fragestellungen verweben. Da sind wir schon im Bereich der angewandten Erkenntnistheorie.“
Heute betrachten Philosophen die Menschen immer stärker in ihren sozialen Bezügen und Vernetzungen, wenn sie die Frage studieren, wie wir zu gesichertem Wissen kommen können. Eine ganz andere Spur verfolgte vor fast 400 Jahren René Descartes, der sich tiefgreifende Gedanken dazu gemacht hat, wie wir unsere Vernunft gebrauchen. Descartes spielt in der Geschichte des Nachdenkens über Wissen eine wichtige Rolle. Denn immer wieder gab es Skeptiker, die vermeintlich gesichertes Wissen in Frage stellten. Manche gehen sogar so weit, die Existenz der Außenwelt anzuzweifeln. Deswegen sucht Descartes im Strudel des Zweifels nach einem festen Halt, einem Punkt, den niemand hinterfragen kann und auf dem man das Gebäude unseres Wissens aufbauen kann.
Er findet eine solche Gewissheit in seinem berühmten Satz: „Ich denke, also bin ich.“ In seiner Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs schreibt Descartes: „So machte ich mir absichtlich die erdichtete Vorstellung, dass alle Dinge, die jemals in meinen Geist gekommen, nicht wahrer seien als die Trugbilder meiner Träume. Alsbald aber machte ich die Beobachtung, dass, während ich so weiter denken wollte, alles sei falsch, doch notwendig ich, der das dachte, irgend etwas sein müsse, und da bemerkte ich, dass diese Wahrheit, ‚Ich denke, also bin ich‘ so fest und sicher wäre, dass auch die überspanntesten Annahmen der Skeptiker sie nicht zu erschüttern vermöchten.“
Darin allerdings irrte Descartes. Es gibt bis heute eine ganze Reihe von Skeptikern, die bezweifeln, dass es einen solchen festen Anker im Denken geben kann. Denn all unser Denken und Wissen könnte auf Täuschungen beruhen. Die Skeptiker zeigen ein hohes Maß an Phantasie und Kreativität, wie solche Täuschungen aussehen könnten. Ein modernes Denkmodell dieser Art stammt von dem zeitgenössischen amerikanischen Philosophen Hillary Putnam:
Er stellte sich ein Gehirn in einem Tank mit Nährlösung vor, dessen Nerven-Enden an einem Supercomputer angeschlossen sind. Der gaukelt den Nerven des Gehirns nun Sinneseindrücke vor und zwar exakt so, wie es das Gehirn erleben würde, wenn es im Kopf eines Menschen wäre. Dieses Gehirn im Tank würde keinen Anhaltspunkt dafür haben, dass es sich in diesem Tank befindet. Es würde sich als Gehirn eines Menschen verstehen, das in der Außenwelt agiert und Wissen über diese Außenwelt ansammeln kann, alles Folge dieser Simulation und Täuschung. Von diesem Gedankenexperiment inspiriert, hat die Traumfabrik Hollywood daraus einen Blockbuster gemacht: Im Science-Fiction-Streifen „Matrix“ lebt die Menschheit in einer computergenerierten Scheinwelt, in der in Wirklichkeit aber die Maschinen die Herrschaft übernommen haben. Die menschlichen Körper schwimmen in Wirklichkeit in Nährflüssigkeiten und dienen den Maschinen durch ihre Körpertemperatur als Energielieferanten. Was fasziniert Philosophen an solchen Scheinwelten?
„Die Frage ist: Können wir wirklich ausschließen, dass wir in einer solchen Matrix leben“, fragt Elke Brendel. „Mit empirischen Beweisen wird es da schwierig. Und wenn wir das nicht ausschließen können, dann scheint das Auswirkungen zu haben auf unser existentielles Selbstverständnis; können wir dann noch freudvoll leben? Und zum anderen hat das Konsequenzen für unser Wissen über viel alltäglichere Dinge: Wenn ich nicht ausschließen kann, dass ich ein Gehirn im Tank bin, wie kann ich dann wissen, dass ich Hände habe? Das heißt, das Ausschließen dieser skeptischen Szenarien ist eigentlich die Bedingung dafür, dass ich Wissen über alltägliche Dinge in der Außenwelt habe.“
Diese Gedanken scheinen Spielchen zu sein; für Philosophen jedoch stellen sie harte Nüsse dar. Weil es aber sehr schwer bis unmöglich ist, solche universalen Verschwörungsmodelle zu widerlegen, haben Philosophen auch immer wieder ziemlich pragmatisch auf solche Einwände reagiert. So meint der Philosoph David Hume zum Beispiel, dass man die Möglichkeit solcher Täuschungen zwar kaum ausschließen kann. Die radikale Skepsis über die Existenz der Außenwelt verfliege aber recht schnell, wenn man aus seinem philosophischen Studierstübchen wieder in die Wirklichkeit trete. Er schreibt 1739:
„Da die Vernunft unfähig ist, solche Wolken zu zerstreuen, so ist es ein glücklicher Umstand, dass die Natur selbst dafür Sorge trägt und mich von meiner philosophischen Melancholie und meiner Verwirrung heilt, (…) indem sie mich aus ihr durch einen lebhaften Sinneseindruck, der alle diese Hirngespinste verwischt, gewaltsam herausreißt. Ich esse, spiele Tricktrack, unterhalte mich, bin lustig mit meinen Freunden. Wenn ich mich so drei oder vier Stunden vergnügt habe und dann zu jenen Spekulationen zurückkehre, so erscheinen sie mir so kalt, überspannt und lächerlich, dass ich mir kein Herz fassen kann, mich weiter in sie einzulassen.“
Ein Philosoph, der sich mit dieser ungelösten Situation des allgegenwärtigen Zweifels trotzdem nicht abfinden wollte, ist Immanuel Kant. Ihn empörte es regelrecht, dass die Philosophie den Skeptikern an der Realität einer Außenwelt nichts entgegenzusetzen habe als den bloßen Glauben, dass es die Welt draußen tatsächlich gibt, und wir verlässliches Wissen über sie erlangen können. Kant schreibt in seinem Hauptwerk, der „Kritik der reinen Vernunft“:
„So bleibt es immer ein Skandal der Philosophie und allgemeinen Menschenvernunft, das Dasein außer uns (…) bloß auf Glauben annehmen zu müssen und, wenn es jemandem einfällt es zu bezweifeln, ihm keinen genugtuenden Beweis entgegenstellen zu können.“
Kant versuchte deswegen, das Feld unseres möglichen Wissens abzustecken und die Grenzen der Vernunft aufzuzeigen, um so Klarheit zu schaffen. Ihn interessiert dabei vor allem die Frage, ob wir allgemeine und notwendige Erkenntnisse unabhängig von unseren individuellen Erfahrungen haben können. Er nennt das Erkenntnisse a priori, das heißt vor aller Erfahrung. Und Kant sagt, dass das möglich ist. Denn alles, was wir erkennen, erkennen wir beispielsweise in Raum und Zeit. Wir können uns ein vorbeifahrendes Auto nicht ohne seine Ausdehnung im Raum vorstellen. Und ebensowenig können wir seine Bewegung wahrnehmen ohne die Vorstellung eines zeitlichen Flusses. Raum und Zeit sind so gesehen Bedingungen, durch die wir überhaupt erkennen können. Und weil diese ordnenden Prinzipien wie Raum und Zeit unserem Verstand quasi immer anhaften, können wir allgemeine und notwendige Aussagen treffen wie die, dass alle Dinge in Raum und Zeit stattfinden oder dass jede Veränderung eine Ursache haben muss.
So können wir also über die meisten Gegenstände unserer Erfahrung Erkenntnisse a priori haben. Marcus Willaschek: „Also nach Kant sind alle Dinge, mit denen wir im Alltag so zu tun haben, also Gegenstände wie Tische und Stühle, Menschen, Häuser, geprägt durch die subjektiven Bedingungen von Erkenntnis. Und über diese Dinge können wir auch apriorisches Wissen haben, zum Beispiel, dass sie in Raum und Zeit existieren müssen. Oder das sie in kausalen Beziehungen stehen müssen, und dass diese kausalen Beziehungen die Dinge mit Notwendigkeit verknüpfen. Wir können aber nichts wissen über die Dinge an sich, die Dinge unabhängig von unserer Erkenntnis.“
Skepsis über die Frage, wie es um unser Wissen bestellt ist, kam und kommt auch immer wieder in den Naturwissenschaften auf. Der Wissenschaftsphilosoph Thomas S. Kuhn etwa vertrat die Ansicht, dass die Naturwissenschaften Wissen nicht in einem gleichmäßigen Prozess ansammeln, sondern dass es in ihrer Entwicklung immer wieder Revolutionen gibt, bei denen schlagartig neue Paradigmen die Herrschaft übernehmen und dann bis zur nächsten Revolution gelten. Ein solcher Paradigmenwechsel etwa wäre die kopernikanische Wende, nach der nicht mehr die Erde im Zentrum des Universums stand, sondern die Sonne. Oder der Sprung von der Physik Newtons zur Relativitätstheorie Albert Einsteins. Allerdings gelten auch nach solchen Revolutionen bestimmte Erkenntnisse und Ansichten in den Wissenschaften weiter. Deswegen geht man heute davon aus, dass das Kuhnsche Modell zumindest in seiner strengen Version nicht gilt.
Können wir also davon ausgehen, dass die Naturwissenschaften uns verlässliches und sicheres Wissen liefern? Markus Schrenk, Philosoph an der Universität Köln, der gerade ein Buch über die Metaphysik der Naturwissenschaften geschrieben hat, meint: „Es kommt immer drauf an, wie hoch der Maßstab ist, den man anlegt. Und wenn man den Maßstab der Rationalisten anlegt, dass alles absolut unerschütterliches Wissen sein muss, dann ist das etwas, was wir auch durch die beste Naturwissenschaft nicht erreichen können. Aber wenn man den Wissensbegriff oder die Anforderungen daran, was Wissen bedeutet, etwas herunter schraubt, dann ist naturwissenschaftliches Wissen doch sehr verlässliches Wissen.“
Und das scheint auch der Stand der Dinge zu sein in den meisten philosophischen Diskursen um die Frage nach unserem Wissen: Wenn man den Wissensbegriff sehr anspruchsvoll und streng auffasst, Wissen als etwas Unerschütterliches versteht, dann wird es sehr schwierig, solches Wissen stringent und plausibel zu rechtfertigen. Die meisten Philosophen heute würden sich deswegen wohl als „Fallibilisten“ bezeichnen. Schon der Name sagt es – sie nehmen an, dass wir in allem, was wir zu wissen glauben, fehlbar sind. Fallibilisten gehen zwar davon aus, dass wir durchaus Wissen erlangen können und das auch gut begründen können. Allerdings müssen wir unsere Rechtfertigungen immer wieder prüfen, und wenn nötig, durch neue Einsichten und Erkenntnisse ergänzen oder ersetzen. Auch in den Naturwissenschaften hat sich diese Sichtweise durchgesetzt. Unerschütterlich ist Wissen nach heutigem Stand daher nicht. Doch gute Gründe können als Maßstab dafür dienen, ob wir etwas als Wissen einstufen oder nicht.
Und das gilt nach Ansicht von Thomas Grundmann dann sogar für Glaubensüberzeugungen: „Von Kant überkommen ist das Diktum, dass er das Wissen in Grenzen setzt, um für Glauben Platz zu schaffen. Und das hört sich so an, als ob es einen Bereich in der Welt gibt, über den wir exaktes Wissen haben können; alles andere bleibt offen, und damit sind wir frei, zu glauben was immer wir wollen. Das scheint mir ein falsches Bild zu sein. Denn ich glaube, dass Glauben, sei es religiöser Glaube oder Für-Wahr-Halten, ein einheitliches Phänomen ist. Da gibt es nicht zwei verschiedene Dinge. Und Für-Wahr-Halten ist immer gewissen epistemischen Normen verpflichtet. Wir dürfen nicht einfach glauben, was wir wollen, sondern wir sollten nur das glauben, wofür wir gute Gründe haben. Sobald man also anerkennt, dass man über den Bereich des Göttlichen oder Transzendenten gar kein Wissen und keine guten Gründe mehr hat, dürfte man streng genommen auch nicht mehr glauben. Und jetzt sieht man: Es ist nicht wahr, dass in der Religion alles geht. Und sollten wir zu dem Ergebnis kommen, dass es hier kein Wissen geben kann und nicht mal gut begründete Annahmen, dann wird es schwer zu rechtfertigen, dass man hier Glauben hat.“
Wissen wir also mehr als wir glauben? Oder glauben wir mehr als wir wissen? Die Frage scheint sich am Ende aufzulösen: beide Begriffe hängen offenbar zusammen und sind keine Gegensätze. Glauben (im Sinne von für wahr halten) ist die Voraussetzung für jede Form von Wissen. Und Wissen gehört immer auch zum Glauben dazu.