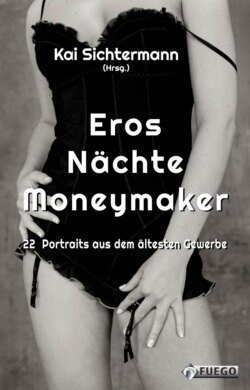Читать книгу Eros Nächte Moneymaker - Kai Sichtermann - Страница 8
ОглавлениеNeaira
Die griechische Hetäre
Woher Neaira kam, ist unbekannt. Es gibt darüber nur vage Vermutungen; manche meinen, sie könnte ein Findelkind gewesen sein, andere halten es für wahrscheinlicher, dass sie aus einem der Randgebiete Griechenlands stammte, möglicherweise aus Thrakien. Ihr Geburtsjahr war um 400 vor Christus. Gesichert ist die Erkenntnis, dass sie als Kind im jungen Alter von nur zwölf Jahren auf einem Sklavenmarkt von einer Bordellbesitzerin gekauft und zu einer Luxus-Hure, einer Hetäre ausgebildet wurde. Über ihr Leben wissen wir nur deshalb etwas, weil sie durch einen Prozess zur tragischen Figur wurde. Sie geriet zwischen die Fronten eines Streites zweier Männer: auf der einen Seite Stephanos, mit dem Neaira zusammenlebte, und auf der anderen Apollodoros – beide führten eine langjährige Dauerfehde. Nachdem Stephanos seinem Gegner eine gerichtliche Niederlage zugefügt hatte, sann der Verlierer auf Rache und verklagte seinerseits seinen Intimfeind. Apollodoros behauptete nun, Stephanos, als freier Athener Bürger, hätte mit Neaira eine Fremde geehelicht, was per Gesetz verboten war. Außerdem hätte das Paar so versucht, für ihre Kinder das Athener Bürgerrecht zu erschleichen. Dazu erstellte Apollodoros eine lange Anklageschrift über die angeblich sündhafte Lebensgeschichte Neairas. Diese Klageschrift wurde zwischen 343 und 340 v. Chr. gehalten und ist uns als Gerichtsrede überliefert. Sie bildet das Grundwissen über Neaira.
Bereits im 4. Jahrhundert vor Christus hatte Griechenland demokratische Gesellschaftsstrukturen und gilt deshalb bis heute als das Mutterland der Demokratie. Das griechische Wort Demokratie heißt übersetzt „Volksherrschaft”. Doch da schon in der Vokabel „Herrschaft” das Wort „Herr” steckt, verwundert es kaum, dass es zwischen Männern und Frauen keine Gleichberechtigung gab. Die Männer im Griechenland der Antike hatten ein anderes Demokratieverständnis als wir bei uns heute. In der Volksversammlung von Athen hatten nur männliche Bürger ein Stimmrecht. Ebenso ausgeschlossen waren die Sklaven. Wer also eine Frau und obendrein noch Sklavin war, hatte ziemlich schlechte Karten. Eine Möglichkeit ihr Blatt zu verbessern, bestand für Frauen darin, den Weg einer Hetäre zu wählen. Das Wort Hetäre ist altgriechisch und stammt von „hetaire” ab, das bedeutet „Freund” oder „Genosse”; sinngemäß wäre „Gefährtin” eine passende Übersetzung. Eine Hetäre zu sein, brachte zwar kein Wahlrecht, dafür aber soziale Anerkennung und eine verbesserte Lebenssituation. Einfache Huren hatten es dagegen deutlich schlechter, wie die Wörter, mit denen sie belegt wurden, vermuten lassen: „öffentlicher Durchgang”, oder gar „Zisterne”, als Andeutung zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten, so der griechische Lyriker Anakreon in diesem Kontext.
Doch der Weg des Aufstiegs war schwierig. Obwohl es später sogar Hetärenschulen gab, mussten sich Hetären innerhalb der Gesellschaft nach oben kämpfen, sie erkauften sich die Freiheit, eroberten die Literatur und trainierten ihre Körper. Das gelang ihnen mithilfe der einflussreichsten Männer ihrer Zeit, führt Nils Johan Ringdal in seinem Buch „Die neue Weltgeschichte der Prostitution” aus, und beschreibt sie als gebildete, elegante und sexuell freizügige Frauen, die mehr Freiheit als die Ehefrauen der Bürger hatten und in der Öffentlichkeit allgemein bekannt waren. Auch ihr erworbenes Wissen über Kunst und Philosophie unterschied sie von bürgerlichen Ehefrauen, was besonders zeitgenössische Künstler schätzten, die sich nicht selten von ihnen inspirieren ließen. Trotz all dieser Vorzüge gab es auch einen Nachteil, wie Lukian von Samosata, ein griechischer Satiriker in seinem Werk „Hetärengespräche” zu berichten wusste: Ungeachtet dessen, dass der Hetärenstand gewissermaßen privilegiert war, so war er doch, nicht weniger mit einem bürgerlichen als sittlichen Makel behaftet.
Die bekanntesten griechischen Hetären lebten alle im 4. Jahrhundert vor Christus. Sokrates, einer der großen griechischen Philosophen, suchte die Nähe der Hetäre Aspasia, von der manche behaupten, sie sei weniger eine Hetäre, als vielmehr die Konkubine – eine Ehefrau ohne Trauschein – des Staatsmannes Perikles gewesen. Alexander der Große ließ sich bei seinem Feldzug gegen Persien von der Hetäre Thaïs begleiten. Von Phryne wird berichtet, sie sei eine so wunderschöne Hetäre gewesen, dass der attische Bildhauer Praxiteles sie als Modell für keine Geringere als die Liebesgöttin engagierte, um seine berühmte Statue „Aphrodite von Knidos” zu erschaffen. Und von Lamia, einer Hetäre aus Athen erzählt man, dass sie die Geliebte von zwei Königen gewesen sei, zuerst in Alexandria, später dann in Mazedonien.
Korinth, ein Handelszentrum am Isthmus, war damals zusammen mit Athen und Sparta eine der größten Städte in Griechenland und galt als Hochburg der Prostitution. Dort lebte Nikarete, jene Bordellbesitzerin, die Neaira gekauft hatte. In ihrem Haus empfing sie überwiegend gut situierte Kunden und führte sie ihren Liebesdienerinnen zu. Um dem Ansehen ihres Hauses alle Ehre zu machen und damit Höchstpreise zu erzielen, bildete sie ihre Sklavinnen zu Hetären aus, denn die kosteten bis zu hundert mal mehr als ihre Kolleginnen niedrigeren Standes. Zudem gab Nikarete Neaira und andere junge Frauen für ihre Töchter aus, was deren Ansehen und damit den Preis noch einmal steigerte.
Zur „Hetären-Ausbildung” gehörten neben den erwähnten künstlerischen Fertigkeiten natürlich auch verschiedene Sexpraktiken sowie Schönheits- und Körperpflege. Neaira war gelehrig und erreichte bald den Status einer begehrenswerten Hetäre, die viele Männer anlockte, von denen einige ihre Stammkunden wurden, unter ihnen Dichter und Schauspieler. Doch sie blieb eine Sklavin ohne Rechte. Nicht nur ihre Dienstleistungen waren eine Ware, die gekauft werden konnte, auch sie selbst konnte verkauft werden.
Im Jahre 376 – es mochten wohl zwölf Jahre vergangen sein, in deren Verlauf Neaira erfolgreich als Hetäre im Korinther Bordell tätig war – überlegten sich die beiden Stammkunden Timanoridas und Eukrates, ob es auf Dauer nicht billiger wäre, Neaira zu kaufen, als sie nur zu mieten. Da das Objekt ihrer Begierde seine Jugendblüte bereits verloren hatte, war Nikarete bereit, ihre Sklavin zu verkaufen. Allerdings verlangte sie den stolzen Preis von 3000 Drachmen, zehnmal so viel, wie bei gewöhnlichen Sklaven. Diese hohe Summe betrug mehr als das fünffache Jahreseinkommen eines einfachen Arbeiters. Trotzdem schlugen Timanoridas und Eukrates ein. Für Neaira begann nun ein angenehmeres Leben. Sie war die Privatsklavin wohlhabender Besitzer, und das war auf jeden Fall besser, als in einem Bordellbetrieb anschaffen zu müssen. Doch da Eigentum verpflichtet, erkannten die neuen Herren nach zwei Jahren, das eine Hetäre zu unterhalten, auch nicht gerade billig war. Sie boten daher ihrer Sklavin an, sich für 2000 Drachmen freizukaufen, unter der Bedingung, dass sie Korinth für immer verließe. Denn auf Dauer litt auch der sittliche Ruf von Timanoridas und Eukrates, und als sie selbst heiraten wollten, erklärten sie Neaira, sie wollten nicht, dass sie, die Hetäre gewesen war, dieses Gewerbe sichtbar in Korinth ausübe, so Apollodoros in seine Rede. Neaira willigte ein, trieb mit Unterstützung einiger Ex-Liebhaber die geforderte Summe auf und kaufte sich frei. Den größten Batzen steuerte der Stammkunde Phrynion bei, mit dem sie zusammen nach Athen ging.
Neairas Leben in Freiheit verlief wohl nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatte. Apollodoros berichtet, dass Phrynion einen verschwenderischen Lebenswandel führte, und Neaira sehr unzüchtig und schamlos benutzte, überall mit ihr zu Gelagen zog, wo immer er zechte, und sie an all den Umzügen der Zecher teilnahm. Auch hatten viele Gäste Geschlechtsverkehr mit ihr, als sie betrunken war, sogar die Sklaven. Im Winter 373/372 hatte sie wahrscheinlich von ihrem einstigen Gönner und dessen Ausschweifungen genug, denn sie packte manches seiner Habe aus dem Haus ein, drunter all die Kleidung und den Goldschmuck, den sie von ihm erhalten hatte, nahm dann zwei Sklavinnen mit, und lief nach Megara davon.
In Megara, einer Hafenstadt, nicht weit von Athen gelegen, arbeitete sie wieder als Hetäre, um zu überleben. Doch es waren unruhige, kriegerische Zeiten, und die Geschäfte liefen schlecht. Am liebsten wäre sie nach Athen zurückgekehrt, aber sie fürchtete dort den Zorn des geprellten Phrynion. Da muss Neaira die Begegnung mit Stephanos gerade recht gekommen sein. Apollodoros: Als dann dieser Stephanos hier in Megara eintraf, kehrte er bei ihr als einer Hetäre ein und kam ihr nahe, machte ihr Mut, dass es dem Phrynion schlimm ergehen solle, wenn er Hand an sie lege: Er aber wolle sie als seine Frau halten und auch ihre Kinder, die sie damals hatte, und sie zu Bürgern machen. So geschah es. Stephanos nahm Neaira mit in seine Heimatstadt und natürlich kam es dann zwischen Stephanos und Phrynion zu der befürchteten Auseinandersetzung. Doch nach einigen Verhandlungen konnten sie sich letztendlich mithilfe privater Schlichter friedlich einigen.
Hoffen wir für Neaira, dass die nächsten zweieinhalb Jahrzehnte, in denen sie mit Stephanos und den drei Kindern in gutbürgerlichem Haushalt zusammenlebte, nicht so verliefen, wie sich aus den Worten Apollodoros vermuten lässt: Aus zwei Gründen hatte Stephanos Neaira mit nach Athen gebracht: erstens, um ohne alle Kosten eine schöne Hetäre zu haben, und zweitens, damit sie ihm durch ihr Gewerbe seinen Unterhalt verschaffe und das Haus erhalte. Er hatte nämlich sonst keine Einkünfte. Zweifel an dieser Aussage sind angebracht, denn Apollodoros wollte natürlich seinen Widersacher und dessen Lebensgefährtin in möglichst negativem Licht erscheinen lassen. Leider ist der Ausgang des Prozesses nicht überliefert, auch nicht, wie es Neaira später noch erging. Doch immerhin verdanken wir der Dauerfehde zweier Athener Bürger, dass Apollodoros seine Anklage verfasste. Und dieser hat zu Lebzeiten sicher nicht geahnt, dass er Neaira damit zu einer der berühmtesten Hetären des Altertums machte.
Quellen:
Debra Hamel, „Der Fall Neaira. Die wahre Geschichte einer Hetäre im antiken Griechenland”, Darmstadt 2004
Kai Brodersen, „Antiphon, gegen die Stiefmutter und Apollodoros, gegen Neaira (Demosthenes 59). Frauen vor Gericht”, Darmstadt 2004
Nils Johan Ringdal, „Die neue Weltgeschichte der Prostitution”, München 2006