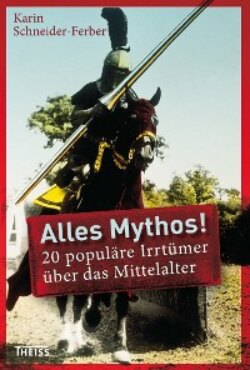Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über das Mittelalter - Karin Schneider-Ferber - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der mächtige Kaiser herrschte unumschränkt über das Abendland
ОглавлениеWelch ein Spektakel in der Peterskirche zu Rom an diesem 2. Februar 962: Mitten in der Kirche, genau über dem Grab des heiligen Apostels Petrus, kniet der sächsische Herrscherspross König Otto I., tief versunken im Gebet. Er weiß, dieser Moment wird der Höhepunkt seines Lebens sein. Dann nimmt Papst Johannes XII. eine prunkvolle Krone in die Hand und drückt sie dem Knieenden, begleitet von liturgischen Hymnen, sanft aufs Haupt. Als sich der Sachse nach Salbung und Krönung in seinem schweren Prunkornat wieder erhebt, darf er sich unter den Akklamationsrufen des römischen Volkes seines Triumphes sicher sein – er ist nun Kaiser und damit ranghöchster Monarch im westlichen Abendland, eine Ehre, die außer ihm sonst keiner für sich verbuchen kann.
Welche Faszination ging doch von dieser schimmernden Kaiserkrone aus. Zwischen den Jahren 800 und 1519 ließen sich insgesamt dreißig gekrönte Häupter mit dieser kaum fassbaren Aura des Sakralen zusätzlich überhöhen. Die Auszeichnung durch den Bischof von Rom, als Nachfolger des Apostels Petrus geistliches Oberhaupt der westlichen Christenheit, verlieh der weltlichen Herrschaft des Königtums religiöse Legitimation. Gleichzeitig weckte die Berufung auf das längst untergegangene Weltreich der Römer Sehnsüchte nach einer imaginären Universalherrschaft. Ach, das wäre schön gewesen: Einmal herrschen wie die antiken Imperatoren! Ausgestattet mit diktatorischen Vollmachten, umjubelt von den römischen Massen, residierend auf einem der sagenumwobenen sieben Hügel Roms – diesen Traum hegten so gut wie alle Herrscher des Mittelalters. Welchen Ruhm bot doch der altehrwürdige und alles überragende Titel „Imperator Augustus“ und „Kaiser der Römer“! Doch vom Glanz der Antike fiel für die Herrscher des Hochmittelalters allenfalls noch die Patina ab. Denn so sehr der Mythos „Rom“ auch lockte, die Welt hatte sich seit dem Untergang des römischen Weltreichs drastisch gewandelt. Auf dem Schachbrett der Macht standen nicht mehr Volk und Senat von Rom als bestimmende Faktoren, sondern die landbesitzenden Großvasallen des deutschen Königs, der Papst als Verleiher des Kaisertitels und die selbstbewussten Adelsgeschlechter Roms mit ihrem Hang zur Rebellion.
Ein Realist wie der Geschichtsschreiber Brun von Querfurt erkannte bereits um die Jahrtausendwende messerscharf, dass sich die deutschen Könige mit ihrer Italienpolitik nur Scherereien einhandelten. „Er mühte sich zwecklos ab“, schrieb er über die hochfliegenden Herrschaftspläne Kaiser Ottos III., „den erstorbenen Glanz des altersmorschen Rom aufs Neue zu beleben.“ Die deutschen Gefolgsleute des Kaisers seien verschnupft gewesen ob Ottos diffuser Rombegeisterung und die Italiener hätten nichts als Untreue im Sinn gehabt. In der Tat war es ein mühseliges Geschäft, Kaiser zu sein. Denn ein realer Machtzuwachs war mit dem Erwerb der Kaiserkrone nicht verbunden. Die Italienpolitik verstrickte die hohen Herren aus dem Norden nur tief in die inneritalienischen Händel und in die kirchlichen Angelegenheiten, was zur tödlichen Falle werden konnte. Wer Kaiser werden wollte, brauchte daher ein gutes Nervenkostüm, eine solide Machtbasis im Reich und nicht zuletzt eine große Portion Glück, um sich in diesem Machtpoker durchzusetzen.
Wer wählte den Kaiser? Zuallererst einmal jene heimischen Fürsten, die den deutschen König kürten. Sie waren sozusagen die Asse im Spiel um die Kaiserkrone. Bis zum Ende des Mittelalters nahmen die Großvasallen des Reiches ihr Recht auf die Königswahl wahr und verteidigten es hartnäckig mit Klauen und Zähnen. Der König des „Heiligen Römischen Reiches“, so der seit Mitte des 13. Jahrhunderts übliche Titel für das vielschichtige, aus dem ehemals ostfränkischen Reichsteil hervorgegangene und um Burgund und Norditalien erweiterte Gebilde im Herzen Europas, regierte auf Grund der freien Zustimmung seiner Lehnsmänner als ein „Gleicher unter Gleichen“. Diese auf persönliche Bindungen beruhende Herrschaftsordnung ging von vornherein zu Lasten der Zentralmacht. Sie machte es nötig, dass sich der König ständig seiner Vasallen versichern und sie durch die Vergabe von Land und Privilegien bei Laune halten musste. Von einer unabhängigen, souveränen Herrschaft des Königs im Reich konnte gar keine Rede sein, obwohl es immer wieder Ansätze von Seiten des Königtums gab, die selbstbewussten Herrschaften unter die eigene Knute zu zwingen.
König Otto I., den man später den „Großen“ nannte, machte es vor: Die Feierlichkeiten zu seiner Königskrönung in Aachen im Sommer 936 nutzte er zu einer beispiellosen Machtdemonstration. Der 24-Jährige ließ sich beim Krönungsmahl von den Fürsten seines Reiches bedienen. Herzog Giselbert von Lothringen wartete als Kämmerer auf, Eberhard von Franken als Truchsess, der bayerische Herzog Arnulf versah als Marschall seine Pflichten, und Hermann von Schwaben betätigte sich als Mundschenk. Ein schönes Bild, doch nicht viel mehr als bloße Propaganda. Denn zum Dienen fühlte sich keiner der hohen Herren auf Dauer berufen. Als Otto I. kurz darauf einige unbequeme politische Entscheidungen traf, gingen seine Großvasallen im Bund mit einigen unzufriedenen Mitgliedern des Ottonen-Clans auf die Barrikaden und zettelten Aufstände an, die den jungen König an den Rand der Katastrophe brachten. Erst nach vielen blutigen Schlachten konnte er sich in der Herrschaft behaupten. Nicht viel besser erging es seinem späteren Nachfolger aus dem Geschlecht der Staufer, Friedrich Barbarossa. Auch er stürzte in eine tödliche Auseinandersetzung mit einem seiner Großvasallen, dem mächtigen Welfenherzog Heinrich dem Löwen, der als Herzog von Sachsen und Bayern eine wesentlich breitere Machtbasis besaß als der in Schwaben begüterte Stauferkönig. Kniefällig soll Barbarossa 1176 bei einer persönlichen Unterredung am Comer See den Welfen um militärische Unterstützung für seinen Kampf gegen die oberitalienischen Städte gebeten haben, eine Szene, die Kaiserin Beatrix als äußerste Demütigung empfand.
Gerade für ihre Italienpolitik benötigten die Monarchen die Unterstützung ihrer Gefolgsleute in besonderem Maße. Die Züge über die Alpen waren kostspielige und risikoreiche Unternehmen, die eine lange Abwesenheit der Vasallen von ihren heimischen Gütern mit sich brachten. Und was gab es für sie schon zu holen in Italien? Sie schlugen sich für eine fremde Krone, von der sie selbst nichts hatten. Der Ausbau ihrer eigenen Territorien lag ihnen da viel näher, und so ließen sie sich ihre Unterstützung denn auch teuer bezahlen. Heinrich der Löwe präsentierte bei besagter Unterredung am Comer See seinem König auch gleich die Rechnung: Er hatte es auf die reichen Silbergruben der Reichsstadt Goslar abgesehen. Wie Teppichhändler schacherten die Reichsfürsten im Laufe der Jahrhunderte um Rechte und Privilegien, bis sie eine solide Landesherrschaft aufgebaut hatten. Friedrich Barbarossas Enkel, Kaiser Friedrich II., bestätigte ihnen 1232 offiziell weitreichende Hoheitsrechte in ihren Herrschaftsgebieten. „Ein jeder Fürst habe freien Gebrauch seiner Freiheiten, Gerichtsbefugnisse, Grafschaften und Zehnten, nach den Gewohnheitsrechten seines Landes, sie seien sein Eigentum oder ein Lehen.“ Damit war eine zukunftsträchtige Entwicklung eingeleitet. Denn auf Grund ihrer Vollmachten gelang es den Fürsten, unabhängige Landesherrschaften aufzubauen und sich zu mächtigen Territorialherren aufzuschwingen.
Die „Goldene Bulle“ von 1356, das bedeutendste Verfassungsdokument des Spätmittelalters, beschränkte den Kreis der Königswähler schließlich auf jene sieben mächtigen Territorialherren, deren Stellung eng mit den Erzämtern des Reiches verbunden war. Zum illustren Kreis der Kurfürsten zählten die drei Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier, die traditionellerweise als Erzkanzler für Deutschland, Italien und Burgund amtierten, der Herzog von Sachsen, der die Würde eines Erzmarschalls innehatte, der Markgraf von Brandenburg in seiner Eigenschaft als Erzkämmerer, der Pfalzgraf bei Rhein, der seit alters das Amt des Erztruchsesses versah, und der König von Böhmen als Erzmundschenk. Sie sollten in einem genau festgelegten Wahlmodus nach dem Mehrheitsprinzip den neuen König küren. Als Wahlort wurde Frankfurt am Main auserkoren, als Krönungsort war Aachen vorgesehen. So schloss sich der Bogen schon zur Zeit Ottos des Großen, als dieser beim Krönungsmahl eben diese sieben herausragenden Vasallen in den Dienst des Königtums einzuspannen gedachte. Mochte Otto noch gehofft haben, sie der Macht der Krone unterordnen zu können, so zeigte die Zukunft eine ganz andere Entwicklung.
Der Drang nach Italien und die daraus entstehenden Belastungen wie die lange Abwesenheit der Könige von Deutschland haben langfristig betrachtet das Königtum geschwächt und die Fürstenmacht gestärkt. Die Kurfürsten nahmen für sich sogar das Recht in Anspruch, einen „unfähigen“ König wieder abzusetzen, wie es der Sohn Karls IV., Wenzel, genannt der „Faule“, erleben musste. Er wurde im Jahr 1400 als „unnütz“, „untätig“ und „ungeschickt“ per Fürstenspruch einfach seines Amtes enthoben. Kaiserglanz hin oder her – der Lack war ab, wenn es um handfeste Realpolitik ging. Die Kurfürsten fühlten sich seit dem Spätmittelalter als die wahren „Säulen des Reiches“, die gemeinsam mit dem König die Regierungsgeschäfte führten. Kaiser Karl IV. musste sie in der „Goldenen Bulle“ weiter privilegieren, ihnen die Erblichkeit und Unteilbarkeit ihrer Kurfürstentümer sowie das Recht der Primogenitur, der Nachfolge des erstgeborenen Sohnes, zusichern. Von solchen komfortablen Zuständen konnten die Könige selbst indes nur träumen. Sie erreichten im Reich nie jene Machtstellung, die ihre Vasallen in den Fürstentümern innehatten, schon gar nicht die Erblichkeit der Königswürde innerhalb einer Dynastie. Nur in ihrer Eigenschaft als Landesherren war es ihnen möglich, eine wahrhaft „königliche“ Stellung zu ergattern – eine Möglichkeit, von der später vor allem die Habsburger Gebrauch machten.
Im Vergleich zu seinen mächtigen Magnaten nahm sich der deutsche König fast wie ein armes Hascherl aus. Jedesmal, wenn er einen Romzug plante, musste er feilschen gehen, und wenn er seinen Sohn zum Nachfolger küren lassen wollte, das Portemonnaie öffnen. Anders als seine Amtskollegen in Frankreich oder England konnte er nie seine Macht zentralisieren, sich in einer festen Residenz niederlassen und sich auf feste Einnahmen aus dem Reich verlassen. Er war ein Herrscher mit leeren Taschen, dem nichts anderes übrig blieb, als rastlos durch die Lande zu reisen, um bei seinen Großen gut Wetter zu machen. Mit Kind und Kegel, Hofleuten und Verwaltungsbeamten, Reichskleinodien und Staatsschatz zog der Monarch von Pfalz zu Pfalz, von Stadt zu Stadt. Je nachdem, wo die Eigengüter einer Dynastie lagen, bildeten sich verschiedene Schwerpunkte heraus. Die Ottonen bevorzugten die Herzogtümer Sachsen, Franken und Lothringen als Aufenthaltsorte, darunter besonders die Städte Magdeburg, Quedlinburg, Ingelheim, Köln und Aachen, die Salier hielten sich lieber in Bayern, Schwaben oder dem Elsass auf, die Staufer pendelten zwischen Mainz, Würzburg und Nürnberg hin und her und errichteten neue Pfalzen in Kaiserslautern, Wimpfen oder Eger. Der Luxemburger Karl IV. liebte Prag und Nürnberg, und den Habsburger Maximilian I. nannte man gar scherzhaft den „Bürgermeister von Augsburg“, weil er sich so gerne in der Stadt seines Bankiers Jakob Fugger aufhielt.
Die Reiserei ging nicht nur dem König und seinem Hof gewaltig auf die Nerven, sondern auch all jenen, die sie aufnehmen mussten. Das waren in der Regel die königlichen Pfalzen, zunehmend aber auch die Reichsabteien und Bischofssitze, die zur Aufnahme und Verpflegung des Hofes verpflichtet waren. Welch große Belastungen dabei auf die Gastgeber zukommen konnten, verdeutlicht eine Nachricht über den Bedarf des ottonischen Hofes: Demnach verzehrte die feierlaunige Festgesellschaft Ottos des Großen an einem Tag tausend Schweine und Schafe, zehn Fuder Wein und ebensoviel Bier, tausend Malter Getreide, acht Ochsen und ungezählte Hühner und Ferkel samt Fischen, Eiern und Gemüse. Auch wenn dies ein Ausnahmefall gewesen sein mag, so lässt sich daran doch ablesen, welche Schwierigkeiten es mit sich brachte, den König und seinen Hofstaat standesgemäß durchzufüttern. Denn Festessen waren schließlich auch Akte der Repräsentation, bei denen keinesfalls gespart werden durfte. Die ungebetenen Gäste verabschiedete man daher am besten recht schnell wieder, sodass der König meist nicht länger als ein paar Tage oder Wochen an einem Ort weilte. Pech für die Gastgeber, wenn er dann auch noch Schulden hinterließ wie Kaiser Maximilian I., der sich beständig in Geldnöten befand und bei seiner Abreise schon mal seine abgehalfterte Ehefrau als Pfand für seine Schulden hinterließ …
Der Mangel an regelmäßigen Einnahmen blieb stets das größte Problem der königlich Gesalbten. Es gab kein stehendes Reichsheer, keine allgemeine Steuer, keine verbrieften Reichsrechte, auf die sie hätten zurückgreifen können. Maximilian I. unternahm 1495 einen Versuch, einen „Gemeinen Pfennig“, eine allgemeine Reichssteuer, einzuführen, scheiterte damit aber kläglich. Wenn er Geld wollte, musste er seine Stände fragen. Zu den verlässlichsten Stützen der Königsherrschaft im Reich zählten in der Regel die Kirche und die aufstrebenden Städte, die sich vom König Friedenswahrung und Friedenssicherung erhofften und ein Gegengewicht zu den selbstbewusst und eigennützig auftretenden Adelsgeschlechtern boten. Nicht umsonst stiegen Bischofsstädte wie Mainz oder Augsburg oder mächtige Reichsstädte wie Nürnberg zeitweise zu heimlichen „Zentralen“ des Reiches auf.
War schon das Regieren auf Reichsebene ein schweres Geschäft, so verkomplizierte sich die Lage noch, wenn der König die Kaiserkrone anstrebte. Hatte er endlich einmal alle Vasallen hinter sich geschart und für einen Romzug eingespannt, war noch lange nichts gewonnen. Denn nun trat jene Figur auf den Plan, der die Rolle eines Jokers im Kronen-Poker zukam: der Papst. Als Nachfolger des heiligen Apostels Petrus hielt er das Exklusivrecht an der Kaiserkrönung. Begründet wurde dieser Anspruch mit der folgenschweren Tat Papst Leos III., der am Weihnachtstag des Jahres 800 dem Frankenherrscher Karl dem Großen in der Peterskirche die Krone aufs Haupt gesetzt hatte. Schon beim Übergang der Königsmacht von der Dynastie der Merowinger auf die Karolinger Mitte des 8. Jahrhunderts hatte das Papsttum eine tragende Rolle gespielt und die karolingischen Hausmeier dazu ermuntert, die Macht im Reich zu übernehmen. Der Ansturm der Langobarden in Italien ließ die Päpste – von den in Byzanz residierenden oströmischen Kaisern alleingelassen – nach anderen Partnern Ausschau halten, die sie in dem dynamischen Geschlecht der Karolinger nördlich der Alpen fanden. So nahm sich das Papsttum das Recht heraus, einen neuen Schutzherrn für das bedrohte Rom zu berufen und das in den Wirren der Völkerwanderungszeit untergangene westliche Kaisertum zu erneuern. Es reservierte sich dafür die weltliche Herrschaft über den damals freilich noch recht kleinen Kirchenstaat.
Der Frankenherrscher Karl witterte bereits die päpstlichen Ansprüche, die sich aus der Kaiserkrönung ergaben, und zeigte sich über den Akt in der Peterskirche gar nicht begeistert. Doch einmal in die Welt gesetzt, waren die Rechte des Petrus-Nachfolgers nicht mehr so leicht zu beschneiden. „Der Papst macht den Kaiser“ – dieser Grundsatz galt seit dem denkwürdigen Weihnachtstag des Jahres 800. Nach einer Periode des Verfalls unter den späten Karolingern erneuerte Otto der Große 962 die Kaiserwürde und brachte diese dadurch dauerhaft an das deutsche Königtum. Der Kaiserkrönung gingen in der Regel komplizierte Verhandlungen voraus, denn die Päpste waren zwar durchaus an einem machtvollen Schutzherrn interessiert, der ihnen ihre Widersacher in Italien vom Leibe hielt, doch einen allzu dominanten Herrn wollten sie sich auch nicht ins Haus holen. So lange die gekrönten Häupter gegen Langobarden, Normannen oder aufmüpfige italienische Magnaten kämpften, waren sie willkommen, so bald sie sich aber in Angelegenheiten der Kirche einmischten oder die weltliche Herrschaft des Papstes bedrohten, wurden sie zu tödlichen Rivalen. Schon Otto der Große musste vor seiner Kaiserkrönung in einem Vertrag, dem sogenannten „Ottonianum“, einer prachtvollen Purpururkunde, den päpstlichen Besitz garantieren. Dafür leistete ihm der Papst ein Treueversprechen und räumte für die Zukunft den Kaisern ein gewisses Mitspracherecht bei der Papstwahl ein.
Misstrauen und Argwohn prägten das Verhältnis der beiden höchsten Repräsentanten der Christenheit von Anfang an. Neidisch wachten beide Seiten auch über ihren ideellen Vorrang. Machtvolle Kaiser wie der Salier Heinrich III. setzten Päpste nach Gutdünken ein und ab, wie sie es auch mit ihren Reichsbischöfen taten, selbstbewusste Päpste wie Gregor VII. betonten dagegen den Vorrang der geistlichen vor der weltlichen Macht. Gegenseitige Absetzungen, Exkommunikationen und Bannflüche begleiteten die Auseinandersetzungen, die die abendländische Christenheit zutiefst spalteten. Die Demütigung Heinrichs IV. im Gang nach Canossa im Jahr 1077 führte als spektakulärer Höhepunkt des Machtkampfs zwischen Kaiser- und Papsttum zu einem gewaltigen Ansehensverlust des Königtums. Stundenlang harrte Heinrich mitten im Winter im Büßergewand vor der oberitalienischen Burg Canossa aus, um sich vom Bannfluch Gregors VII. zu lösen. Aus dem Ringen des Investiturstreits ging das Papsttum letztendlich gestärkt hervor, gelang es ihm doch, den Einfluss der Krone auf die Besetzung der Bistümer und Abteien, die zu den stärksten Stützen der königlichen Gewalt im Reich zählten, zu begrenzen.
Von ihrer Italienpolitik ablassen wollten die deutschen Könige dennoch nicht. Die schimmernde Aura eines sakral überhöhten Kaisertums lockte sie nach wie vor nach Rom, obwohl sie dort auch weiterhin keine barmherzigen Jünger auf dem Stuhle Petri antrafen, sondern äußerst machtbewusste Persönlichkeiten. Das Papsttum postulierte im Hochmittelalter eine Art Universalherrschaft über die katholische Christenheit und untermauerte diese mit einem handfesten Ausbau des Kirchenstaates in Italien. Umso schärfer traten die Interessengegensätze mit den Stauferkaisern hervor, die ihre Macht über Norditalien ebenfalls auszubauen trachteten, versprachen doch die reichen lombardischen Städte fette Steuereinnahmen. Als über eine Heiratsverbindung auch noch das normannische Königreich Sizilien an die Staufer zu fallen drohte, war für den Papst die Grenze des Erträglichen erreicht. Der Kirchenstaat war von Nord und Süd von der kaiserlichen Macht umklammert – eine Horrorvision für den Apostelfürsten. Wiederum flogen die Bannflüche vom Tiber gen Norden. Dabei nahmen sich die Päpste nun auch das Recht heraus, in die deutsche Königswahl einzugreifen. Bei Doppelwahlen – so sah es jedenfalls Papst Innozenz III. – habe der Papst als Führer der Christenheit das Recht, den geeignetsten Kandidaten auszusuchen. Selbstverständlich bestätigte Innozenz III. 1202 einen staufischen Gegenkandidaten. Gerissen wie er war, hatte er auch gleich das passende Gleichnis dafür parat: Wie der Schöpfer zwei große Lichter an den Himmel gesetzt habe, so gebe es am Firmament der Christenheit zwei hohe Würden, die geistliche und die weltliche Gewalt. Und wie der Mond sein Licht von der Sonne erhalte, so habe die königliche Gewalt ihren Glanz eben von der Kirche! Die priesterliche Autorität, so errechneten brave Parteigänger des Papstes, sei dementsprechend exakt 6644-mal größer als die königliche. Mit diesem dominanten Anspruch ging das Papsttum in den „Endkampf“ mit den Staufern. Wiederum folgten hässliche Szenen und eine wahre Propagandaschlacht, in der sich die Parteien wechselseitig als „Antichrist“, „Natternbrut“ oder „Bestien“ schmähten.
Doch damit hatten auch die Päpste ihren moralischen Kredit überzogen. Allmählich fragte man sich nördlich der Alpen, ob man überhaupt einen Papst als Königs- und Kaisermacher brauchte. Eine günstige Gelegenheit, diesen Primat in Frage zu stellen, ergab sich, als das Papsttum im 14. Jahrhundert in die Krise und unter den Einfluss des französischen Königs geriet. Die Übersiedelung der Päpste nach Avignon machte eine Kaiserkrönung in Rom ohnehin nur durch Vertreter möglich, und eine Reihe strittiger Papstwahlen ließ an der Rechtmäßigkeit eines jeden Papstes zweifeln. Da ergriffen die Fürsten in seltener Einmütigkeit mit ihrem gebannten Kaiser Ludwig dem Bayern die Initiative. In einem Rechtsspruch erklärten die in Rhense am Mittelrhein versammelten Kurfürsten 1338, dass sie allein zur Königswahl berechtigt seien und dem von ihnen gekürten Kandidaten auch ohne päpstliche Approbation die volle Herrschaftsgewalt zustünde. Kaiser Ludwig IV. legte in einem wenige Tage später erlassenen Kaisergesetz noch eins drauf: Der von den Kurfürsten gewählte König besitze kraft seiner Wahl sofort auch die kaiserliche Würde, der Papst habe weder ein Anerkennungs- noch ein Bestätigungsrecht und kröne den Erwählten lediglich nachträglich in einer symbolischen Handlung. Diese Rechtsauffassung ging später auch in die „Goldene Bulle“ ein, die festsetzte, dass der zum König gesetzte Fürst gleichzeitig „erwählter römischer Kaiser“ sei. Von einem Papst war gar nicht mehr die Rede – der Joker wurde stillschweigend aus dem Spiel genommen. Das bedeutete, dass aufwändige Romfahrten unterbleiben konnten. Zwar bemühte man sich auch weiterhin um die Kaiserkrone, doch im Laufe der Zeit wurde sie immer weniger wichtig. Als letzter Prätendent ließ sich der Habsburger Friedrich III. 1452 in Rom durch den Papst zum Kaiser krönen. Sein Sohn und Nachfolger Maximilian I. verzichtete dagegen auf einen Romzug und begnügte sich mit dem Titel eines „erwählten Kaisers“. Sein Enkel Karl V. schaffte es nur noch bis nach Bologna, wo Papst Clemens VII. 1530 nun wirklich zum allerletzten Mal eine Kaiserkrone vergab. Die Würde hatte endgültig ihren Glanz verloren. Dass die Habsburger ab dem Spätmittelalter die Königskrone für Jahrhunderte für ihre eigene Familie reservieren und das Reich alles in allem recht erfolgreich regieren konnten, lag nicht an der imaginären Würde des Kaisertums, sondern an ihrer geschickten Hausmachtpolitik, durch die sie ihre Machtbasis im Reich verbreiterten. Über Heirat und Erbgang ergatterten sie die Kronen Ungarns, Böhmens und Spaniens – eine Hausmacht, die sich sehen lassen konnte.
Während der Besitz der Kaiserkrone schon reichsintern kaum Vorteile brachte, so ließ sich mit ihr auch außenpolitisch kaum Kredit bekommen. Sicher, im Zeremoniell blieb der Kaiser der ranghöchste Monarch des westlichen Abendlandes, doch sein Vorrang brachte ihm keine realpolitischen Vorteile ein. In Frankreich und England gelang es der Zentralmacht viel früher und viel stärker, die Weichen in Richtung eines effektiv verwalteten „modernen“ Nationalstaats zu legen. Seit dem 13. Jahrhundert gab es dort bereits Parlamente als ständische Mitspracheorgane, zentrale Verwaltungs- und Finanzbehörden sowie eine feste Hauptstadt mit Königsresidenz und Hofhaltung. In Paris und London konnte man über den benachbarten „Reisekaiser“ eigentlich nur müde lächeln. Den Einfluss der Großvasallen und die finanziellen Ansprüche der Kurie hatte man seit dem Spätmittelalter ganz gut im Griff. Von einem schwachen Kaiser brauchte man sich also nicht ins Geschäft reden zu lassen. „Wer hat denn die Deutschen zu Richtern über die Völker bestellt? Wer hat den plumpen und ungebärdigen Menschen diesen Einfluss gegeben, dass sie nach Gutdünken den Führer über die Häupter der Menschensöhne bestimmen?“, fragte ziemlich erbost der gelehrte Bischof Johann von Salisbury im Jahr 1160. Gerade zu einem Zeitpunkt, als die staufische Kaiserideologie zu Höhenflügen ansetzte und Universalherrschaftsträume schmiedete, fragten kritische Stimmen aus den westlichen Nachbarländern einmal nach, worauf sich der kaiserliche Vorrang denn überhaupt gründete. Auf den Zufall und den Papst, konnte man ihnen antworten. Und das war machtpolitisch betrachtet zu wenig, um handfeste Vorteile aus dem Kaisertum zu ziehen. Der französische König Philipp der Schöne holte 1309 das Papsttum unter seine Kuratel nach Avignon und entzog es damit dem kaiserlichen Zugriff. Rom mitsamt seiner schimmernden Krone blieb dem deutschen Königtum für eine ganze Weile entrückt. Wer sich trotzdem krönen lassen wollte, musste mit einem päpstlichen Legaten oder einem Gegenpapst vorliebnehmen. Eigene Ambitionen auf die Kaiserkrone zeigten jedoch weder der französische noch der englische König – kein einziger von ihnen strebte bis zum Spätmittelalter eine Krönung an oder reiste gar nach Rom. Die Patina auf der Krone schien diesen machthungrigen Herren wohl zu dick.
Aber auch jene, die noch am meisten von der Anwesenheit und von der militärischen Stärke des Kaisers hätten profitieren können, die Italiener und die Römer, zeigten sich über die Präsenz der Deutschen in ihrem Land wenig begeistert. Die reichen norditalienischen Städte sahen ihren Reichtum schon in kaiserlichen Kassen landen, und die italienischen Magnaten hießen den Kaiser nur willkommen, wenn es ihren eigenen Interessen nützlich schien. Auch das stadtrömische Patriziat zeigte sich nicht geneigt, die wichtige Bischofs- und Papstwahl in ihrer Stadt aus der Hand zu geben. Als Nachfahren des legendären Duos „Volk und Senat von Rom“ glaubten sie Einfluss auf die Wahl des Stadtoberhauptes nehmen zu dürfen. Auch wenn sie in dem Machtspiel um die Kaiserkrone nur die Rolle der „Bauern“ einnahmen, machten sie den kaiserlichen Herren das Leben schwer. So ging kaum eine Kaiserkrönung ohne Kämpfe mit den aufmüpfigen Römern ab. Schon Otto I. musste kurz nach seiner Kaiserkrönung blutige Gefechte austragen, weil Papst Johannes XII. mit Hilfe der Stadtrömer gegen ihn konspirierte. Auch sein Enkel Otto III. wütete grauenhaft in Rom, um seinen kaisertreuen eigenen Papst gegen den Widerstand der Stadtbevölkerung durchzusetzen. Auf den Zinnen der Engelsburg ließ er 13 seiner prominentesten Gegner aus dem Stadtadel öffentlich enthaupten und den von ihnen favorisierten Papst Johannes XVI. nackt und verstümmelt, rücklings auf einem Esel reitend, durch die Straßen Roms jagen. Freunde macht man sich anders.
Auch Friedrich Barbarossas Krönungsmahl ging nicht ohne Querelen über die Bühne. Ein Aufstand republikanisch gesinnter Römer beendete das Mahl abrupt. Über die Jahrhunderte wiederholte sich eigentlich immer das gleiche Spiel: Kaum war der Kaiser in seine Heimat jenseits der Alpen zurückgekehrt, brach seine Herrschaft in Italien wie ein Kartenhaus zusammen. Nur seine persönliche Präsenz und die Sprache seiner Waffen sicherten ihm seinen Einfluss auf der Apenninenhalbinsel. In die politischen Auseinandersetzungen mischten sich zunehmend auch „nationale“ Misstöne: Die Deutschen, so die Vorwürfe hochmittelalterlicher italienischer Geschichtsschreiber, seien weinselig, ausschweifend, reizbar und grausam. Sie hätten anstößige Manieren, seien schwer von Begriff und alles in allem einfach „unerträglich“.
Unwidersprochen konnte das römische Kaisertum auch deswegen nicht sein, weil es in Byzanz eine gewichtige Konkurrenz gab: den Kaiser des ehemals östlichen Reichsteils des antiken Imperiums. Dieser reklamierte für sich, der wahre Nachfolger der antiken Imperatoren zu sein – und eigentlich war er es auch. Denn seit der verwaltungsbedingten Aufteilung des riesigen römischen Imperiums in der Spätantike saß am Bosporus ein Kaiser, der sich in der Nachfolge Konstantins des Großen und darüber hinaus der antiken Cäsaren fühlen durfte und daher gehörig die Nase über den Parvenü aus dem Westen rümpfte. Schon Karl der Große hatte alle Hände voll zu tun, die Gemüter der „Griechen“, die wegen seiner Kaisererhebung in Wallung geraten waren, zu beruhigen. Byzanz akzeptierte schließlich den Neuling aus dem Westen, weil es ihn nicht verhindern konnte, doch als ebenbürtig empfand man ihn dennoch nicht. Als Otto I. um eine Braut für seinen Sohn Otto II. warb, schickte ihm der byzantinische Kaiser Johannes I. Tzimiskes nicht die gewünschte „purpurgeborene“ Prinzessin, sondern nur eine nahe Verwandte, die später als Kaiserin und Sachwalterin des Reiches so geschickt agierende Theophanu. Kulturell bestand ein weiter Abstand zwischen dem das römische Erbe bewahrenden Byzanz und dem aus dem Schmelztiegel der Völkerwanderungszeit hervorgegangenen westlichen Reich. So gab es für den römischen Kaiser auch hier nicht wirklich etwas zu punkten. Was bei all den Anfechtungen und Misshelligkeiten, die die Kaiserwürde mit sich brachte, blieb, war die Aura Roms. Wenn Kaiser Otto III. von seinem neu erbauten Palast auf dem Palatin seinen Blick über die kolossalen Ruinen Roms schweifen ließ, mochte er von imperialer Herrschaft träumen, doch er übersah, dass die Zeugen vergangener Größe eben nur noch Torsi waren.