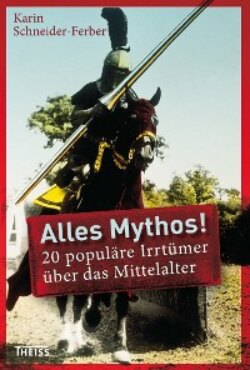Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über das Mittelalter - Karin Schneider-Ferber - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Mittelalter war finster, und die Menschen waren dumm und ungebildet
ОглавлениеAuf dem Kapitol zu Rom wurde wieder einmal Geschichte geschrieben: Unter dem lauten Beifall des Volkes, unter Trompetenklang und Jubelgeschrei brach sich an Ostern 1341 in einer feierlichen Zeremonie zum ersten Mal die Vorstellung von einem Mittelalter Bahn. An jenem denkwürdigen 8. April stieg der gefeierte italienische Dichter und Geschichtsschreiber Francesco Petrarca selbstbewusst und nicht ohne Eitelkeit die Stufen zum Senatspalast empor, um in einem Festakt nach dem Vorbild der antiken Dichterkrönungen für seine Verdienste um die Poesie als Auszeichnung die Lorbeerkrone zu erhalten. An dem Ort, an dem 1200 Jahre zuvor letztmals ein römischer Dichter mit dem Lorbeer gekrönt worden war, empfing der Wegbereiter der Renaissance aus den Händen des römischen Senators Orso dell´ Anguillara den symbolträchtigen Kranz und hauchte damit einer antiken Tradition wieder Leben ein. Der frisch mit dem „Delphischen Gewinde“ Bekrönte vergaß deshalb auch nicht, in seiner Festrede den „heiligen Namen Vergils“ zu beschwören, sah er sich doch selbst in der Nachfolge seines viel bewunderten römischen Vorbilds.
Die Krönung zum „poeta laureatus“ war für Petrarca mehr als nur Folklore, er verband mit ihr ein kulturelles Programm, das den Menschen in unmittelbarem Rückgriff auf die Antike zu höheren sittlichen Weihen führen wollte. Die Erneuerung der römischen Kultur in Sprache, Kunst und Moralphilosophie sollte das Individuum zu einem verantwortungsbewussten, umfassend gebildeten und politisch handelnden Wesen machen und dadurch auf eine höhere Stufe des Daseins hieven. Damit war jedoch gleichzeitig eine Abwertung verbunden, nämlich eine Geringschätzung genau jener Zeit, die Petrarca unmittelbar vor Augen lag und die sich nicht ganz so stark an der Antike orientiert hatte wie von den Jüngern des Cicero gewünscht, nämlich des Mittelalters. Hoch auf seinem Dichterdenkmal entrückt, empfand Petrarca für die jüngste Vergangenheit nur Verachtung. Er sah sie als eine störende Unterbrechung zwischen der ruhmreichen Antike und der sie wiederentdeckenden Renaissance, eine Zwischenzeit also, in der grobe und ungebildete Barbaren herrschten, die mit ihrem windigen Küchenlatein alle Liebhaber der lateinischen Sprache verschreckten und mit ihrem himmelsstrebenden Baustil der Gotik alle Regeln der idealen Proportion sprengten. Petrarca nahm als erster das hässliche Wort vom „finsteren Mittelalter“ in den Mund, und seitdem hat die Epoche ihr negatives Image weg.
Bis heute hat sich in den Köpfen die Vorstellung vom „dunklen“ Mittelalter gehalten, einer Epoche, in der religiöser Wahn, rückständiges Denken und menschenverachtende Grausamkeit herrschten. Gerne bemüht man den Begriff „mittelalterlich“, um Zustände zu kennzeichnen, die unseren modernen Ansprüchen zuwiderlaufen. Machen wir irgendwo Anzeichen von Folter, Anarchie und Willkür aus, sprechen wir von einem Rückfall ins Mittelalter, erscheint uns eine Sache als altmodisch oder überholt, diffamieren wir sie als mittelalterlich. Die Epochenbezeichnung mutierte dadurch zu einem negativ besetzten Schlagwort, geeignet, alles Abscheuliche oder Dunkel-Geheimnisvolle zu disqualifizieren. Dabei ist das Mittelalter streng genommen nichts anderes als die Kopfgeburt einiger humanistisch gebildeter Intellektueller. Gemessen an den Maßstäben der Antike erschienen ihnen die aus den Wirren der Völkerwanderungszeit hervorgegangenen mittelalterlichen Reiche als grob und ungehobelt. Welten schienen zwischen den formvollendeten Marmorfiguren der Griechen und Römer und den ersten, ungelenken Buchmalereien der irischen Mönche zu liegen, Meilen trennten die imposanten Reste römischer Architektur von den simplen Fachwerkbauten der mittelalterlichen Städte, ein tiefer Graben klaffte zwischen dem belesenen und sprachgewandten Gelehrten der Renaissance und dem in seinem geschlossenen Weltbild verharrenden Scholastiker. Und wer einmal die kühnen Visionen eines Leonardo da Vinci auf dem Papier gesehen hatte, dem galt selbst die ausgeklügelte Technik einer Wassermühle als einfalls- und bedeutungslos. Der Eindruck vom finster-barbarischen Zeitalter verfestigte sich, als die gerade erst entstehende Zunft der Historiker dazu überging, die Periodisierung der Geschichte in drei große Zeitabschnitte vorzunehmen und dabei das Mittelalter als Epochenbegriff einführte. Zwischen Altertum und Neuzeit schob man das nicht ganz ernst genommene „Mittel“-Alter als eine Ära des Übergangs, sozusagen als ein zu vernachlässigendes Vorspiel zur fortschrittsfreudigen Moderne. Diese Gliederung setzte der Philologe, Historiker und Geograf Christoph Cellarius (geb. 1638) aus Zeitz im 17. Jahrhundert durch. Der erste Professor der Geschichte an der Universität Halle führte die Dreiteilung für die Universalgeschichte ein und sah in den Jahren um 1500 die große Wende hin zur Neuzeit, ausgelöst durch den Ausbruch der Reformation und die Erfindung des Buchdrucks. Durch die Verknüpfung von Vorgängen aus der Politik-, der Bildungs- und der Kirchengeschichte schuf Cellarius eine ebenso griffige wie folgenreiche Periodengrenze: Das Mittelalter als historische Epoche nahm seinen Lauf. Seit dem 18. Jahrhundert trugen selbst die gelehrtesten Leute die Mär vom „finsteren Mittelalter“ fort, auch der belesene Geheimrat von Goethe erschauerte im Anblick des „eingeschränkten, düstern Pfaffenschauplatz des medii aevi“.
Der nachhaltig schlechte Ruf der Epoche verstellte lange den Blick auf die wirkliche Bedeutung des Jahrtausends zwischen 500 und 1500. Erst die Ergebnisse der Mittelalterforschung der jüngsten Vergangenheit, ergänzt um die Erkenntnisse der noch in den Kinderschuhen steckenden Mittelalter-Archäologie, zeigten ein anderes Bild dieses ebenso faszinierenden wie für die europäische Geschichte prägenden Millenniums. Keinesfalls waren die Menschen damals dumm, faul und brutal. Ganz im Gegenteil: Entfernt man die dicke Staubschicht der archivalischen Quellen, treten die Menschen des Mittelalters als äußerst neugierige, kreative, bildungshungrige und risikobereite Zeitgenossen hervor. Was sie aus der antiken Tradition vorfanden, übernahmen sie gerne, doch blickten sie über ihr Schulbuchwissen rasch hinaus und betraten bereitwillig geistiges Neuland. Zu den hartnäckigsten Mythen über das Mittelalter gehört die Annahme, man hätte in dieser Zeit geglaubt, die Erde sei eine Scheibe. Seit den wegweisenden Studien des Romanisten Reinhard Krüger ist eindeutig bewiesen, dass kein ernst zu nehmender Gelehrter aus Spätantike und Mittelalter die Kugelgestalt der Erde je bestritten hat. Schon die alten Griechen gingen von einer kugelförmigen Gestalt der Erde aus, und dieses Wissen rettete sich trotz des politischen Zusammenbruchs des Römischen Weltreiches über die Spätantike hinaus. Der Kirchenvater Augustinus (geb. 354) wäre empört gewesen, hätte man ihm die Theorie von der Scheibenform der Erde unterbreitet. Er vertrat ganz selbstverständlich die Ansicht, dass die Erde wie ein dicker großer Ball im Mittelpunkt des Weltalls schwebe. Über die Schriften des heilig gesprochenen Kirchenvaters wie über die lateinischen Übersetzungen der griechischen Philosophen gelangte diese Erkenntnis auf direktem Weg ins Mittelalter. Nacheinander wurden die Schriften des Denkers Platon, des Geografen Ptolemäus und des Allround-Genies Aristoteles ins Lateinische übersetzt. Und so konnten mit großer Selbstsicherheit die Gelehrten des Mittelalters – vom Enzyklopädisten Isidor von Sevilla über den Angelsachsen Beda Venerabilis bis hin zum größten Kirchenlehrer aller Zeiten, Thomas von Aquin – die Kugelgestalt der Erde verkünden. Diese Ansicht setzte sich auch im breiten Volk früh durch, seitdem schon der angelsächsische König Alfred der Große um 850 seine Gefolgsleute darüber aufgeklärt hatte, die Erde sei so kugelrund wie ein Schildbuckel. Und auch in Spanien, dem Wirkungsort des heiligen Bischofs Isidor, pfiffen es die Spatzen von den Dächern – die Erde ist rund wie ein Ball! An allen europäischen Universitäten wurde im Astronomieunterricht die Kugelgestalt der Erde gelehrt. Der Astronom und Mathematiker Johannes de Sacrobosco, seit 1220 Professor an der berühmten Universität von Paris, schuf mit seinem Werk „Sphaera mundi“ den dafür geeigneten Grundlagentext. Die im Spätmittelalter enorm verbreitete und als Pflichtlektüre in der Artistenfakultät gelesene Schrift ging von einer im Mittelpunkt des Firmaments stehenden Erdkugel aus, um die sich die Himmelskugel drehe. Erst mit Kopernikus, der vom geozentrischen Weltbild abrückte und die Sonne in den Mittelpunkt des Universums rückte, setzte die Diffamierung der Altvorderen ein. Denn Kopernikus (geb. 1473) berief sich, um seine Kritiker als besonders unglaubwürdig erscheinen zu lassen, ausgerechnet auf jenen spätantiken Kirchenvater, der die Erde als Scheibe bezeichnet hatte. Doch Lactantius, so sein Name, hatte so gut wie keine Anhänger, und seine Meinung war nie zur offiziellen Lehrmeinung geworden. Neben ihm gab es nicht einmal eine Handvoll Gewährsleute, die die Kugelform der Erde bestritten. Doch der kleine Trick des Kopernikus, der im Vorwort zu seinem Hauptwerk „Von der Umdrehung der Weltkörper“ 1543 den vergessenen Lactantius als Ausweis der Borniertheit zitierte, zeigte Wirkung: Im Zeitalter des Buchdrucks fand die Schmähung des mittelalterlichen Wissensstandes weite Verbreitung und wurde bis in die heutige Zeit tradiert. Als humoristischen Leckerbissen präsentierte der amerikanische Schriftsteller Washington Irving 1828 die Legende von jenen kleingeistigen spanischen Wissenschaftlern, die die Entdeckungsfahrten des Kolumbus angeblich mit dem Argument torpedierten, sein Schiff könne vom unteren Rand der Erdscheibe unmöglich wieder nach oben fahren – ein Ammenmärchen, an das im Mittelalter ganz gewiss niemand glaubte.
Dass die Furcht, von der Erdscheibe zu fallen, nicht sonderlich ausgeprägt war, beweist auch die Bereitschaft der Menschen, sich aufs offene Meer zu wagen und neue Ufer zu erkunden. Schon recht früh setzten erste Entdeckungsfahrten ein, mit denen man seinen geistigen Horizont erweitert wollte. Die seetüchtigen Wikinger eroberten sich schon im 9. Jahrhundert die Inselwelt des stürmischen Nordatlantiks. Ausgehend von ihren Heimatgebieten in Skandinavien schoben sie sich unaufhaltsam nach Nordwesten vor, bis sie schließlich um das Jahr 1000 die Küsten Nordamerikas erreichten. Die ersten Inseln, die sie auf ihrem abenteuerlichen Trip ins Ungewisse erreichten, waren die Orkney- und die Shetlandinseln, die Hebriden und die Färöer. Etwa ab 870 besiedelten Auswanderer aus Norwegen die Insel Island. Dabei mussten sie zur Kenntnis nehmen, dass sie beileibe nicht die ersten und einzigen waren, die den gefährlichen Weg übers Meer angetreten hatten. Irische Mönche waren bereits vor ihnen auf den Färöern und auf Island gelandet. Auf der Suche nach Abgeschiedenheit und Weltentsagung wagten sich diese frommen Männer in winzigen, leichten Lederbooten, den Curraghs, auf den wilden Ozean. In der Legende von der Seefahrt des heiligen Brendan (6. Jahrhundert) verdichteten sich die Erfahrungen der paddelnden Mönche in einem fantastischen Reisebericht. Brendan soll mit 12 Gefährten von Irland aus aufgebrochen sein, um das Paradies zu suchen, und dabei eine Menge Inseln erkundet haben, Inseln mit Schafen, Vulkanen und üppigen Apfelbäumen. Was an dem Bericht Wahrheit und Erfindung ist, lässt sich kaum mehr ausmachen, doch dürften in ihn die Erlebnisse wirklich unternommener Seefahrten eingeflossen sein.
Die weitaus besser belegten Wikinger dagegen gelangten um 982 nach Grönland und ließen sich dort einige Jahre später häuslich nieder, um Land- und Weidewirtschaft zu betreiben. Erst eine Klimaverschlechterung und Konflikte mit den Inuit vertrieben sie ab dem 14. Jahrhundert von dort. Immer noch nicht gänzlich geklärt ist die Frage, weshalb die Wikinger überhaupt auf Entdeckungsfahrten gingen. Überbevölkerung, schlechte Ernährungslage, politische Wirren allein können es nicht gewesen sein, die die Menschen zu ihren abenteuerlichen Fahrten trieben. Eine gehörige Portion Abenteuerlust und rastlose Neugier dürften wohl dazugekommen sein. Warum sonst hätte sich Leif Eriksson um die Jahrtausendwende von dem gewiss nicht überbesiedelten Grönland aus aufgemacht, um erneut auf Landsuche zu gehen? Es war der Bericht des Kaufmanns Bjarni Herjulfsson, der auf seiner Fahrt von Island nach Grönland vom Kurs abgekommen war und im dichten Nebel die Küste eines bewaldeten Landstreifens ausgemacht hatte, der Leifs Entdeckerdrang weckte. Tatsächlich gelang Leif „dem Glücklichen“ das Kunststück, etwa 320 Kilometer westlich von Grönland auf Amerika zu stoßen, genauer gesagt auf die Küsten von Labrador, Baffinland und Neufundland. Der „wahre“ Entdecker Amerikas wurde als solcher jedoch nie gewürdigt, der Versuch einer Besiedelung Neufundlands schlug fehl, und das Abenteuer geriet in Vergessenheit, sodass Kolumbus später den Lorbeer der Entdeckung des neuen Kontinents für sich allein in Anspruch nehmen konnte.
Auf den Spuren der Wikinger wandelten in den folgenden Jahrhunderten noch recht viele Seefahrer, auch wenn sich der Schauplatz des Geschehens nach Süden verlagerte. So machten sich 1291 die Gebrüder Ugolino und Guido Vivaldi von Genua aus mit zwei Galeeren in Richtung Westen auf, um nach Indien zu segeln. Ausgestattet mit ausreichend Proviant und Wasser und unter dem geistlichen Beistand zweier Minoritenbrüder passierten die Schiffe mit rund 300 Mann Besatzung die Meerenge von Gibraltar und landeten auf den Kanarischen Inseln, um frische Nahrung zu laden. Eine nördlich von Lanzarote gelegene unbewohnte Insel wird mit den Brüdern Vivaldi in Verbindung gebracht. Doch über den weiteren Verbleib der Seefahrer ist nichts bekannt. „Es ist keine sichere Kunde mehr von ihnen zu uns gelangt“, klagte ein Genueser Chronist. „Der Herr aber möge sie behüten.“ Der Sohn eines der Vivaldi-Brüder startete später eine erfolglose Suchaktion in Ostafrika, doch berichteten noch Mitte des 15. Jahrhunderts genuesische Seefahrer, Nachfahren von Überlebenden der Expedition an der Mündung des Gambia-Flusses gesichtet zu haben. Die Kanarischen Inseln, die die Phönizier bereits in der Antike entdeckt hatten, wurden erst 1312 von dem Genueser Adligen Lanzaroto Malocello „offiziell“ wiederentdeckt. Nach ihm wurde die Insel Lanzarote, auf der er bis etwa 1330 lebte, benannt. Eine portugiesische Expedition von 1341 brachte erste konkretere Erkenntnisse über die Inseln. Mit den Kanaren dürften auch die Passatwinde, die weiter nach Westen führten, den mittelalterlichen Seefahrern nicht mehr unbekannt gewesen sein.
Den Höhepunkt der frühen Seefahrt vor Kolumbus setzte jedoch der portugiesische Prinz Heinrich der Seefahrer (geb. 1394). Er förderte eine Reihe von Seefahrten ins Unbekannte, nicht nur um den arabischen Handel mit Gewürzen, Gold und Elfenbein zu umgehen und ein Bündnis mit dem legendären Priesterkönig Johannes, den man irgendwo in Afrika vermutete, zu schmieden, sondern auch aus Neugierde. An seinem Hof scharte er Gelehrte, Kartografen, Astronomen und Schiffsbauer um sich, die alle neuen Erkenntnisse sammelten und bündelten. Der Erfolg blieb nicht aus. Heinrichs Seeleute entdeckten Madeira und die Azoren, leiteten ihre Besiedelung ein und segelten entlang der westafrikanischen Küste weit nach Süden. Ein eigens dafür gebauter Schiffstyp, die Karavelle, sowie hervorragende Kenntnisse der Kartografie waren dazu vonnöten. Die portugiesischen Matrosen umschifften meisterhaft das schwierige Kap Bojador vor der westlichen Sahara, befuhren den Senegal-Fluss und entdeckten schließlich den Gambia-Fluss, den sie wagemutig etwa 97 Kilometer flussaufwärts befuhren. Der Vorstoß zur Guinea-Küste und die Entdeckung und Besiedelung der Kapverden bildeten weitere Höhepunkte der Unternehmungen. Bei Heinrichs Tod 1460 waren schließlich mehr als 2000 Seemeilen afrikanische Küste erkundet.
Sowohl die Seefahrten als auch die Fernhandelsreisen der Kaufleute über Land veränderten allmählich das Weltbild des Mittelalters. Der überaus farbige Reisebericht des venezianischen Kaufmanns Marco Polo (geb. 1254) quer durch Asien an den Mongolenhof wurde interessiert aufgenommen, wenn man auch nicht bereit war, alle Details zu glauben. Auf der 1375 entstandenen Katalanischen Weltkarte des Abraham Cresques aus Palma de Mallorca haben die Ergebnisse der Marco-Polo-Reise jedoch bereits ihren Niederschlag gefunden. Der sogenannte „Katalanische Atlas“ war ein Meilenstein in der Geschichte der Kartografie, nahm er doch alle damals verfügbaren Informationen über das Aussehen der Welt in sich auf. Der jüdische Kartenzeichner Cresques, Mitglied der berühmten mallorquinischen Schule der Kartografie, fertigte die Weltkarte im Auftrag Peters IV. von Aragon für den französischen König an und zog für das große Werk die modernsten katalanischen und italienischen Seekarten sowie die Berichte europäischer und arabischer Reisender heran. Überraschend genau zeigte er die Küstenlinie Europas, aber auch für Nordafrika trug er viele stimmige Details wie beispielsweise das Atlas-Gebirge ein. Die Orte entlang der Seidenstraße, die China und Persien miteinander verband, wusste der gelehrte Kartenzeichner ebenfalls schon sehr korrekt zu platzieren. Erstmals zeigte er den indischen Subkontinent realitätsgetreu als Halbinsel. Die Erweiterung des Weltbildes schlug sich in zahlreichen ab Ende des 13. Jahrhunderts erscheinenden Portulankarten nieder, die von den Seefahrern auf hoher See zur Orientierung benutzt wurden. Die zunehmende Bedeutung des Seehandels machte es notwendig, den Küstenverlauf einzelner Gebiete und die dazugehörigen Häfen möglichst genau festzuhalten. Die Kartenzeichner benutzten dazu die Informationen, die sie von einheimischen Fischern und Kapitänen kleinerer Küstenhandelsschiffe erhielten, und fertigten, zumindest was das Mittelmeer und die Region um das Schwarze Meer betraf, recht genaue Karten an. Eine darauf eingezeichnete Kompassrose und ein System von Rhumbenlinien ermöglichten es dem Schiffsnavigator, den eigenen Kurs zu berechnen. Die vorherrschenden Winde markierte man in verschiedenen Farben: Schwarz die Hauptwinde, Grün die Halbwinde, Rot die Viertelwinde. Mit Hilfe des magnetischen Kompasses, den Europa Ende des 12. Jahrhundert über die muslimische Welt kennen lernte, konnten die Seeleute damit bereits recht sicher über die Ozeane segeln.
Wissbegierde und die Lust am Neuen standen auch Pate für das schönste Geschenk, das die mittelalterliche Welt der Neuzeit hinterließ: die Universitäten. Die Freude am freien Gedankenaustausch führte im 12. Jahrhundert zuerst in Bologna, Paris und Oxford zu einem Zusammenschluss von Gelehrten und Scholaren, die ihre Studien zunächst noch auf offenen Plätzen oder in Privaträumen betrieben. Vom Papst oder Kaiser privilegiert, genossen diese Korporationen Lehrfreiheit und Selbstverwaltungsrechte und wurden so zu den Keimzellen der späteren Universitäten. Keiner lokalen Macht unterworfen, entwickelten sich die neuen Lehranstalten zu den bedeutendsten Bildungszentren des Mittelalters. Sie waren von Anfang an europäisch organisiert. Sowohl die Professoren- als auch die Studentenschaft kam aus aller Herren Länder, sodass erstmals ein internationaler Wissensaustausch über alle Ländergrenzen und Regionen hinweg zustande kam. Wer an der Sorbonne sein Studium begonnen hatte, konnte es problemlos in Padua, Salerno oder Salamanca fortsetzen und nach dem Abschluss in Toulouse, Cambridge oder Sevilla unterrichten. Für die deutschen Studenten entstanden ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts Einrichtungen in Prag, Wien und Heidelberg. Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts blickte Europa auf eine insgesamt 75 Institutionen umfassende Universitätslandschaft, an der man fundierte Kenntnisse in Theologie, Rechtswissenschaften und Medizin erwerben konnte. Dem eigentlichen Hauptstudium vorgeschaltet war ein mehrjähriges Grundstudium in grammatischen, mathematischen und philosophischen Fächern, wobei insbesondere die Schriften des griechischen Philosophen Aristoteles rezipiert wurden. Bis zum Erwerb eines Doktortitels konnten zehn Jahre und mehr vergehen, sodass die Studenten in dieser Zeit ein oft recht karges Leben führen mussten. Zur Finanzierung des eigenen Lebensunterhaltes traten hohe Studien- und Abschlussgebühren, die Kosten für die Anschaffung von Büchern und Schreibmaterial sowie die teuren Reisen an fremde Universitäten, denn es war üblich, den Studienort mindestens einmal zu wechseln. Selbstverständliche Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums war die fließende Beherrschung des Lateinischen, der universalen Gelehrtensprache. Trotz dieser hohen Hürden brauchten die Universitäten über Nachwuchssorgen nicht zu klagen. Bildungshungrige junge Menschen gab es zuhauf. Sie nutzten die Chancen, die sich aus der Demokratisierung des Wissens ergaben, denn die Universitäten standen allen Begabten – Adligen wie Nichtadligen, Laien wie Klerikern – offen. Zum ersten Mal zeichnete sich damit die europäische Bildungslandschaft ab, die wir heute kennen und deren Grundzüge Hochschulautonomie, Forschungsfreiheit und Zugangsfreiheit heißen.
Die Humanisten spotteten später gerne über die Engstirnigkeit der Scholastiker, die ihrer Meinung nach nur die alten Autoritäten kritiklos nachbeteten und sich mit spitzfindigen Fragestellungen begnügten. Doch die Menschen des Mittelalters bekamen Zugang zum Wissen nur über den Umweg der antiken Literatur. „Wir sind Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen. Wir können mehr und weiter sehen als diese, nicht, weil wir einen schärferen Blick oder eine stattlicherere Gestalt besitzen, sondern weil deren Größe bewirkt, dass wir gehoben und getragen werden“, so beschrieb Bernhard von Chartres zu Beginn des 12. Jahrhunderts den Umstand, erst einmal das aus der Antike stammende Grundwissen aufarbeiten zu müssen, bevor eigene Denkansätze überhaupt möglich waren. An den Kloster- und Domschulen, aber auch an den neuen Universitäten las und lernte man zunächst die Schriften der alten Griechen und Römer, bevor man Eigenständiges zu denken wagte. Auswendiglernen und Abschreiben waren die gängigen Methoden des Schulalltags, und man kann sich gut vorstellen, dass eine gewisse Eintönigkeit diesen Unterricht prägte. Der Magister auf seinem Katheter trug einen Abschnitt aus einem bestimmten Lehrbuch vor, seine Studenten schrieben eifrig mit – den berüchtigten Frontalunterricht gab es schon im Mittelalter. Doch über das reine Memorieren alter Texte gingen Lehrer wie Schüler bald hinaus. Die Professoren verfassten Kommentare und Glossen zu dem Gelesenen und fassten ihr Wissen in umfangreichen Enzyklopädien und Sentenzensammlungen zusammen. Dabei gerieten auch die Kernsätze der Altvorderen ins Visier der Gelehrten. Man merkte, dass es Widersprüche in den Aussagen der Autoritäten gab und versuchte diese zu benennen und zu lösen.
Die „disputatio“, die Diskussion zweier widerstreitender Meinungen, nahm breiten Raum im universitären Leben ein. In öffentlichen Streitgesprächen traten Studenten und Magister gegeneinander an und stellten ihre rhetorische und intellektuelle Begabung unter Beweis. Nach These und Antithese brachte schließlich eine abschließende Synthese die Entscheidung im Meinungsstreit. Auch wenn sich manche Fragestellungen ziemlich hanebüchen ausnahmen – man diskutierte etwa die Frage, ob Jesus Christus einen Geldbeutel besessen hatte oder nicht – schulten sie doch das eigenständige Denken und das folgerichtige Argumentieren. Der Spott der Humanisten traf so gesehen die Falschen. Denn ohne die Gedankenexperimente der Scholastiker wäre unsere moderne Form des Denkens gar nicht möglich geworden. Sie, die Gehirnakrobaten des Mittelalters, ebneten der exakten Überprüfung von Hypothesen, wie sie für alle Naturwissenschaften erforderlich ist, den Weg. Das Wagnis, sich auf die eigenen Verstandesgaben zu verlassen und übernommene Wahrheiten kritisch zu hinterfragen, begann in den Hörsälen der mittelalterlichen Universitäten. Der Wissensdurst der Scholastiker, der im 15. Jahrhundert zu einem raschen Anstieg des naturwissenschaftlichen und technischen Interesses führte, wurde für den Aufstieg Europas in der frühen Neuzeit maßgeblich. Jakob Burckhardt, der große Kulturhistoriker des 19. Jahrhunderts, attestierte den Menschen des Mittelalters eine „ruhelose Energie, die äußere Welt zu erforschen und ihre Bestimmung, aber auch sich selbst“. Dieses Urteil erwies sich als treffender als das Spottlied Petrarcas und seiner Genossen.