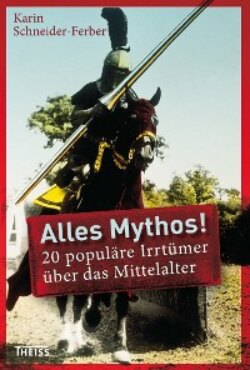Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über das Mittelalter - Karin Schneider-Ferber - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
König und Adel lebten in Saus und Braus, während das einfache Volk erbärmlich darbte
Оглавление„Durch Reichtum sind die Bauern in unserer Gegend und in manchen Teilen Deutschlands üppig und übermütig geworden. Ich kenne Bauern, die bei der Hochzeit von Söhnen oder Töchtern oder bei Kindtaufen so viel Aufwand machen, dass man dafür ein Haus und ein Ackergütchen nebst einem kleinen Weinberg kaufen könnte. Sie sind in ihrem Reichtum oft wahrhaft verschwenderisch in Nahrung und Kleidung und trinken kostbare Weine“, empörte sich der Humanist und Theologe Jacob Wimpfeling im 15. Jahrhundert über die Bauern seiner elsässischen Heimat. Ja, es gab ihn: Den kleinen sozialen Aufstieg in bescheidenem Rahmen, den Großbauern in seinem Dorf, dessen Tafel reicher gedeckt war als die der anderen, den kleinen Handwerkersohn, der sein Glück in der Stadt suchte und fand, der Unfreie, der im treuen Dienst an seinem Herrn als Ministeriale seinen Aufstieg machte oder das Arme-Leute-Kind, das in den Reihen der Kirche die Karriereleiter nach oben kletterte. Die vielen kleinen Geschichten, die das Leben schrieb, zeigen eine allmähliche Verbesserung der Lebensverhältnisse im Verlauf des Mittelalters, und zwar nicht nur für die oberen Schichten, sondern tendenziell für alle. Zwar waren die Stände – Adel, Klerus, Bauern – streng voneinander geschieden und durch die Geburt vorgegeben, doch innerhalb seines Standes konnte jeder sein Glück versuchen. Ein wohlhabender Bauer und ein armer Ritter unterschieden sich dann in ihrer Lebensweise gar nicht mehr so stark voneinander, und ein reicher Kaufmann in seinem komfortabel ausgestatteten Stadtpalais konnte über die miserablen Wohnverhältnisse auf einer zugigen Burg hinter vorgehaltener Hand nur lachen.
Vielleicht hatten die Bauern ja recht, und Petrus war an allem schuld. Dem Mann, dem man die Schlüsselgewalt über das Himmelreich nachsagte, wies der Volksglaube auch eine gehörige Portion Verantwortung für das Wettergeschehen zu. Und das Klima begann sich im Zeitraum vom 10. bis zum 13. Jahrhundert zu Gunsten der Menschen zu ändern – es wurde ganz allmählich wärmer. Diese Klimaerwärmung, die im Hochmittelalter ihren Höhepunkt fand und danach wieder durch eine deutlich kühlere Witterung abgelöst wurde, schuf erst die Voraussetzungen für das, was man als „Blüte des Mittelalters“ kennt: bessere Ernten, den Rückgang gravierender Hungersnöte und Epidemien sowie ein stetiges Bevölkerungswachstum im Hochmittelalter, bevor im 14. Jahrhundert die Menschen von neuen Katastrophen wie Missernten und dem Ausbruch der Pest heimgesucht wurden. Man schätzt, dass sich die europäische Bevölkerung zwischen 1000 und der Mitte des 14. Jahrhunderts fast verdoppelte, von etwa 38,5 auf 73,5 Millionen. Davon lebten nahezu 90 Prozent als Bauern auf dem Land. Mildes Klima und Bevölkerungswachstum lösten zusammen eine kleine „Agrarrevolution“ aus. Denn um alle hungrigen Mäuler satt zu bekommen, musste sich der „kleine Mann“ auf seiner Scholle etwas einfallen lassen, um neue landwirtschaftliche Flächen zu erschließen und die Ernteerträge zu steigern. Und wie sich zeigen sollte, waren die Bauern äußerst erfindungsreich. Das Hochmittelalter ist die große Zeit des Landausbaus. Allerorten brachen Gruppen von Menschen mit Hacke, Pflug und Beil auf, um Wälder zu roden, Moore zu entwässern, Sümpfe trocken zu legen und Wiesen urbar zu machen. Weite Flächen bebaubaren Landes gab es in den weniger dicht besiedelten Gebieten jenseits der Elbe, in den Weiten Osteuropas, im Süden der Iberischen Halbinsel, im Norden Großbritanniens oder in den Gebirgstälern des Apennins und der Alpen. Die schwere Rodungsarbeit lohnte sich für die Bauern in vielfacher Hinsicht: Sie fanden nicht nur fruchtbare Böden fern der Heimat vor, sondern bekamen von ihren weltlichen und geistlichen Grundherren auch Vorrechte zugestanden. So erhielten sie das Neuland meist zu günstigen Bedingungen in Erbpacht übertragen, waren für einige Jahre von der Abgabenlast befreit und konnten die persönliche Unfreiheit abschütteln. Manche Dörfer kamen sogar in den Genuss einer regelrechten bäuerlichen Selbstverwaltung. Von der Rodungstätigkeit dieser Zeit zeugen heute noch viele deutsche Ortsnamen mit den Endungen -reuth, -rode, -greuth oder -ried. Wer also mobil war und das Risiko einging, sein angestammtes Dorf zu verlassen, der hatte Chancen, in der Ferne seinen kleinen Aufstieg zu machen. Dies hatte wiederum Rückwirkungen auf die Daheimgebliebenen. Denn wer die Möglichkeit zum Auswandern hatte, konnte die Preise für seine Arbeit erhöhen. So mussten auch im Altsiedelland die Grundherren Abgaben und Frondienste senken, um ihre Bauern zum Bleiben zu bewegen.
Tüchtige Bauern konnten zudem vom Wandel der Herrschaftsstrukturen auf dem Lande profitieren, der im Hochmittelalter einsetzte. Denn angesichts des Arbeitskräftemangels und des Übergangs zur Geldwirtschaft lohnte es sich für die Großgrundbesitzer aus Adel und Kirche immer weniger, Land in eigener Regie zu bewirtschaften, wie das seit dem Frühmittelalter üblich gewesen war. Traditionellerweise saß der Grundbesitzer auf seinem zentralen Fronhof inmitten seiner Äcker und Felder und bestellte einen Teil seines Landes, das sogenannte Salland oder Herrenland, mit Hilfe abhängiger Höriger. Meist vergab er nur wenige, weiter entfernt liegende Parzellen an selbstständig wirtschaftende, zu Abgaben und Frondiensten auf dem Herrenhof verpflichtete Bauern. Nun gingen die Grundherren dazu über, ihr gesamtes Land an Bauern zu vergeben und dafür Abgaben – zunächst Naturalien, später Geld – zu kassieren. Dadurch reduzierten sich die ungeliebten Frondienste, die die Bauern zuvor auf dem Herrenland zu leisten hatten, von selbst, und die persönliche Bindung an den Grundherrn begann sich zu lockern. Die Unterschiede zwischen persönlich freien und unfreien Bauern, die es im Frühmittelalter noch gegeben hatte, verwischten allmählich, an ihre Stelle trat die Unterscheidung zwischen armen und reichen Bauern. Clevere Landleute pachteten bei der Aufteilung des Herrenlandes gleich größere Flächen und konnten so ihre Erträge langfristig steigern. Zuweilen wurde der Fronhof samt seinen Ländereien sogar als Einheit behalten und geschlossen an einen Pächter gegeben. Wohl dem, der so einen umfangreichen Meier- oder Dinghof übernahm! Der hatte für die nächsten Generationen schon ausgesorgt. Wenn dann auch noch bestimmte herausgehobene Aufgaben im Auftrag des Grundherrn dazukamen, wie die Überwachung und Verwaltung der bäuerlichen Abgaben, dann war der Weg in die dörfliche Oberschicht schon fast geebnet. In der Rolle des Dorfvorstehers, auch Schultheiß oder Bauermeister genannt, der die Dorfversammlungen leitete und eine Mittlerposition zwischen dem Grundherrn und der Gemeinde einnahm, glänzte so mancher Großbauer.
Die Aufgabe des alten Fronhofsystems zu Gunsten der Pachtwirtschaft stärkte die bäuerliche Initiative. Zwar war man immer noch diversen Grund-, Gerichts-, Vogtei- oder Landesherren gegenüber abgabepflichtig, doch die Umwandlung der Frondienste und Abgaben in fixe Geldbeträge erleichterte das eigenständige Wirtschaften. Endlich waren die Bauern Herr ihrer eigenen Zeit, und wer schnell und effektiv arbeitete, konnte seine Überschüsse auf dem nächstgelegenen städtischen Markt gewinnbringend losschlagen. Die Aussicht auf Gewinn beflügelte die Innovationsfreude der Bauern. Allmählich ging man von der Zweifelder- zur Dreifelderwirtschaft über, was bedeutete, dass man die landwirtschaftlichen Flächen in drei Teile schied und jeweils im Wechsel mit Winter- und Sommergetreide bepflanzte und im dritten Jahr als Brache und Viehweide nutzte. Das ließ den Böden einerseits mehr Zeit zur Erholung und steigerte andererseits den Ertrag, da immer zwei Drittel der Ackerfläche bebaut und als Winter- bzw. Sommergetreide abgeerntet wurden. So konnten schlechte Ernteerträge beim Wintergetreide durch die Sommersaat ausgeglichen werden und umgekehrt. Das Düngen mit Viehmist wirkte sich ebenfalls ertragssteigernd aus. Finanzstarke Bauern stellten die Bodenbearbeitung schon bald auf Hightech um. Schwere Pflüge aus Eisen lösten den alten und wenig wirkungsvollen Hakenpflug im Laufe des Hochmittelalters ab. Der Schollenpflug lief auf Rädern und besaß eine asymmetrische Pflugschar, die den Boden nicht mehr bloß aufritzte, sondern buchstäblich umwälzte, wodurch die schweren Böden Mittel- und Nordeuropas tiefer als bisher durchschnitten und aufgelockert werden konnten. Mit der neuen Egge, die nach dem Pflügen zum Einsatz kam, glättete und zerkleinerte man die Schollen und riss das Unkraut heraus. Leistungsorientierte Bauern begann der gemächliche Trott der Ochsen, die man vor den Pflug spannte, allmählich zu nerven. Sie gingen seit dem 11. Jahrhundert dazu über, Pferde als Zugtiere zu verwenden, die wesentlich schneller und ausdauernder arbeiteten. Dazu bedurfte es allerdings einiger Neuerungen wie der Einführung eines neuen Zuggeschirrs, des „Kummets“, das die Zuglast gegenüber den alten Anspanngeschirren besser auf die Schultern des Tieres verteilte und dadurch deren Leistungsfähigkeit steigerte. Auch das Verwenden von Hufeisen seit der Jahrtausendwende erleichterte den Pferden das Gehen auf den schweren Böden und steigerte die Produktivität. Um die nun höheren Erträge effektiver verarbeiten zu können, bediente man sich neuer Erntegeräte wie der Sense, die einen raschen Schnitt der Ähren erlaubte, und des Dreschflegels, der die Ähren mit großer Wucht und viel wirkungsvoller als die zuvor benutzten Äste oder Hölzer entkörnte. Mit nun erstmals vierrädrigen Karren konnten Getreidegarben und Heu in großen Massen bewegt werden, und mit der Schubkarre war ein vielseitig einsetzbares Transportmittel für kleinere Lasten erfunden worden.
Innovationsfreudige und fleißige Bauern waren im Hochmittelalter durchaus in der Lage, sich einen bescheidenen Wohlstand zu erwirtschaften. Zwar blieb die Abgabenlast an die geistlichen und weltlichen Grundherren hoch, zwar drohten immer noch Hagel und Gewitter die Ernten zu vernichten, doch wenn sich in guten Jahren Scheune und Speicher füllten, dann ließ es sich auch auf dem Land recht gut leben. Und zu feiern verstand die Landbevölkerung allemal! Auf Hochzeiten, Kirchweihfesten, Taufen oder Heiligenfesten ging es immer hoch her, man schlug sich die Bäuche mit allerlei Leckereien voll, tanzte und spaßte, was das Zeug hielt. Gelegenheiten dazu gab es reichlich – im 13. Jahrhundert etwa verfügte Papst Gregor IX., dass das Jahr 85 arbeitsfreie Tage haben sollte. Die wirkliche Anzahl freier Tage lag vermutlich noch höher, wenn man lokale Feste oder Feiern im Laufe des Bauernjahres wie Maianfang, Sommersonnenwende oder Erntedank dazurechnete. Dann wurde gehörig geschlemmt und getrunken, üppig Fleisch und Speck aufgetragen, Eier, Käse und Gemüse wurden im Überfluss verzehrt. Die Völlerei der Bauern wurde bald sprichwörtlich und rief bei Theologen und Moralisten einen gewissen Argwohn hervor. „Es ist beklagenswert, wie viele Bauern der ewigen Verdammnis anfallen werden, und das vor allem durch vier Dinge: Durch ihre Trägheit (…), durch die Ungerechtigkeit (…), durch Meineid (…) und durch Trunksucht“, heißt es in einer Franziskanerpredigt aus dem 13. Jahrhundert. Je wohlhabender mancher Bauer wurde, desto stärker trafen ihn Spott und Neid der „besseren Kreise“. Insbesondere der Ritterstand achtete darauf, dass der Abstand zu den reichen Bauern nicht allzu gering ausfiel. Mit deftigen Worten lästerte man über die „tumben Bauerntölpel“ ab, die nichts als dumm, faul, gefräßig und ungehobelt seien. „Seht, welch Getümmel und welch Mühe erhob sich da um Kraut und Brühe, dass solch Eifer und solch Jagen ihr nie saht in euren Tagen!“, reimte ironisch der satirische Dichter Heinrich Wittenwiler Ende des 14. Jahrhunderts über den Sturm aufs Büffet während einer Bauernhochzeit. Und er setzte noch eins darauf: „Jeder soff, weil ihn die Kehle kratzte, so mächtig, dass ihm der Gürtel platzte!“. Deswegen warnte der Bamberger Dichter Hugo von Trimberg mit erhobenem Zeigefinger: „Eines Bauern großes Gut bringt ihn leicht zum Übermut!“. Im Spätmittelalter – unter dem Eindruck einer tiefgreifenden Agrarkrise, bei der auch der Landadel verarmte – verfestigte sich das Bild vom bäuerischen Grobian, sodass der Bauernstand regelrecht in Verruf geriet. Um die wohlhabenden Bauern an ihren niederen Stand zu erinnern, ging man seit dem 12./13. Jahrhundert dazu über, mit Hilfe von Kleiderordnungen den sozialen Abstand zu wahren und sinnfällig zum Ausdruck zu bringen. Die zunehmend farbenprächtigere Kleidung der Bauern, die dem Modegeschmack der Oberschicht nacheiferte, wurde verboten und auf schwarze und graue Tuche beschränkt. Der Ritter Neidhart von Reuental übte im 13. Jahrhundert heftige Kritik an der Putzsucht der Bauern.
Vom Tellerwäscher zum Millionär – diesen Traum hegten schon die Menschen des Mittelalters, als Amerika noch gar nicht entdeckt war. Und manche schafften es tatsächlich, sich diesen Traum zu erfüllen. Die besten Startchancen dazu hatten natürlich die Großbauern, die sich von der bäuerlichen Unterschicht der Landarbeiter, Kleinbauern und der Habenichtse, die ohne ausreichende Landausstattung am Rand des Existenzminimums lebten, abhoben. Sie dominierten den Dorfalltag, indem sie im Namen des Grundherrn hoheitliche Funktionen wahrnahmen. Einer dieser reichen Bauern, so der aus dem niedersächsischen Dorf Wobeck stammende Konrad Advocati, dessen Besitz weit über die Normalausstattung seiner Mitbewohner hinausging, konnte es da sogar schon wagen, die eigenen Standesschranken hinter sich zu lassen. Konrads Tochter heiratete im 14. Jahrhundert den Angehörigen eines niederadligen Rittergeschlechts.
Der treue Dienst an einem Herrn lohnte sich für die Betroffenen in der Regel allemal. Dabei war es egal, ob man für einen geistlichen oder weltlichen Herrn arbeitete. Persönlich unfreie Dienstleute übernahmen zuweilen als Kastellane auf den Burgen der adligen Grundherren recht verantwortungsvolle Tätigkeiten. Sie kümmerten sich um die Besatzung und ihre Versorgung, verwalteten die Güter des Eigentümers, kontrollierten die pünktliche Bezahlung der Abgabenlast und leisteten Waffendienst. Ihr herausgehobenes Aufgabenfeld setzte ein besonderes Treueverhältnis zu ihrem Herrn voraus. Die Ministerialen, so nannte man diese Leute, mussten absolut zuverlässig, geschickt und tüchtig sein. Ehrgeizig und rührig bastelten sie an ihrem sozialen Aufstieg. Dabei lebten sie durchaus bescheiden, nicht viel besser als ein Bauer oder einfacher Städter. Zum Dank für ihre langjährige Tätigkeit erhielten sie von ihrem Dienstherrn häufig die persönliche Freiheit und ein eigenes Lehen, sodass sie selbst in den niederen Adel aufstiegen. Der Ritterstand, der sich erst im Laufe des 13. Jahrhunderts gegenüber Emporkömmlingen aus dem Bürgertum und der Landbevölkerung abschloss und zum Adelsstand gerechnet wurde, speiste sich zu einem erheblichen Teil aus diesen ursprünglich unfreien Ministerialen. Gute Aussichten auf Erfolg hatten auch jene Dienstmannen, die einem geistlichen Herrn zur Hand gingen. Insbesondere der Dienst bei einem Bischof, der in der Regel auch Stadtherr war, zahlte sich aus. Die Herrschaft über eine Stadt und ein ganzes Bistum bedeutete viel Verwaltungskram, und dafür wurden jede Menge gut ausgebildete und fleißige Fachleute gebraucht. Die Ministerialen einer Bischofsstadt übten im Auftrag ihres Herrn die Gerichtsbarkeit aus, sorgten sich um die Instandhaltung der Stadtbefestigung, kontrollierten den städtischen Markt, wachten mit Argusaugen über Münze und Zoll. Im Zuge der kommunalen Bewegung, durch die die Städte sich immer stärker von ihren Stadtherren emanzipierten und hoheitliche Rechte erkämpften, wechselten die Ministerialen aber immer häufiger die Seiten und stellten sich in den Dienst der nach Unabhängigkeit strebenden Bürgergemeinden. In Trier und Mainz waren Ministerialen im 12. Jahrhundert an Aufständen gegen die eigenen Erzbischöfe beteiligt, auch aus Leipzig, Magdeburg und Halberstadt mehrten sich die Nachrichten von unbotmäßigen Ministerialen. War die Herrschaft des Stadtherrn erst einmal abgeschüttelt oder doch zumindest eingeschränkt, fanden sich die Ministerialen als Mitglieder des Rates oder eines Schöffenkollegiums auf Seiten der städtischen Führungsschicht wieder. Der Aufstieg ins Patriziat war damit geebnet, aus den unfreien Dienstleuten wurden geachtete und ehrbare Ratsherren.
Insbesondere die Städte bildeten den besten Nährboden für tüchtige Emporkömmlinge vom Land. Immer mehr Bauernsöhne wanderten im Mittelalter in die rasch wachsenden und wirtschaftlich expandierenden Städte, um dort als Handwerker oder Krämer ihr Glück zu suchen. Denn mit der Ausweitung des Handels, einer immer differenzierter werdenden Arbeitsteilung und einer breiten Nachfrage nach Qualitäts- und Luxuswaren boten die Städte neue Verdienstmöglichkeiten. Am Beispiel der Fugger lässt sich der Aufstieg einer Familie recht deutlich ablesen. Im Jahre 1367 zog ein Glück suchender Landweber namens Hans Fugger aus dem kleinen Dorf Graben auf dem Lechfeld in die schwäbische Reichsstadt Augsburg. Er begann mit einem schmalen Startkapital von 22 Pfund und arbeitete zunächst als kleiner Weber, doch bis zu seinem Lebensende hatte er sein bescheidenes Anfangskapital auf 2000 Gulden erhöht, ein Haus gekauft, in die Weberzunft eingeheiratet und damit den Grundstock für eine sagenhafte Familienkarriere gelegt. Innerhalb von nur drei Generationen schafften die Fugger den Sprung zu den reichsten und einflussreichsten Großkaufleuten und Bankiers des Reiches. Hans Ènkel Jakob Fugger, genannt „der Reiche“, finanzierte mit seinen Geldgeschäften sogar die Kaiserwahl Karls V. und stieg zum kaiserlichen Rat und Reichsgrafen auf. Solche Karrieren waren nicht untypisch in den großen Städten. Vom Handwerker zum Kaufmann, vom Kaufmann zum Ratsherrn, vom Ratsstand ins Patriziat – auf dieser Stufenleiter verlief so manche Familiengeschichte. Wer das flache Land einmal hinter sich gelassen und sich in der Stadt erfolgreich eingeführt hatte, der fand zumeist bessere Lebensbedingungen als in seiner angestammten Bauernkate. Mit etwas Vermögen in der Tasche ließ sich ein Haus aus Stein erwerben, dessen Zimmer den Komfort einer Heizung aufwiesen, und über die städtischen Märkte konnte man ein reiches Warenangebot beziehen, das Luxusgüter wie Gewürze und kostbare Textilien einschloss. Und was den Informations- und Kommunikationssektor betraf, war die Stadt ohnehin unübertroffen. Von den weitgereisten Fernkaufleuten erfuhr man die neuesten Nachrichten aus dem Ausland, man war rechtzeitig über Kriegsgefahr und Seuchen unterrichtet und konnte in den Markthallen internationale Beziehungen knüpfen. In der Stadt war man einfach näher am Puls der Zeit. Vor allem konnte der Städter auch auf ein größeres Bildungsangebot in Form von Bischofs- und Kathedralschulen oder, falls er sich in eine europäische Universitätsstadt begab, auf eine der hochgeschätzten Universitäten zurückgreifen. Und das war für den sozialen Aufstieg schon damals von größtem Nutzen.
Gebildete Leute hatten vor allem in den Reihen der Kirche, später auch in den immer komplexer werdenden Stadtverwaltungen und an den weltlichen Höfen als Juristen, Notare und Archivare gute Karrierechancen. Deswegen gaben Bürger wie Bauern ihre Kinder gern frühzeitig in die Obhut geistlicher Institutionen, um sie dort ausbilden zu lassen. Ein gelehrter Mann einfacher Abkunft konnte es bis zum Theologen und Hochschullehrer bringen oder in den Reihen der Weltkirche wie eines Ordens aufsteigen. So war der einflussreiche Abt Suger von Saint-Denis (geb. um 1081) in Frankreich der Sohn eines Leibeigenen. Papst Urban IV. (gewählt 1261) entstammte einer französischen Schuhmacherfamilie. Der deutsche Philosoph und Theologe Nikolaus von Kues (geb. 1401) stieg zum Kardinal und Fürstbischof von Brixen auf, obwohl er nur der Sohn eines Moselschiffers war. Es gab Fälle, in denen es einfache Priester stadtbürgerlicher Herkunft zum Bischof brachten oder Mönche aus bäuerlichen Familien auf den Abtstuhl gelangten. Diese Art von Karrieren empfand der Adel jedoch nicht als Konkurrenz, da ihm die Pforten der Kirche ebenso offen standen wie allen anderen Bevölkerungsgruppen und der hohe Klerus sich ohnehin vorzugsweise aus den Reihen des Adels rekrutierte. Neidgefühle gegenüber reichen Emporkömmlingen aus dem bäuerlichen oder bürgerlichen Milieu kamen erst auf, als sich die Lebensbedingungen der niederen Adelsgeschlechter im Spätmittelalter stetig verschlechterten. Die Pest hatte seit der Mitte des 14. Jahrhunderts ihren Todeszug durch Europa angetreten und für einen drastischen Bevölkerungsrückgang gesorgt. Ganze Landstriche verödeten, zahlreiche Dörfer starben völlig aus und wurden aufgegeben. Die nachlassende Nachfrage nach Agrarprodukten bewirkte einen Preisverfall, wodurch die Einnahmen nicht nur der Bauern, sondern auch der Grundherren rapide zurückgingen. Zwischen 1375 und 1450 sanken die Getreidepreise um mehr als die Hälfte – und das bei gleichzeitigem Lohnanstieg für die knapper werdenden Arbeitskräfte! Immer mehr Grundherren – betroffen waren vor allem die einfacheren Ritter – konnten ihren Lebensstandard nicht mehr weiterpflegen und sanken auf bäuerliches Niveau herab. Da der Geldwert wegen des immer geringeren Edelmetallgehaltes der Münzen auch noch sank, blieb manchen Grundherren kaum mehr das Nötigste zum Leben. Der „arme Ritter“ gehörte bald zum gewohnten Erscheinungsbild des Spätmittelalters. Den zwischen Preisverfall, Inflation und Lohnkostensteigerung in die Klemme geratenen Rittern fiel nichts anderes ein, als gegen die „Pfeffersäcke“ in den Städten und gegen die dörfliche Oberschicht, so weit noch vorhanden, mobil zu machen. Sie plünderten Kaufmannszüge auf den Straßen aus, beschlagnahmten widerrechtlich Handelsgüter und belasteten ihre verbliebenen Bauern mit unanständig hohen Forderungen. Dadurch nahmen die sozialen Spannungen gehörig zu und entluden sich nur wenig später in den Bauernkriegen und in der Reformation. Die relativ stabile Phase des Hochmittelalters war damit vorüber. Doch eine Botschaft nahm man für die kommenden Jahrhunderte mit auf den Weg: Risikobereitschaft, Innovationsfreude und Fleiß zahlten sich aus. Der „amerikanische Traum“ vom sozialen Aufstieg war eigentlich ein zutiefst europäischer.