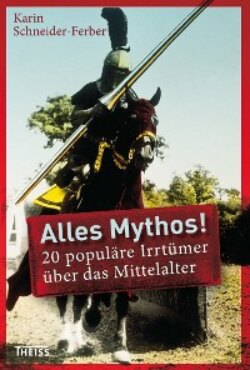Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über das Mittelalter - Karin Schneider-Ferber - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEinleitung
„Faszination“ und „Schrecken“ – mit diesen beiden Schlagwörtern könnte man unser heutiges Verständnis vom Mittelalter umschreiben. Faszination, weil uns die Epoche zwischen 500 und 1500 immer wieder in ihrer Fremdartigkeit und Exotik überrascht
und dennoch in ihren Bann zieht. Wir denken an hohe Burgen und schöne Edelfräulein, träumen von Minnedienst und Vasallentum, glauben an die vielzitierte „Ritterlichkeit“ der Mächtigen gegenüber den Schwächeren der Gesellschaft. Bewundernd sehen wir auf eine Zeit, in der scheinbar die Welt noch „in Ordnung“ war.
Andererseits können wir uns nur schwer vorstellen, wie das alltägliche Leben hinter den festen Mauern einer Burg ablief und mit welchen Entbehrungen und Beschwerlichkeiten die Menschen in den Dörfern und Städten zu Füßen der Herrschersitze zurechtkommen mussten. Kaum mehr nachvollziehbar ist, welches Entsetzen die ungezähmte Natur bei den Zeitgenossen bewirkte, die ständig von Missernten, Hungersnöten und Epidemien bedroht waren, und welcher Enthusiasmus sie trieb, genau in diese Wildnis zu ziehen, um als bäuerliche Kolonisten oder fromme Mönche die Ödnis zu kultivieren. Mit Befremden reagieren wir vor allem auf die religiöse Inbrunst dieser Epoche, die leidenschaftlich und kompromisslos den rechten Weg zu Gott suchte und häufig genug auf Abwegen landete. Denn was soll man schon halten von Mönchsrittern, die mit dem Schwert in der Hand nach Jerusalem zogen, um die heiligen Stätten des Christentums von der Herrschaft der Muslime zu befreien? Und was soll man über ein Papsttum denken, das mit Feuereifer zu den Kreuzzügen aufrief und die Teilnehmer mit Sündenablässen und Jenseitsverheißungen lockte? Hier beginnt der „Schrecken“ des Mittelalters, der mit religiösem Wahn, Inquisition, Hexenverbrennung und brutaler Folter gleichgesetzt wird, obwohl viele dieser Exzesse erst in der Neuzeit ihre volle Entfaltung fanden. Die Unduldsamkeit der Epoche gegenüber Andersdenkenden und Andersgläubigen erscheint in der Rückschau als primitiv und barbarisch, sodass man gerne vom „finsteren“ Mittelalter spricht.
Zwischen den Antipoden „Faszination“ und „Schrecken“ hat sich eine Reihe von Irrtümern und Vorurteilen über das schillernde Jahrtausend zwischen Antike und Neuzeit eingeschlichen. Die romantisch-verklärte Sicht auf das Mittelalter hat mit der Realität ebenso wenig zu tun wie das heilige Erschauern über seine negativen Seiten. Das Mittelalter ist nicht einfach da, sondern es wurde und wird immer neu geschaffen aus der Perspektive der späteren Jahrhunderte. So entwickelte jede Generation ihre eigenen Vorstellungen vom Mittelalter: Während die Humanisten es gemessen an den hohen Idealen der Antike mit Abscheu und Entsetzten als eine Zeit der Rückständigkeit betrachteten, sahen die Romantiker unter dem Eindruck der napoleonischen Befreiungskriege in ihm die „gute alte Zeit“ der Kaiserherrschaft und der nationalen Größe. Heute fällt der Umgang mit der Epoche differenzierter aus, doch auch wir betrachten die Vergangenheit durch eine Brille von eigenen Wertvorstellungen, von Wünschen und Sehnsüchten. Selbst wir haben nur eine leise Ahnung davon, was das Mittelalter in all seiner Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit ausmacht.
Lässt man den Schleier allzu überbordender Interpretation einmal fallen, tritt uns das Mittelalter als eine geistig rege und überaus innovationsfreudige Zeit entgegen. Viele Grundlagen, die unser modernes Leben prägen, stammen aus der Ära der Ritter und Mönche. Arbeitsteilung und beginnende Technisierung, Internationalisierung des Handels und zunehmende Bürokratisierung des Lebens sowie kommerzielles Denken und persönliches Gewinnstreben kündigen sich in dieser Epoche bereits an und nehmen viele spätere Entwicklungen vorweg. Gerade die mittelalterlichen Städte mit ihrer besonderen Rechtsstellung avancierten zu einem Experimentierfeld für zahlreiche wirtschaftliche und soziale Fragen. Schon damals stöhnten die Menschen über die zunehmende Arbeitslosigkeit durch den Einsatz von Maschinen, klagten über den unberechenbaren Preisverfall oder Preisanstieg durch die erste „Globalisierungsphase“ des Handels und machten sich Gedanken, wie das Heer der Armen durch die Solidargemeinschaft aufgefangen werden könnte. Manche Debatten, die wir heute führen, wurden schon im Mittelalter angedacht, so die Heranziehung von Fürsorgeempfängern zu gemeinnützigen Tätigkeiten, die obrigkeitliche Regulierung und Kontrolle eines als allzu marktradikal empfundenen Wirtschaftslebens oder die öffentliche Aufsicht über das Apotheken- und Medizinalwesen. Auch die Mindestlohn-Diskussion hat ihre frühen Vorläufer im Mittelalter, als man mit großer Leidenschaft über die Frage nach der richtigen Aufteilung der Steuern und Abgaben, nach dem „gerechten“ Lohn und dem „gerechten“ Preis stritt. Bauern- und Handwerkeraufstände, die sich wie ein roter Faden durch die mittelalterliche Geschichte ziehen, beweisen, mit welch großem Engagement man um eine ausgeglichenere Gesellschaftsordnung kämpfte. Streiks und Arbeitsniederlegungen waren schon damals gängige Methoden des Arbeitskampfes, die modernen Gewerkschaften könnten es nicht besser machen. Zumindest in den größeren Städten und Gemeinden gelang es „Otto Normalverbraucher“, sich über die Beteiligung der Zünfte am Stadtregiment Gehör zu verschaffen und politisch zu artikulieren. Die Zunft- und Ratsgremien wurden so nicht nur zu Keimzellen der kommunalen Selbstverwaltung, sondern auch zu Nährböden für die Entstehung einer weltlich-bürgerlichen Elite, von der bis heute das Funktionieren eines jeden Gemeinwesens abhängig ist.
Für den kleinen sozialen Aufstieg waren die Menschen schon recht früh bereit, Mühen und Arbeit zu investieren. Ob der Bauer, der seine angestammte Scholle verließ, um in Kolonisationsgebieten neu anzufangen, oder der Fernhandelskaufmann, der sich in weit entfernte Regionen begab, um seinen Profit zu machen, oder der Steinmetz, der sein Wissen von Baustelle zu Baustelle trug – sie alle zeigten sich flexibel und risikobereit in der Hoffnung, die eigene Lebenssituation und die ihrer Nachkommen zu verbessern. Die Überwindung langer Distanzen war dabei nicht abhängig vom Zustand der Verkehrswege oder von den Transportmöglichkeiten, sondern vollzog sich in erster Linie im eigenen Kopf. Die geistige Dumpfheit und Enge, die man dem Mittelalter gerne nachsagte, lässt sich in dieser Hinsicht nicht nachweisen. Aufbruchsstimmung, Neugierde und die Bereitschaft, neue Horizonte zu erschließen, prägten in hohem Maße das geistige Klima der Zeit. Zu einem wesentlichen Moment des sozialen Aufstiegs wurde, nicht anders als heute, die Bildung. Der Besuch einer bedeutenden Dom- oder Kathedralschule oder einer Universität ebnete den Weg zu einem öffentlichen Amt in städtischen oder fürstlichen Diensten, wenn auch längst nicht alle Studenten einen Abschluss schafften. Die Diskussionsfreude an Schulen und Universitäten brachte schließlich neue Denkansätze hervor, die sich vom Primat der Theologie lösten und den experimentellen Naturwissenschaften allmählich den Weg ebneten. Ohne die Universitäten mitsamt ihrer Forschungs- und Lehrfreiheit wäre unsere moderne Welt gar nicht zu denken. Ihrem offenen Erkenntnisstreben ist es zu verdanken, dass das Mittelalter eben gerade nicht in seiner „mittelalterlichen Finsternis“ verharrte.
Gelehrte und Professoren rekrutierten sich überwiegend aus dem Klerikerstand, sodass die Kirche am geistigen Aufbruch ihrer Zeit ihren guten Anteil hatte. Kleriker beschäftigten sich nicht allein mit Theologie, sondern auch mit naturwissenschaftlichen Studien, mit Recht und Philosophie. Sie beobachteten die Gestirne, Pflanzen, Mineralien, setzten sich mit optischen Phänomenen und mathematischen Formeln auseinander. Dies ist die andere, unbekanntere Seite der Kirche, die man ansonsten eher mit Ketzerverfolgung und einer abstrusen Dämonenlehre in Verbindung bringt. Nur auf den ersten Blick erscheint die Kirche in ihrem Denken als rückständig und engstirnig, auf den zweiten legt sie eine überraschende Offenheit den Wissenschaften gegenüber an den Tag und zeigt das ehrliche Bemühen, den Glauben mit Hilfe der Vernunft zu untermauern. Die Kirche bot mit ihrer alternativen Lebensführung einen Gegenentwurf zum weltlichen Dasein, den viele Menschen als anziehend empfanden. In den Klöstern blühten Bildung und Kultur, wurden Musik und Dichtung gepflegt. Mit ihrem Bemühen, den allgemeinen Frieden in der „Gottesfriedensbewegung“ zu sichern sowie die eigenen Reihen mit Hilfe zahlreicher Reform- und Armutsbewegungen zu erneuern, gab die Kirche ihrer Zeit immer wieder wesentliche Impulse.
Werfen wir also einmal einen Blick auf die überraschenden Facetten des Mittelalters, lassen wir uns verzaubern von ihren modernen und vielschichtigen Bezügen. 20 populäre Irrtümer werden in diesem Buch aufgegriffen, um an ihnen zu zeigen, dass die Epoche mehr zu bieten hat als Folterkeller und Scheiterhaufen. Wenn wir unvoreingenommen an diese Zeit herantreten, kommen wir ihren Menschen, wie sie aus einer Vielzahl von Quellen zu uns sprechen, ein klein wenig näher und spüren, dass sie uns gar nicht so fremd sind. Der Ritter auf seiner Burg, der Mönch in seinem Kloster, der Bürger in seiner Stadt, der Kaiser hoch zu Ross – sie hinterließen eine Welt, die uns nachhaltig prägte und die näherer Betrachtung wert ist.