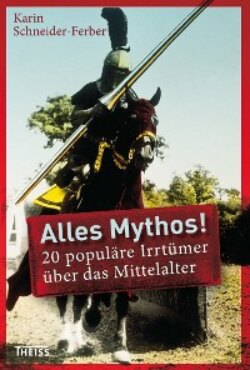Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über das Mittelalter - Karin Schneider-Ferber - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ritter waren edel und gut
ОглавлениеSo kennt man und so liebt man sie: Hoch zu Ross, den Leib in schimmerndes Eisen gehüllt, die bunte Helmzier auf dem Kopf und den prunkvollen Wappenschild in der Hand – eine wahrhaft sinnliche Verkörperung von Macht und militärischer Stärke, von Wagemut und Heldentum. Die auf Hochglanz polierten Ritter des Mittelalters boten einen faszinierenden Anblick und beflügelten damit noch die Fantasie der Nachwelt kräftig. Kein Stand hat das Bild der Epoche so nachhaltig geprägt wie sie. Unter „ritterlich“ versteht man bis heute ein anständiges, ehrbares Auftreten und unter „höflich“ die Beherrschung guter Umgangsformen. Doch der Glanz der Rüstungen und Waffen überstrahlte so manchen dunklen Fleck in der Geschichte des Rittertums, und bei genauer Betrachtung lassen sich gar Ansätze von Rost ausmachen. Denn die Berufskrieger des Mittelalters waren hartgesottene Burschen, deren Handwerk Tod und Elend über das Land brachte. Sie selbst fristeten ein risikoreiches und zumeist recht kurzes Leben, und je mehr sie im Spätmittelalter an militärischer Bedeutung verloren, umso mehr fielen sie aus ihrer gesellschaftlichen Rolle.
Vornehm ging es bei den alten Rittersleut schon allein deshalb nicht zu, weil die meisten von ihnen Aufsteiger von ganz unten waren. Dies hing mit der Ausbildung des Lehnswesens und dem Aufbau eines Reiterheeres seit dem Frühmittelalter zusammen. Die Ritterschaft verdankte nämlich ihre Entstehung als erste „Berufsarmee“ Europas den militärischen Notwendigkeiten des 9. Jahrhunderts. Dem Ansturm der wilden Wikinger-, Normannen- und Ungarnscharen hatten sich nur mobile Reitereinheiten gewachsen gezeigt, während die zu Fuß kämpfenden einfachen Bauerntrupps alten Zuschnitts schmählich versagten. Die Umstellung auf ein Reiterheer war allerdings eine kostspielige Angelegenheit, denn Schlachtpferde, Rüstung und Waffen mussten angeschafft und dauerhaft unterhalten werden. Das konnte nicht jedermann leisten. Die Entstehung der schweren Panzerreiterei ging daher mit dem Aufbau des Lehnswesens Hand in Hand. Reichere Grundbesitzer und Adlige übertrugen ihren bewaffneten Gefolgsleuten ein Stück Land, ein Lehen, für ihren Lebensunterhalt. Dafür waren diese zu besonderer Treue und zum Militärdienst an ihrem Herrn verpflichtet. An der Spitze dieser Lehnspyramide stand der König als oberster Lehnsherr, dann folgten weltliche und geistliche Großvasallen, die ihrerseits wieder Lehen vergaben bis hinunter zur breiten Schicht der Ministerialen. Ritter zu sein bedeutete daher nicht zwangsläufig von Adel zu sein, da eben auch unfreie Dienstleute in den Genuss eines Lehens kommen konnten. Die neue Krieger-Elite, für die erst im 12. Jahrhundert vermehrt der Begriff „Ritter“ aufkam, umfasste dementsprechend den hochwohlgeborenen Fürsten wie den einfachen Haudegen. Diese bunt zusammengewürfelte Schar besaß noch kein rechtes Standesbewusstsein. Die meisten der neuen Herren führten auf ihren Höfen und Burgen ein recht bescheidenes Leben, das sich gar nicht sonderlich von ihrer bäuerlichen Umwelt abhob. Erst mit dem 13. Jahrhundert grenzte sich der Ritterstand sozial nach unten hin ab und rechnete sich zum niederen Adel. Die höfische Kultur, die an den größeren Fürstenhöfen um diese Zeit gepflegt wurde, sollte den Abstand zum übrigen Volk unterstreichen.
Als Spezialisten des Krieges durften die Ritter nicht zimperlich sein. Sie bildeten die Elite des Heeres und blieben es unbestritten bis zum Ausgang des Mittelalters. Alles an ihnen war von frühester Jugend an auf die Ausübung von Gewalt hin getrimmt. Ungefähr mit dem 10. Lebensjahr kamen die Söhne der Lehnsmänner an einen befreundeten Hof zur Erziehung, um sich erstmals im Umgang mit Waffen zu üben oder als Waffenträger zu fungieren. Mit ungefähr 14 Jahren dienten sie einem Ritter als Knappen und mussten als solcher notfalls bereits mit in eine Schlacht ziehen. Wenn der Junge im Reiten geschickt war und mit Schwert und Lanze umzugehen verstand, konnte er einige Jahre später, etwa zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr, zum Ritter geschlagen werden. Ein besonderes Zeremoniell – zunächst die Schwertleite, das feierliche Umgürten mit dem Schwert, seit dem 14. Jahrhundert der Ritterschlag mit der flachen Klinge des Schwertes auf Nacken oder Schulter – besiegelte die Aufnahme des jungen Mannes in den Kreis der waffenfähigen Männer.
Das Kampftraining war hart und forderte die volle physische Belastbarkeit des jungen Kriegers. Allein das Tragen der schweren Ritterrüstungen bedeutete einen kleinen Kraftakt. Bis zum 12. Jahrhundert bestand die Rüstung aus einem knielangen Kettenhemd mit Kapuze, über der man einen Helm mit Nasenschutz trug. Der Kampf Mann gegen Mann erforderte jedoch bald einen besseren Schutz, und so wandelte sich die Rüstung im Laufe der Zeit zu einer vollen Montur aus Eisen bis hinunter zu den Füßen. Als Kopfschutz setzte man sich topfförmige Helme mit nur kleinen Sehschlitzen, später aufwändige, aber umso schwerere Visierhelme auf das Haupt. Eine Rüstung konnte so leicht ein Gewicht von 25 bis 38 Kilo erreichen. Mit diesem Ballast am Körper zog der Ritter in den Kampf. Kein Wunder, wenn ihm im Kampfgetümmel oder bei hohen Sommertemperaturen der Herzschlag oder der Erstickungstod unter seinem schweren Helm drohte. Kam es zum Kampf auf dem Schlachtfeld, spürte man von der vielbesungenen „Ritterlichkeit“ wenig. Die „edlen“ Ritter kannten nämlich keine Schlachttaktik, sondern rasten zu Pferd und mit der Lanze im Anschlag in vollem Galopp einfach aufeinander zu, nach dem bewährten Motto „Erst dreinschlagen, dann weitersehen“. Das Legen von Hinterhalten oder das Zurückhalten von Reserven galten dagegen als höchst unsportlich. In der Regel mündeten die großen Ritterschlachten daher allesamt in ein wüstes Abschlachten. Die bis zu fünf Meter langen Lanzen entwickelten eine gewaltige Stoßkraft und richteten fürchterliche Verwundungen an. War der Ritter erst einmal von seinem Ross gefallen wie ein Apfel vom Baum, hatte er kaum eine Chance, alleine wieder auf die Beine zu kommen. Dann erwartete ihn ein unrühmliches Ende. Anstelle eines klassischen Zweikampfs von Ritter zu Ritter traf ihn die Hand eines wenig zartfühlenden Trossknechts oder Fußsoldaten, der ihm mit einem Schnitt durch die Kehle oder durch einen gezielten Messerstich in die Augenschlitze des Helms den Garaus machte. Oder er wurde einfach mit Keulen erschlagen, wie dies dem jungen deutschen König Wilhelm von Holland 1256 geschah, nachdem er im Kampf gegen die Friesen mit seinem Pferd im Wintereis eingebrochen war. Die kostbare Rüstung nahm in der Regel der Sieger an sich, sodass der Gefallene ausgeraubt und nackt auf dem Schlachtfeld zurückblieb. Gefangene wurden nur gemacht, wenn der Rang des Ritters ein fettes Lösegeld versprach. Das Gros der getöteten Kämpen landete dagegen in einem rasch ausgehobenen schnöden Massengrab.
Da den Rittern auf den Schlachtfeldern also nicht unbedingt der Heldentod winkte, nahmen sie jede Gelegenheit wahr, große Schlachten zu vermeiden und sich mit einer Taktik der verbrannten Erde an ihren Feinden schadlos zu halten. Da wurden Dörfer niedergebrannt, Äcker verwüstet, Städte belagert und gebrandschatzt. Eine beliebte Methode war das Belagern gegnerischer Burgen bis zum Aushungern. Das sparte Kräfte und führte gleichfalls zum Ziel. Die Kirche versuchte vergeblich, dieses wüsten Treibens Herr zu werden. Seit dem 11. Jahrhundert breitete sich von Südfrankreich her die Gottesfriedensbewegung aus, welche das Fehdewesen und die schlimmsten Gewaltexzesse, unter denen besonders das einfache Volk zu leiden hatte, zu begrenzen suchte. Allerdings mit wenig Erfolg. Die häufigen Kriegszüge der Könige und Kaiser und die ständigen Fehden des Adels sorgten für ein anhaltendes Gewaltpotenzial in der Gesellschaft. Nur allmählich setzte eine Verchristlichung des Rittertums ein. „Zu welchem Zweck ist das Rittertum geschaffen? Die Kirche zu schützen, den Unglauben zu bekämpfen, das Priestertum zu ehren, die Armen vor Unrecht zu schützen, das Land zu befrieden, das eigene Blut zu opfern, und, wenn nötig, das Leben hinzugeben für die Brüder“, gab Johannes von Salisbury im 12. Jahrhundert den Rittern als Handlungsanweisung mit auf den Weg. Er wollte die Ritterschaft damit in den Dienst der Kirche einbinden und zur Beachtung christlicher Wertvorstellungen anhalten. Die kirchlichen Appelle führten dazu, dass sich allmählich ein ritterlicher Verhaltenskodex herausbildete, zu dem der Schutz der Armen und Wehrlosen, der Witwen und Waisen, die Wiederherstellung von Recht und Ordnung und natürlich der Schutz und die Verteidigung des Glaubens zählten. Soweit die Theorie – die Praxis indes sah anders aus. In einer Zeit, die es gewohnt war, das Recht mit der Faust zu suchen, nahmen Häufigkeit und Brutalität des Kriegsgeschehens auch durch den Einfluss der Kirche nicht ab. Im Gegenteil: Dort, wo Heiden oder „Ungläubige“ die Gegner waren, ließ sich nun umso ungenierter wüten. Ob die Pruzzen im Osten, die Mauren in Spanien, die Muslime im Vorderen Orient oder die Ketzer im eigenen Land – der Ritter durfte sicher sein, im Dreinschlagen ein gottgefälliges Werk zu verrichten. Und wie es seinem Naturell entsprach, legte er sich dabei keinerlei Zügel an.
Die Gewalt gehörte zum Alltag, doch zuweilen litten auch die Gewaltausübenden selbst unter ihr. Das Kriegerdasein bedeutete für die Ritter eine schwere Belastung. Die ständigen Kriege und Fehden führten sie oft wochen- und monatelang in die Fremde, in der ein ungewisses Schicksal auf sie wartete. Viele kehrten verwundet in die Heimat zurück, und so manche Verletzung vernarbte überhaupt nie. Knochenbrüche konnte die mittelalterliche Heilkunst noch kurieren, bei inneren Verletzungen dagegen versagte die ärztliche Kunst. Wundbrand endete häufig tödlich. Die Lebenserwartung eines Durchschnitts-Ritters lag daher nicht besonders hoch – wer das 40. Lebensjahr erreichte, musste schon sehr zufrieden sein. Aber selbst mitten im Frieden am heimischen Herd wartete nicht das uneingeschränkte Glück auf ihn. Abgesehen davon, dass die Wohnverhältnisse in einer Burg von räumlicher Enge, Feuchtigkeit und Kälte geprägt waren, mühte sich der Hausherr mit der Verwaltung seiner Güter und der Instandhaltung der Verteidigungsanlagen ab. Wer kein allzu großes Lehen besaß, lebte nicht gerade im Überfluss. Haushalten und Sparen waren auch für einen Rittersmann keine Fremdwörter. Umso schwerer wogen die zum Teil erheblichen Ausgaben für Repräsentation, zum Beispiel die üppige Bewirtung von Gästen und die Teilnahme an Turnieren. Gerade Turniere gehörten zum gesellschaftlichen Pflichtprogramm eines Ritters. Die Kampf- und Reiterspiele dienten zwar ursprünglich der militärischen Ertüchtigung, waren aber gleichzeitig wichtige gesellschaftliche Ereignisse, die im Rahmen bestimmter Feierlichkeiten – Hochzeiten, Hoftage oder Ritterweihen – stattfanden. Eines der größten Feste dieser Art veranstaltete Kaiser Friedrich I. Barbarossa zu Pfingsten 1184 auf der Maaraue bei Mainz anlässlich der Schwertleite seiner Söhne Heinrich und Friedrich. Eine ganze Zeltstadt und Gebäude aus Holz hatte man für das gewaltige Spektakel errichtet, zu dem über siebzig Reichsfürsten mit ihrem Gefolge und mehrere Tausend Ritter erschienen. Das geplante Turnier fiel wegen eines heftigen Sturms zwar aus, doch so mancher Ritter dürfte darüber gar nicht so traurig gewesen sein. Denn ein Turnier barg immer das Risiko ernsthafter Verletzungen, wenn nicht gar des Todes.
Der übliche „Tjost“ führte zwei vollbewaffnete Männer hoch zu Ross mit der Lanze unter dem Arm zum Zweikampf in die Arena. Die Lanzenkämpfer ritten in vollem Galopp aufeinander zu und versuchten sich mit einem gezielten Stoß aus dem Sattel zu heben – ein gewagtes Spiel mit offenem Ausgang. Als Gruppenkampf nannte man den „Tjost“ einen „Turnei“. Hier ging es im Getümmel erst recht hoch her, denn die kämpfenden Gruppen sprengten geschlossen aufeinander zu, um möglichst viele Gegner aus dem Sattel zu heben. Da splitterten die Lanzen, da flogen die Leiber, da stürzten die Pferde, da erehoben sich die Schmerzensrufe. Wer im Sattel blieb, musste rasch wenden und erneut auf Angriff reiten und darauf achten, dass er dabei ja nicht von einem gegnerischen Kämpfer gefangen genommen wurde. Wenn gar nichts mehr ging und die Gruppen völlig aufgelöst waren, stiegen die Ritter von den Pferden herab und kämpften mit dem Schwert weiter.
Nur wenig zivilisierter nahm sich der „Buhurt“ aus, ein Massenkampf zwischen zwei Parteien, bei dem es zwar mehr um Reitergeschicklichkeit ging, der aber trotzdem meist in einem wilden Chaos aus Staub, Pferdeleibern und gestürzten Rittern endete. Im Laufe der Zeit stumpfte man die Turnierwaffen ab, doch das Verletzungsrisiko blieb nach wie vor hoch. 1175 zählte man in Sachsen 16 tote Turnierteilnehmer, 1240 kamen in Köln gar 40 Ritter und Knappen ums Leben. Selbst hochwohlgeborene Fürsten wie Graf Gottfried von der Bretagne (gest. 1186) oder Herzog Leopold von Österreich (gest. 1196) starben an den Folgen von Turnierverletzungen. Als einen der letzten traf dieses Schicksal den französischen König Heinrich II. im Jahr 1559, als ihm der splitternde Schaft einer gegnerischen Lanze durch das Visier ins Auge drang. Er starb nach mehrtägigem, qualvollem Todeskampf. Zur Lebensgefahr trat zusätzlich noch der finanzielle Schaden, denn wer im Kampfgetümmel vom Pferd fiel, musste Pferd, Rüstung und Waffen dem Sieger übergeben und zuweilen noch ein üppiges Lösegeld drauflegen. Erfolgreiche Ritter zogen gar von Turnier zu Turnier, um ihren Lebensunterhalt mit den erbeuteten Trophäen aufzubessern. Die Kirche verbot 1130 das riskante Spektakel, doch vergebens. Die Faszination, die von den Kampfspielen ausging, blieb ungebrochen. „Als die Ritter auf dem Felde waren, bot das einen herrlichen Anblick: Man sah die reichen, lichten Banner, die Speere nach dem Wunsch der Ritter verschieden bemalt, die Helme prächtig geschmückt. Die leuchtenden Farben der Rüstungen wetteiferten mit der Sonne“, schrieb begeistert Ulrich von Lichtenstein über ein Turnier in Friesach 1224. „Man gab den Rossen die Sporen, zu kräftigem Stoß sprengten die Ritter aufeinander los, Mann und Ross sah man stürzen. Mächtig krachten die Speere, heftig stießen die Schilde aneinander, davon schwollen die Knie. Beulen und Wunden von den Speeren gab es genug.“ Im Spätmittelalter, als die Turniere ihren militärischen Sinn und Zweck schon längst verloren hatten, mutierten die Veranstaltungen zu einem reinen Schaulaufen des Hochadels. Turnierordnungen grenzten den Teilnehmerkreis auf die vornehmen Rittergeschlechter ein.
Im Gegensatz zur rauen Wirklichkeit wirkt das höfische Idealbild des Ritters, das in der hochmittelalterlichen Epik vielfach besungen und gefeiert wurde, wie ein Traumgebilde. Ausgehend von den französischen Artus-Dichtungen des 12. Jahrhunderts verbreitete sich in ganz Europa ein neues, stark verfeinertes Kulturverständnis. Der sagenhafte König Artus, der seine historischen Vorbilder im keltisch geprägten Britannien des 5./6. Jahrhunderts hatte, galt als der Inbegriff des gerechten, Frieden stiftenden und milden Königs. Die Ritter seiner Tafelrunde, allen voran die edlen Recken Erec, Lancelot, Parzival, Galahad, Tristan und Gawain, bestanden in der Dichtung nicht nur eine Menge Abenteuer, kämpften gegen Ungeheuer und Bösewichte, retteten in Not geratene Jungfrauen oder erlösten verwunschene Burgen von ihrem Zauber, ihr Tun diente immer auch einem höheren Zweck. In den höchsten Tönen feierte man die ritterlichen Tugenden der Ehre, Treue, Milde, Güte, Zucht und der maßvollen Zurückhaltung, jedes bestandene Abenteuer präsentierte sich als ein Weg zur Selbstfindung und zur Selbstvervollkommnung. Die Suche nach dem heiligen Gral und den Grundwerten des Christentums versprach schließlich die letzte Erlösung und Vollendung menschlichen Daseins. In dieser schwärmerischen Welt der Riesen, Zauberer, Feen und Jungfrauen fand die gewaltbereite Kriegerelite des Hochmittelalters ihr Wunschbild. Wie die Ritter der Tafelrunde wollten sie alle sein: Immer im Einsatz für das Gute und Edle, zu jedem Abenteuer bereit, die Frauen und die Schwachen schützend. Eine Art James-Bond-Version des Hochmittelalters. Diese Idealwelt ahmte die höfische Kultur nach. Sich „höfisch“ benehmen hieß: Bei Tisch Zurückhaltung wahren, Frauen mit vollendeten Umgangsformen begegnen, im Kampf die Fairness wahren und in allen Lebenslagen maßvoll und großzügig reagieren. Selbst der derbste Haudegen musste nun ein gewisses Maß an Benimm erlernen, wollte er bei Hof nicht durchfallen und zum Gespött der Frauen werden. Ein paar Brocken Französisch zu beherrschen war angebracht, auch mal das Tanzbein zu schwingen nicht verkehrt und hin und wieder seine Holde mit einem kleinen Gedicht zu überraschen mit Sicherheit von Vorteil. Die unerfüllte, platonische Liebe zu einer verheirateten, sozial höher stehenden Frau galt als höchstes Ideal, das im Minnesang in schmachtenden Versen vielfach verklärt wurde. Die Übernahme französischer Sitten und Moden und die Freizeitgestaltung mit „friedlichen“ Vergnügungen wie Musik und Gesang führten tatsächlich zu einer gewissen Zivilisierung des gesellschaftlichen Lebens. Doch blieb das auf die größeren Fürstenhöfe beschränkt, die allein in der Lage waren, ein umfangreiches Gefolge mit Spielleuten, Gauklern und Minnesängern zu unterhalten sowie Turniere und andere Festivitäten für viele Gäste zu finanzieren. Die Masse der Ritter lebte nach wie vor in einer rauen Umwelt und träumte allenfalls nachts von den Helden der Artus-Sage.
Allem höfischen Glanz zum Trotz verschlechterten sich im Spätmittelalter die Rahmenbedingungen für die Ritterschaft zunehmend. Böse Nachrichten trafen im Laufe des 14. Jahrhunderts von den Schlachtfeldern Europas ein. Zu Beginn des Hundertjährigen Krieges zwischen Frankreich und England hatte ein französisches Ritterheer in der Schlacht von Crécy (1346) gegen die Langbogenschützen des englischen Heeres eine herbe Niederlage einstecken müssen. Der Pfeilhagel der Bogenschützen, die bis zu zwölf Pfeile pro Minute abfeuern konnten, war ihnen zum Verhängnis geworden.
Die französischen Ritter dagegen hatten die Langbogen als „Bauernwaffen“ verschmäht, da diese nicht ihrem Idealbild vom Kampf Mann gegen Mann entsprachen. Auch in den großen Reiterschlachten von Poitiers (1356), Sempach (1386) oder Näfels (1388) zogen die eisenstrotzenden Elitekrieger gegenüber der neuen Waffentechnik den Kürzeren. Die neuen Langbogen mit einer Reichweite von etwa 200 Metern holte sie schon vom Sattel, ehe sie das Schlachtfeld erreicht hatten. Die schwer zu spannende, aber ständig weiter verbesserte Armbrust brachte es gar auf eine Reichweite von 400 Metern und durchbohrte mit ihrer Wucht selbst die dickste Ritterrüstung. Die neue Militärtechnik begann den schwer gepanzerten Ritter zu überholen, obwohl die Kirche die neuen Fernwaffen verdammte. Besonders bitter war zudem, dass die wirkungsvollste Neuerung von einem aufmüpfigen Bauernvölkchen aus den Schweizer Alpen stammte. Die Eidgenossen führten eine völlig neue Kampftechnik auf dem Kriegsschauplatz ein, indem sie mit Stangenwaffen ausgerüstete Fußtrupps in geschlossenen Karrees aufmarschieren ließen. Mit ihren langen Hellebarden bildeten die Schweizer einen Stachel-Block, der von den Rittern auf ihren Pferden kaum aufzubrechen war und diese schon aus einer gewissen Distanz heraus zu Boden holte. Seit ihrem überragenden Sieg gegen ein österreichisches Ritterheer 1315 bei Morgarten waren die schlagkräftigen Schweizer hoch angesehen und verbreiteten als Söldner diese Kampfmethode, auf die bald kein Fürst mehr verzichten wollte, in ganz Europa. Selbst ein so romantisch veranlagter Kaiser wie Maximilian I. (geb. 1459), der sich selbst gern als „letzter Ritter“ bezeichnete, engagierte lieber bezahlte Landsknechtsfähnlein anstelle der altehrwürdigen Panzerreiter. Die Ritterschaft machte die traurige Erfahrung, dass sie militärisch überholt war. Den letzten Rest gab ihr das Aufkommen der ersten Feuerwaffen. Seit im 13. Jahrhundert das Geheimnis des Schießpulvers von China nach Europa gelangt war, versuchten Waffenexperten allerorten aus dieser Mischung eine tödliche Kriegswaffe zu entwickeln. 1326 goss man in Florenz die ersten Metallgeschütze, und auch aus England trafen erste Nachrichten von einer Handfeuerwaffe ein. Auch wenn es noch eine Weile dauerte, bis diese Waffen zur vollen Einsatzreife gediehen, dämmerte den Rittern auf ihren Burgen doch, dass die Tage ihres militärischen Einsatzes gezählt waren. Zu allem Übel kam Mitte des 14. Jahrhunderts auch noch eine tiefgreifende Agrarkrise hinzu, ausgelöst durch die verheerenden Pestepidemien. Die Felder verödeten, die Agrarpreise sanken in den Keller, und die Ritter saßen vor leeren Speichern. Viele von ihnen reagierten so, wie sie es von Anfang an gelernt hatten: mit Gewalt.
Eine Landpartie zu machen war im Spätmittelalter nicht unbedingt ratsam. Denn eine Reihe finsterer Gesellen lauerte auf den Landstraßen und in der Nähe der Städte. Ihre Namen klangen dem Reisenden schauerlich in den Ohren: Thomas der Handabhacker, Mangold der Geißelschinder, Johann der Marktschiffschinder. Die Raubritter machten das Reisen für friedliche Bürger und Kaufleute zu einem Alptraum. Unter dem Vorwand des Fehderechts gingen sie auf Beutezug, verwüsteten ganze Dörfer oder Städte, plünderten und holten sich, was ihnen fehlte. So raubte Graf Otto von Tecklenburg 1364/65 von den bäuerlichen Untertanen seines Gegners sage und schreibe 227 Kühe, 1005 Schafe, 95 Pferde und 50 Schweine! Auch der Prignitzer Vogt Klaus Rohr missbrauchte 1365 seine Machtposition, um unter dem Vorwand des Fehderechts Dörfer niederzubrennen, Vieh zu rauben und die Fischteiche zu leeren. Selbst die Kirchenglocken in den Pfarrkirchen waren vor seinem Zugriff nicht sicher, was von der zeitgenössischen Chronistik als besondere Schandtat angeprangert wurde. Nicht weniger wild trieb es Dietrich von Quitzow in der Mark Brandenburg: Er legte Bauernhöfe, Scheunen und ganze Städte in Schutt und Asche, indem er seine Pfeilspitzen in eine klebrige Masse aus Apfel- und Quittensaft tauchte, dann mit Schwefel, Pech und Rosshaaren bestrich und als brennende Fackeln auf sein Ziel abschoss. 1406 eroberte Dietrich gemeinsam mit seinem Bruder Johann Stadt und Burg Köpenick und startete von diesem Hauptquartier aus seine Beutezüge gegen Berliner Bürger. Die Fehde mit der Stadt Berlin artete in einen regelrechten Kriegszug aus. Erst Burggraf Friedrich von Nürnberg aus dem Hause Hohenzollern, der 1411 von Kaiser Sigismund als Landesverweser der Mark Brandenburg eingesetzt wurde und später zum Kurfürsten aufstieg, stellte die Ordnung mit viel Mühe wieder her. Auch andernorts litten wohlhabende Städte unter räubernden, fehdeführenden Adligen, die Kaufmannszüge überfielen, die Waren raubten und satte Lösegelder für die Freilassung ihrer Gefangenen verlangten oder ungerechtfertigte Zölle und Durchgangsgelder einforderten. So lag auch das fränkische Adelsgeschlecht der Guttenberg immer wieder mit der Reichsstadt Nürnberg im Clinch. Mächtigen Städten gelang es, sich erfolgreich zu wehren und manchen Widersachern innerhalb ihrer Mauern sogar den Prozess zu machen. Zuweilen schlossen sich die Städte zu Städtebündnissen zusammen, um gegen die Rechtsbrecher vorzugehen, die sich ihrerseits allerdings wieder in Ritter- und Adelsgesellschaften organisierten, sodass das Hauen und Stechen fröhlich weiterging. Erst das Erstarken der Territorialmächte in der Frühen Neuzeit setzte dem Raubrittertum dann endgültig ein Ende.
Das üble Bild, das das Rittertum am Ausgang des Mittelalters abgab, trübte nicht den weltfremden Idealismus, den es verströmte. In der Nachwelt blieb vielmehr die Erinnerung an den edelmütigen, vor Kraft und Tugend strotzenden Ritter haften. Selbst Kaiser Maximilian I. kämpfte noch in Turnieren mit und beschwor in literarischen Ergüssen den Ehrenkodex eines längst untergegangenen Standes. Die Diskrepanz zwischen dem romantisch-verklärten Ritterbild und der recht schnöden Realität hatte dabei durchaus Züge des Tragikomischen. Der spanische Dichter Miguel de Cervantes hat dem Ritter in der traurigen Gestalt in seinem Roman „Don Quichotte“ (1605/15) ein liebevolles Denkmal gesetzt. Etwas aus der Mode gekommen und verstaubt, stürzt sich da der schräge Ritter Don Quichotte in allerlei sinnlose Abenteuer und kämpft einen verzweifelten Kampf gegen die Windmühlen und sich selbst. Der Weltentrückte, der auf einem mageren Klepper hinaus ins Leben zieht und nur durch seinen pfiffigen Begleiter Sancho Panza vor allzu großen Torheiten bewahrt wird, erobert sich weder Ruhm noch Reichtum, dafür aber die Herzen seiner Leser, die er für seine Traumwelt längst verflossener Ritterherrlichkeit begeistern kann.