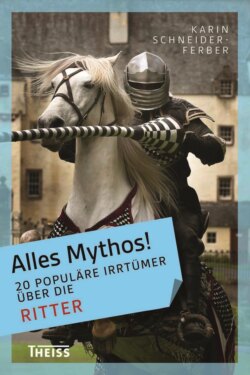Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über die Ritter - Karin Schneider-Ferber - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IRRTUM 1: Ritter kämpften mit ritterlichen Methoden
Оглавление„Schwer tobte der Kampf und es erhob sich das Tosen des Krieges; mit ihren Waffen brachen sie in die dicht gedrängten Schlachtreihen der Sachsen ein, freudig schleuderten sie überall die Leiber beiseite, als wenn die Sichel das reife Korn schnitte. Mit dem Schwert mähten sie die Häupter, wie bei der Ernte – ein schrecklicher Anblick! – und mit dem Schwert bahnten sie sich überall einen Weg mitten durch die Feinde.“ Mit diesen martialischen Worten beschreibt der Autor des Liedes vom Sachsenkrieg die blutige Schlacht, die zwischen König Heinrich IV. und seinen aufständischen Untertanen, den Sachsen, im Jahr 1075 an der Unstrut tobte. Er scheut keine Mühe, das Gemetzel in drastischen Bildern zu schildern: „Der eine stürzte auf den Feind und trat dabei auf seine eigenen Eingeweide, der andere zog den kalten Stahl aus dem eigenen Körper, und sterbend erschlug er den Feind, der ihn tötete.“ Ein grausames Blutbad erwartete die Unterlegenen. „Gegen das gemeine Fußvolk (der Sachsen, Anm. K. S.-F.) wütete die feindliche Unmenschlichkeit so über alles Maß und alle Schranken hinaus, dass sie, alle christliche Ehrfurcht vergessend, Menschen abschlachteten wie Vieh“, berichtet der zweite Gewährsmann, Lampert von Hersfeld, über die Vorgänge an der Unstrut.
Hätte man einen Ritter im Mittelalter nach seinem Selbstbild gefragt, wäre mit Sicherheit eine ganz andere Einschätzung herausgekommen. Nicht die Rolle des Schlächters, sondern die des unermüdlichen Kämpfers für das Gute und Gerechte wäre in den Vordergrund getreten. „Der Ritterstand ist erhabener und edler, als sich die Vorstellungskraft ausmalen kann, und kein Ritter sollte zulassen, dass er sich durch Feigheit oder eine gemeine oder falsche Tat entehrt, sondern wenn sein Helm auf seinem Kopf sitzt, sollte er kühn und grimmig sein wie ein Löwe, sobald er die Beute sieht“, erinnerte König Johann von Portugal am Vorabend der Schlacht von Aljubarrota 1385 die Seinen an das hehre Ideal. Doch die Realität des Kriegsalltags sah anders aus. Anstelle von Heldentaten erwartete die Kämpfenden im Schlachtgetümmel ein blutiges Gemetzel, statt ritterlicher Zweikämpfe Mann gegen Mann ein wüstes Hauen und Stechen jeder gegen jeden mit oft tödlichem Ausgang. Denn wie in jedem anderen Krieg ging es auch bei mittelalterlichen Waffengängen um nichts anderes als um Sieg oder Niederlage, um Töten oder Getötetwerden. Die Konsequenzen waren absehbar: brutale Kampfhandlungen mit hohem Verletzungs- und Todesrisiko, Übergriffe auf unbeteiligte Zivilisten, Verwüstungen und Plünderungen des Umlands, Gefangennahmen und Erpressung von Schutz- und Lösegeldern.
Dass sich in der Nachwelt trotzdem das Bild des ritterlichen, tugendhaften, zum Schutz von Armen, Schwachen und Waisen ausziehenden Reiterkriegers festgesetzt hat, liegt an der äußerst cleveren „Selbstvermarktung“ des Ritterstandes. In der höfischen Dichtung, in Epen und Heldenliedern erscheint der Ritter als selbstloser Kämpfer für Recht und Ordnung, der seinem unterlegenen Feind Gnade gewährt, Frauen und Kleriker schützt, sich im Kampf keine Tricksereien und Täuschungsmanöver erlaubt und für eine gerechte Sache streitet. Die Heldenlieder feiern die Einzeltaten des wackeren Recken, der sich fair benimmt und dennoch seine Feinde unterwirft. Doch dieser schöne Schein ließ sich in der Praxis kaum aufrechterhalten.
Krieg bedeutete im Mittelalter wie zu jeder anderen Epoche auch eine gewaltvolle, brutale Auseinandersetzung. Die Berichte über den blutigen Verlauf von Schlachten sind Legion. Auch wenn die Chronisten oft gehörig übertrieben, um den Gegner zu diffamieren oder den eigenen Sieg propagandistisch zu überhöhen, geben sie dennoch einen recht realistischen Einblick in den „normalen“ Kriegsalltag. „Der Schall der Trompeten eröffnete auf beiden Seiten die Schlacht“, berichtet Wilhelm von Poitiers über die Schlacht von Hastings 1066. „Die normannischen Fußtruppen rückten heran und brachten Wunden und Tod über die Engländer mit ihren Wurfgeschossen. Diese leisteten tapferen Widerstand, jeder nach seinen Möglichkeiten. Sie warfen Speere und jede erdenkliche Art von Wurfgeschossen, die äußerst tödlichen Äxte und Steine, die an Holzstücken befestigt waren.“ Der Ausgang der Schlacht, der den Normannen unter Wilhelm dem Eroberer die Herrschaft über England sicherte, war kein schöner Anblick: „Der Grund war weit und breit mit Leichen übersät, mit Blut getränkt. (…) Neben dem König (Harald) fand man seine beiden Brüder. Er selbst war völlig ausgezogen worden und durch kein äußeres Merkmal, das auf seinen königlichen Rang verwiesen hätte, mehr erkennbar.“ Auch in der Schlacht von Azincourt (1415) im Hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich türmten sich die Leichen: „Solch ein großer Haufen wuchs aus den Erschlagenen und aus denen, die erdrückt dazwischenlagen, dass unsere Männer diesen Haufen erkletterten, welche mehr als mannshoch angewachsen waren, und ihre Feinde dort unter ihnen mit Schwertern, Äxten und anderen Waffen abschlachteten“, berichtet ein Augenzeuge.
Die Ritter kamen ihrem Kampfauftrag – allen schönen Idealen zum Trotz – gewissenhaft nach. Der normannische Anführer Robert Guiscard teilte in der Schlacht von Civitate 1053 kräftige Hiebe gegen seine Gegner aus. „Einige verstümmelte er an den Füßen, einige an ihren Händen; dem einen schlug er den Kopf vom Körper ab, dem anderen schnitt er den Bauch mitsamt der Brust auf, dem einen durchbohrte er die Rippenpartie, nachdem er zuvor den Kopf abgeschlagen hat“, berichtet der Chronist Guillaume de Pouille. Auch der Autor Gerald von Wales, der in seinem Geschichtswerk die Eroberung Irlands durch die Engländer Ende des 12. Jahrhunderts schildert, weiß die Schwerthiebe des englischen Anführers John de Courcy gebührend herauszustellen: „Wer hier die Schwertstreiche von John hätte sehen können, wie er bald den Kopf von der Schulter, bald den ganzen Arm, bald den Unterarm vom Körper abtrennte, der hätte in adäquater Weise die Kräfte dieses Mannes und dieses Krieges preisen können.“
Dass die Berichte keine Erfindungen der Chronisten sind, beweisen archäologische Funde von mittelalterlichen Schlachtfeldern. Skelette gefallener Krieger auf der Insel Gotland zeigen, mit welcher Intensität schwedische und dänische Ritter während einer Schlacht 1361 aufeinander einschlugen: Arme, Beine und die Kopfregion der in einem Massengrab bei Visby beigesetzten Kämpfer wiesen gravierende Verletzungen auf. Durchtrennte Schien- und Wadenbeine und Schädelverletzungen am Hinterkopf gaben ein Zeugnis davon, mit welcher Wucht Schwerter, Äxte und Dolche auf die Krieger herabsausten und selbst am Boden Liegende nicht verschonten. Viele Schädel wiesen mehrere Hiebverletzungen gleichzeitig auf, was auf wüste Prügeleien hinweist.
Gruselige Details des Kampfgeschehens offenbarte auch das Massengrab von Towton in England, das 1996 gefunden und untersucht wurde. Die Schlacht von Towton anno 1461 war eine der blutigsten in der Geschichte Englands mit geschätzten 20.000 Toten im Rahmen der Rosenkriege. Mit welcher Erbitterung die Adelshäuser York und Lancaster um die Macht im Königreich kämpften, zeigen die schweren Schädelverletzungen und Verstümmelungen im Gesichtsbereich der Toten. In einem wahren Blutrausch müssen die Kämpfer aufeinander eingeschlagen haben, anders wären die Gesichtsfrakturen und Schädelspaltungen nicht zu erklären. Von ritterlicher Barmherzigkeit keine Spur. Das Ringen, das mit einem Sieg des Hauses York endete, kann nichts anderes gewesen sein als ein wüstes Hinschlachten – und das auch noch an einem Tag, der eigentlich von Kriegshandlungen hätte ausgenommen sein müssen: Der 29. März 1461 war der Palmsonntag.
Ritterlich ging es in den Heeren schon deswegen nicht zu, weil nur der harte Kern zu den schwer gepanzerten, mit eigenem Standesethos versehenen Elitekämpfern zählte. Den weitaus größten Anteil der Heere machten jedoch Fußkämpfer niederen Standes aus, die entweder als Söldner angeworben oder als unfreie Dienstleute zur Kriegsteilnahme zwangsverpflichtet worden waren. Sie galten den edlen Rittern als nicht ebenbürtige Kriegspartner und wurden dementsprechend gefühllos behandelt. Schon Lampert von Hersfeld berichtet über die Schlacht an der Unstrut, dass die sächsischen Fußkämpfer von den siegreichen Rittern wie „Vieh“ abgeschlachtet worden seien.
Ritterliche Regeln wie die Schonung des Gegners zum Zwecke der Lösegelderpressung galten allenfalls unter Gleichrangigen. Doch nur ein hochrangiger Unterlegener, von dem ein sattes Lösegeld zu erwarten war, hatte Chancen, auf diese Weise sein Leben zu retten – vorausgesetzt, es blieb ihm im Schlachtgetümmel die Gelegenheit, sich zu ergeben und einen Teil der Rüstung – Helm oder Handschuh – ohne Gefahr für Leib und Leben abzulegen. Die Auslösesummen für einen Gefangenen waren horrend und führten oft zum wirtschaftlichen Ruin der Adelsfamilien. Für weniger begüterte Ritter war die freiwillige Gefangennahme daher keine Option, zumal es keine Garantie gab, dass Kriegsgefangene nicht doch misshandelt oder getötet wurden, wenn die Übergabeverhandlungen scheiterten oder die militärischen Notwendigkeiten sich geändert hatten. Für Kämpfer aus einfachem Stand, Bürger und Bauern, die keine finanziellen Mittel besaßen, um sich freizukaufen, griffen solche Gnadenangebote von vornherein nicht. Da es bei ihnen stets um Leben und Tod ging, kämpften sie mit besonderer Erbitterung. Sie hatten keine Gnade zu erwarten und gewährten daher auch selbst keine.
In dem Maße, in dem im 14. und 15. Jahrhundert verstärkt auf kämpfende Einheiten aus einfachem Stand zurückgegriffen wurde, nahmen die Grausamkeiten im Kriegsgeschehen zu. Der Krieg wandelte sich mehr und mehr zu einem „bösen Krieg“, wie es die Quellen ausdrücken. Den Zorn der hehren Ritterschaft bekamen englische Bogenschützen, Schweizer Fußtruppen oder flandrische Söldner in besonderem Maße zu spüren. Auf sie machten die Ritter regelrecht Jagd. Doch diese wussten ihre Haut teuer zu verkaufen: In der sogenannten Goldsporenschlacht von Kortrijk 1302 holten die zu Fuß kämpfenden flandrischen Aufgebote der Städte die französischen Ritter mit ihren Stangenwaffen reihenweise vom Pferd und machten sie systematisch nieder. Über 1000 Ritter verloren ihr Leben, darunter der Anführer Robert II. von Artois. Auch die Schweizer Eidgenossen zeigten kein Erbarmen, wenn es gegen österreichische Ritterheere ging. In der für sie siegreichen Schlacht von Morgarten (1315) setzten sie ihre langen Hellebarden als regelrechte Mordwaffen ein: „Mit ihnen zerteilten sie auch ihre so bestens geschützten Gegner wie mit einem Rasiermesser und zerlegten sie in einzelne Stücke“, berichtet der Chronist Johannes von Winterthur über das Gemetzel. Die Schweizer verboten sogar in ihren Kriegsordnungen, Gefangene zu machen. Als in der Schlacht von Héricourt 1475 einige verbündete deutsche Ritter Gefangene unter ihresgleichen machten, setzten die Eidgenossen durch, dass sie getötet wurden: Die gefangenen 70 Ritter wurden daraufhin in Basel öffentlich verbrannt.
Wie gegen nichtstandesgemäße Gegner brachen alle Dämme des Anstandes auch gegen häretische, heidnische oder muslimische Feinde. Der Ehrenkodex der Ritter galt für sie nicht. Kriegsgräuel sind daher in den Albigenser- oder Hussitenkriegen, in den Kreuzzügen gegen heidnische Pruzzen und Litauer oder in Palästina zur Befreiung des Heiligen Landes besonders häufig anzutreffen. Dabei sind es nicht nur Schlachten, die blutig ausgetragen wurden, auch Belagerungen konnten zu Blutbädern „entarten“, wenn eine Burg im Sturm genommen wurde. „Schauerlich war es anzusehen, wie überall Erschlagene umherlagen und Teile von menschlichen Gliedern, und wie der Boden mit vergossenem Blut ganz überdeckt war. Und nicht nur die verstümmelten Leichname und die abgeschnittenen Köpfe waren ein furchtbarer Anblick. Den größten Schauer musste das erregen, dass die Sieger selber von Kopf bis zu den Füßen mit Blut bedeckt waren“, berichtet Wilhelm von Tyrus über die Eroberung Jerusalems 1099, die besonders grausam ausfiel, weil es sich hier um einen nicht christlichen Gegner handelte. Allerdings ließen die Ritter ihre christliche Nächstenliebe auch in Europa vermissen, wenn sich der Feind nicht von selbst ergab.
Obwohl die ritualisierte Sprache des Mittelalters eine Reihe von Möglichkeiten bot, Konflikte friedlich beizulegen, indem man beispielsweise die Übergabe einer Stadt oder Burg rechtzeitig aushandelte und den Bewohnern dabei freien Abzug gewährte, gehörten Belagerungen zu den besonders unschönen Seiten der mittelalterlichen Kriegsführung. Wenn die Verhandlungen zur Übergabe gescheitert waren, war jedes Mittel erlaubt, um den Widerstand des Gegners zu brechen. Der Fantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt: Die Kreuzfahrer des ersten Kreuzzugs schossen 1097 die Köpfe toter Muslime hinter die Stadtmauern von Nikaia, um die Belagerten zur Aufgabe zu zwingen. Friedrich Barbarossa nutzte eine ähnliche Methode der „psychologischen Kriegsführung“, als er während der Belagerung der Stadt Crema 1159 seine Krieger mit den Köpfen der Gefallenen spielen ließ. „Es war aber ein grausiger Anblick, wenn diejenigen, die draußen waren, den Toten die Köpfe abschlugen und mit ihnen wie mit Bällen spielten und sie aus der rechten in die linke Hand warfen und damit grausam prahlten und ihren Spott trieben“, berichtet der Bischof Otto von Freising darüber. Eine andere beliebte Methode bestand darin, gefangene Gegner als menschliche Schutzschilde an Belagerungstürme zu binden, um die Eingeschlossenen daran zu hindern, auf ihre eigenen Leute zu schießen. „Biologische Waffen“ kamen zum Einsatz, wenn man Seuchenopfer oder Tierkadaver über die Stadt- oder Burgmauern katapultierte, um bei den Eingeschlossenen den Ausbruch von Krankheiten zu fördern.
Abgesehen davon, dass ein Sturmangriff auf eine Burg oder Stadt rüde Methoden der Eroberung wie den Beschuss mit Steinkugeln, Feuerpfeilen, Armbrust- und Ballistenbolzen mit sich brachte, kam es häufig nach dem Fall einer belagerten Stätte zu einem unmäßigen Gewaltausbruch gegen die Unterlegenen. Die Albigenserstadt Béziers in Südfrankreich versank 1209 in einem beispiellosen Blutbad, als die nordfranzösischen Ritter des Kreuzfahrerheeres über sie herfielen. „Die unverzüglich Eindringenden töteten fast alle, von den Jüngsten bis zu den Ältesten und steckten anschließend die Stadt in Brand“, schrieb der Mönch Peter von Vaux-de-Cernay in seinem Geschichtswerk. „In der Kirche der heiligen Maria Magdalena wurden am Tag der Eroberung an die 7000 Bürger getötet.“ Nach der Beschreibung Wilhelms von Tudela herrschte an diesem Tag völliges Chaos in der Stadt. „Die Landsknechte, diese Wahnsinnigen, machten auch vor Klerikern, Frauen und Kindern keinen Halt. Ich glaube, dass nicht einer entkommen ist (…). Seit der Zeit der Sarazenen habe ich nie von einem solch brutalen Massaker gehört“, berichtet er. Legendär ist auch der Fall Konstantinopels im Vierten Kreuzzug 1204. Drei Tage lang wurde die reiche und mit unendlich vielen Kunstwerken ausgestattete Stadt am Bosporus von den wütenden Kreuzrittern geplündert. Es wurde zügellos gemordet, vergewaltigt und geraubt. Verheerende Brände zerstörten weite Teile des Stadtgebietes. Von dem Trauma erholte sich die Stadt nie mehr. „Oh Stadt, einst throntest du über allen anderen, deine Anmut und Gestalt waren unvergleichlich (…) deine strahlenden Augen sind dunkel geworden, und du gleichst einem alten Feuerweib, das mit Ruß bedeckt ist“, klagte der byzantinische Staatsmann Niketas Choniates.
Weniger spektakulär, aber nicht minder effektiv war das Aushungern von belagerten Städten und Burgen. Das Abschneiden der Nachschubwege durch die Belagerer war zwar eine Erfolg versprechende, allerdings auch ziemlich langwierige Methode. Oft dauerten Belagerungen monate-, manchmal sogar jahrelang. Hungersnöte und Seuchen machten dann den Eingeschlossenen besonders zu schaffen. 1316 schlachtete die englische Garnison von Berwick ihre Pferde, um nur irgendwie zu überleben. Während der sieben Monate dauernden Belagerung von Iglesias auf Sardinien (1323) aßen die Stadtbewohner sogar Ratten und Gras, bevor sie aufzugeben gezwungen waren.
Die Notlage zwang die Belagerten zuweilen zu drastischen Maßnahmen. Um überflüssige Esser nicht ernähren zu müssen, wies man die nicht kämpfenden Bewohner aus den Befestigungen. Alte, Frauen und Kinder wurden einfach vor die Tore gesetzt, wo ihnen wiederum der Fluchtweg durch die Belagerungstruppen versperrt war. Die in den Grab- und Wallanlagen eingeschlossenen Zivilisten erwartete ein trauriges Schicksal. Denn meist besaßen auch die Belagerer nicht genügend Vorräte, um sie zu unterhalten. Die Vertriebenen verhungerten so zwischen den Fronten. So geschah es Bewohnern der Stadt Rouen während des Hundertjährigen Krieges. Ein halbes Jahr lang lag der englische König Heinrich V. 1418/19 vor den Toren der Hauptstadt der Normandie, um ihren Widerstand zu brechen. Die ausgehungerte Stadt wies im Winter 1418 daraufhin etwa 12.000 Menschen, „armes Volk“, aus. Doch der englische König war nicht bereit, die Heimatlosen zu unterstützen. Unbarmherzig setzte er sie dem Hunger- und Kältetod aus. Er stellte sogar extra Wachen auf, um niemanden aus dem Festungsgraben entkommen zu lassen.
Gewalt gegen Unbeteiligte gehörte auch im Mittelalter zum Alltag. Terror gegen Nichtkombattanten war ein Teil der Strategie. Systematisch brannten die kriegsführenden Parteien Felder und Dörfer der Gegenseite nieder, vernichteten Ernteerträge und nahmen in Kauf, dass die verwüsteten Regionen für Jahre darniederlagen. So fiel im welfisch-staufischen Thronstreit König Philipp von Schwaben 1198 und 1199 bewusst zur Erntezeit im Elsass ein, um „das gesamte Getreide“ zu vernichten. Selbst der hochgeschätzte König Friedrich Barbarossa war sich nicht zu schade, in seinem Kampf gegen die oberitalienische Metropole Mailand eine außerordentlich unschöne Strategie der „verbrannten Erde“ anzuwenden. Planmäßig vernichtete er mit seinen Truppen Getreidefelder, Obst- und Gemüsegärten im Umfeld der bevölkerungsreichen Stadt, um sie von ihren Nahrungsressourcen abzuschneiden und dadurch zum Nachgeben zu zwingen.
Zu bewusst schweren Zerstörungen kam es auch im Kampf des Schwäbischen Städtebundes gegen die Fürsten im 14. Jahrhundert: „Schwabenland ward so verheeret, dass kaum ein Dorf war, welches nicht gebrannt oder geschatzt worden wäre“, berichtet der Straßburger Chronist Jakob Twinger von Königshofen. „Besonders die Württemberger taten den Reichsstädten großen Schimpf und Schaden. Sie hieben das Getreide mit den Schwertern nieder, pflügten die Wiesen und Äcker um und säten Senf hinein; denn Senf hat die Eigenschaft, dass er, einmal gesät, immer wieder wächst und nicht beseitigt werden kann.“
Die Methode des Niederbrennens wurde immer ausgefeilter. Im Hundertjährigen Krieg kamen erstmals mobile Spezialeinheiten zur Verheerung ganzer Landschaftsstriche zum Einsatz. Man nannte so einen Zerstörungszug chevaucheé. In einem einzigen Streifzug ließ 1355 der englische Prinz Edward von Woodstock, genannt der „Schwarze Prinz“, elf größere Städte und 3700 Dörfer niederlegen. Diese Vernichtungsstrategie sollte nicht nur die Bewohner des Landes schädigen, sondern auch den Herrschaftsanspruch der Plantagenets über Frankreich untermauern, da der französische König ganz offensichtlich nicht in der Lage war, die eigene Bevölkerung zu schützen. Den Franzosen wurde damit deutlich vor Augen geführt, dass ihr Herr seine königliche Kompetenz verloren hatte. Italienische Söldnerheere benahmen sich indes nicht besser. Auch sie unterhielten eigene Spezialisten, sogenannte guastatori, die auf Brandschatzung, Raub und Zerstörung aus waren. Der Söldnerführer Federigo von Brescia ließ 1371 einmal in einer einzigen Vernichtungsaktion 2000 Häuser in Flammen aufgehen, ohne sich auch nur einen Moment um die Obdachlosen zu kümmern. Der kriegserfahrene Heerführer John Hawkwood erbeutete 1385 auf einem Feldzug in Italien 1200 Ochsen und 15.000 Schweine und Schafe als lukrative Beute. Welches Schicksal die beraubten Bauern erwartete, interessierte ihn dagegen nicht.
Selbst der ritterlichste Ritter dachte sich bei dieser Kriegsführung auf Kosten der einfachen Bevölkerung nichts. „Krieg ohne Feuer ist wie Würste ohne Senf“, meinte der englische König Heinrich V. trocken zu diesem Thema. Und auch der französische Rechtsgelehrte Honoré Bouvet sah darin kein Unrecht: „Wer es nicht versteht, Feuer zu legen, der ist nicht in der Lage, Krieg zu führen“, meinte er. Der gezielte Terror gegen die schutzlosen Bewohner eines Landes gehörte zum Kriegsalltag.
Der Gewalt einer wütenden Kämpferhorde waren in besonderem Maße die Frauen ausgesetzt. Immer wieder berichten die Quellen von Vergewaltigungen infolge von Kriegszügen. Missbilligend schildert der Chronist Bruno das Verhalten der Truppen König Heinrichs IV. nach ihrem Sieg an der Unstrut über die aufständischen Sachsen (1075): „Es half den Frauen nicht, dass sie sich in die Kirchen geflüchtet und ihre Habe dorthin getragen hatten; denn die Männer waren in die Wälder geflohen und wo sonst sie in einem Versteck Rettung hoffen konnten. Die Frauen schändeten sie noch in den Kirchen, selbst wenn sie sich zum Altar geflüchtet hatten.“ Italienische Frauen erlebten die gleiche Qual während des zweiten Italienzugs Friedrich Barbarossas (1158) im Lager der böhmischen Truppen, die sich, wie der Chronist zu versichern weiß, „viele hübsche junge Frauen“ gesichert hatten. Jean le Bel berichtet aus dem Hundertjährigen Krieg ebenfalls von Gewalttaten gegen Frauen: „Zahlreiche schöne Bürgerinnen und ihre Töchter wurden vergewaltigt, was eine große Schande war.“ Auch sozial höher stehenden Frauen blieb dieses Schicksal nicht erspart. Während des Bauernaufstands in Frankreich, der Jacquerie, (1358) kam es nach dem Zeugnis des Chronisten Jean Froissart zu brutalen Übergriffen auf Frauen aus dem Ritterstand: „Sie (die aufständischen Bauern) ergriffen den Ritter und banden ihn an einem Pfosten fest. Mehrere vergewaltigten seine Frau und seine Tochter vor seinen Augen. Dann töteten sie seine Frau, die schwanger war, und auch die Tochter und alle übrigen Kinder.“
Abseits der fürstlichen Höfe mit ihrer hoch entwickelten Ritterkultur zeigte auch der Krieg im Mittelalter sein gewohnt hässliches Gesicht. Wüste Kampfszenen, Brandschatzung und Terror gegen die Bevölkerung prägten das Kriegsgeschehen, das so gar nicht zum idealisierten Selbstbild der Ritter passen wollte. Der Krieg hielt für alle Beteiligten Grausamkeiten parat – Ehre, Tugend und Fairness blieben auf der Strecke.