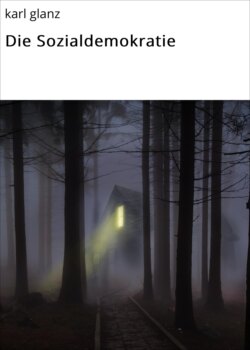Читать книгу Die Sozialdemokratie - Karl Glanz - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
13
ОглавлениеDie ersten Gemeinderatswahlen nach dem allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrecht ohne Unterschied des Geschlechtes oder des Standes fanden in Wien am 4. Mai 1919 statt. “Bei diesen Wahlen erringen die Sozialdemokraten einen überwältigenden Sieg.“ Von 165 Mandaten gewannen die Sozialdemokraten 100 Sitze. Jakob Reumann wurde der erste sozialdemokratische Bürgermeister von Wien. Wien würde weiterhin die Hochburg der Sozialisten in einer weitgehend konservativ regierten Nation sein. Die sozialistisch geführte Stadtregierung errichtete die ersten Gemeindebauten für die Arbeiterklasse, wie den Karl-Marx-Hof , den Sandleitenhof und die öffentlichen Wohnsiedlungen am Gürtelring und führte Reformen im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich ein. Diese Maßnahmen haben tatsächlich die Lebensbedingungen für die Arbeitnehmer verbessert und ihren Lebensstandard erhöht. Dies vertiefte die Bindung der Arbeiter an die Partei und schuf einen großen Pool von Loyalisten, auf die sich die Partei immer verlassen konnte. Daraus entstand der Begriff "Rotes Wien" der 1920er Jahre.
Das “Rote Wien“ ist nicht zuletzt relevant, weil im “Roten Wien“ versucht wurde, eine proletarische kulturelle Gegenwelt zu Bürgertum und Klerus zu schaffen. In den Jahren des “Roten Wiens“ erreichte die Wohnbaupolitik der Austromarxisten, die vor allem in der Sozialdemokratie Österreichs im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts verbreitet war, international hohe Aufmerksamkeit, weil hier umfassende realpolitische Umstrukturierungen getroffen wurden, zum Beispiel in der bewussten ideologischen Planung des Wohnbaus und in der Umsetzung. Spitzname von Wien war das “Rote Wien“ von 1918 bis 1934 aufgrund der sozialistischen Stadtregierung und ihres Programms.
Um die Dimensionen des Machtkampfes darzustellen, der geführt wurde um ein “Rotes Wien“ zu ermöglichen, müssen die gesetzlichen Ausgangspunkte dieses Kampfes verdeutlicht werden. Die Auswirkungen der geänderten Rechtsnormen, die unter Druck und mit sehr viel Emotionalität erkämpft wurden, beeinflussen auch heute noch das Selbstverständnis der Wiener Stadtpolitik. Die Stadt Wien ist die Besitzerin der Gemeindebauten, daher ist ihr Selbstverständnis wichtig für das Erfassen der verinnerlichten Weltanschauungen und damit einhergehender Ordnungsstruktur von GemeindebaumieterInnen der ersten und zweiten Generation.
Wien stand vor gewaltigen Problemen: Leere Kassen, ein Heer von Arbeitslosen, eine angespannte Energiesituation, Hunger, schwere Gesundheitsprobleme in der Bevölkerung und nicht zuletzt große Wohnungsnot sind zu bewältigen.
Die Arbeiter standen vor der unerbittlichen Notwendigkeit, mit jeder angebotenen Wohnung vorlieb nehmen und für die einen Preis zahlen zu müssen, der im Verhältnis zu ihrem Einkommen weitaus größer war als der Preis, den Wohlhabende für große Wohnungen entrichteten. Seit diesen ersten demokratischen Wahlen in Wien haben die SozialdemokratInnen bei jeder weiteren demokratischen Wahl in Wien ihre Mehrheit behaupten können.
Bei der Machtübernahme der Sozialisten 1919 war es notwendig, sich zuerst um die Schulden der Stadt zu kümmern, die seit der Amtszeit von Karl Lueger angehäuft worden waren. Zur Schuldentilgung führte der damalige Finanzstadtrat Hugo Breitner neue Steuerprinzipien ein. Nach wie vor kann man auf den Gemeindebauten des Roten Wien die Inschrift lesen: “Wohnhausanlage der Gemeinde Wien, errichtet aus den Mitteln der Wohnbausteuer.“ Diese Wohnbausteuer war die berühmteste aller Steuern des genialen Finanzstadtrats Hugo Breitner, und sie in ihrer sozialen Bedeutung und ökonomischen Wirkung etwas näher zu betrachten, ist für die aktuelle Diskussion darüber, wie fortschrittliche Wohnungspolitik aussehen soll, sehr lehrreich.
Die grundlegenden Änderungen bestanden in der Einführung direkter anstelle indirekter Steuern (z.B.: Wohnbausteuer, ab 1923 zweckgebunden), einer starken Progression für höhere Einkommen, dem Beschluss keine weiteren Schulden zu machen, der Einführung von Luxussteuern (Lustbarkeitsabgaben auf z.B.: Opern, Pferderennen und Ringkämpfe, Kraftwagenabgabe auf private Automobile, Hauspersonalabgabe, Pferde- und Hundeabgabe) und den Verzicht auf Reingewinne aus den städtischen Monopolbetrieben. Im Roten Wien wurden die Baukosten nicht aus Anleihen, sondern über laufende Steuereinnahmen aufgebracht, wodurch die Lösung des Problems der Wohnbaufinanzierung ohne Verschuldung der Gemeindekasse gelang. Die Steuereinnahmen der Gemeinde Wien waren zusammengesetzt aus: a) Erträgen aus eigenen Landessteuern, darunter Steuern auf Luxus und besonderen Aufwand sowie aus der Wohnbausteuer; b) Erträgen aus Zuschlägen zu staatlichen Steuern; und c) Anteilen am Ertrag der Bundessteuern.
In der ersten Republik hatte die Sozialdemokratie mit der so genannten Breitnersteuer, den sozialen Wohnungsbau eingeführt und finanziert.
So wurden in den Jahren von 1923 bis 1934 über 65.000 leistbare Wohnungen für ArbeiterInnen gebaut.
Selbst in Spanien, 1936, hatte man die Stadt Wien als ein besonders gelungenes Beispiel sozialen Wohnbaus herangezogen. Wenn wir uns mit der Geschichte und Zukunft des sozialen Wohnbaus beschäftigen, dann kommt Österreich das Verdienst zu, in seiner Vergangenheit auf ein Beispiel verweisen zu können, das weltweit einzig dasteht. Es sind das die Wiener Gemeindebauten der 1. Republik, die, auch im internationalen Maßstab, eine der größten sozialen Wohnbauleistungen des 20. Jahrhunderts darstellen. Zunächst eine Vorstellung von der zahlenmäßigen Dimension: In den Jahren 1919 bis 1934 wurden 377 Wohnhausanlagen mit 61.175 Wohnungen errichtet, das waren im jährlichen Durchschnitt 25 Anlagen mit 4.078 Wohnungen. 90 Prozent der Objekte und Wohnungen baute man in Form großer, mehrstöckiger Blocks, 10 Prozent in Form von Siedlungshäusern mit Kleingärten. 1919 befanden sich im Besitz der Gemeinde Wien 5.487 Hektar (noch aus der Zeit der christlich sozialen Stadtverwaltung). Bis 1931 erfolgte der Ankauf der Drasche-, Frankl- und Bodencredit-Gründe, sodass sich der Besitz der Gemeinde Wien auf 8.150 Hektar erhöhte (das waren 38,9 Prozent der gesamten Gemeindefläche). Sie spielte damit die dominierende Rollte und konnte daher die städtische Bodenpolitik praktisch ungehindert regulieren. Aber um bauen zu können, braucht es Bauland und das musste erst einmal gekauft werden. Das “Rote Wien“ war aus ganz bestimmten historischen Ursachen in der Lage, die Macht der privat kapitalistischen Bodenspekulation in der österreichischen Hauptstadt zwar nicht völlig zu brechen, aber weitgehend einzudämmen. Nicht nur die Mieterschutzgesetzgebung, die einer privaten Bautätigkeit hemmend im Weg stand, machte für jene, die aus der Zeit vor 1914 Baugrund besaßen, den Besitz unrentabel, sondern auch die städtische Wertzuwachssteuer bewirkte eine Erschwerung gewinnbringenden privaten Weiterverkaufs. Die Hoffnungen mancher Bodenspekulanten auf baldige Beseitigung des Mieterschutzes wurden 1922 endgültig zunichte gemacht; viele Besitzer waren daher froh, ihr angelegtes Kapital frei zu bekommen. Ihr Prinzip lautete: Schonung der Mieter von Kleinwohnungen bei gleichzeitig stärkerer Belastung der Bewohner von teureren Objekten. Das Ergebnis sah so aus: Die 527.731 billigen Wiener Wohnungen und Geschäftslokale (82 Prozent aller Mietobjekte) trugen nur 22,6 Prozent zum Gesamtaufkommen der Wohnbausteuer bei, dagegen die 3.470 teuren Mietobjekte (0,5 Prozent der Gesamtzahl) 44,6 Prozent, also doppelt so viel.
Ein wichtiges Merkmal des “Roten Wien“ war der MieterInnenschutz. Im Jänner 1917 wurde die “kaiserliche Verordnung über den Schutz der Mieter“ erlassen. Diese Verordnung brachte eine Einschränkung des Kündigungsrechtes, bei dem zuvor völlige Willkür herrschte, und schloss willkürliche Mietzinserhöhungen aus. Im Jänner 1918 wurde der MieterInnenschutz mit einer zweiten Verordnung erweitert und dehnte den Schutz gegen Delogierungen aus.
Das Verbot der Mieterhöhung hatte vor allem während der Hyperinflation der Nachkriegsjahre weit reichende Auswirkungen. Der Mietzinsstopp schrumpfte den Zins auf eine verschwindend kleine Summe und brachte damit das Nettoeinkommen von Hausherren quasi zum Verschwinden. Dieser MieterInnenschutz führte in weiterer Folge dazu, dass viele Familien über Jahrzehnte und Generationen hinweg in ein und derselben Gemeindebauanlage wohnen blieben, was sicherlich das Gefühl des Eigentums verstärkte.
Dass zu der Grundversorgung eine leistbare Wohnung zählt, hat seit langem keine Bedeutung mehr. Schon ab den 80er Jahren hat die Wiener Rathaus-SP begonnen, den sozialen Wohnungsbau ein Ende zu setzen. Von der sozialen Idee, aus denen die Gemeindebauten hervorgegangen sind, z.B. dass die Miete für das Wohnen nicht mehr als 20 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens der ArbeiterInnenklasse übersteigen darf, von dieser Gesinnung hat sich die SP Wien abgewandt.
“Die Gemeindebauanlage wurde zu einer geschlossenen Einheit inmitten einer kapitalistischen Stadt, welche die sozialistische Gemeinschaft symbolisierte. Mit der Abgrenzung ‚nach außen’, verbesserte sich die infrastrukturelle Ausstattung der einzelnen Anlagen mit der Ambition ‚autarke Einheiten’ zu schaffen“.
Gemeindebauten waren und sind nicht nur pragmatische oder real-politische Immobilien, sie sind vielmehr Ausdruck einer Ideologie und Symbol einer Ära, der des “Roten Wiens“.
Die SP Wien hat die soziale Wohnungspolitik auf ein einträgliches Profitgeschäft umgestellt. Und zu diesem Zweck hat sie die Kapital-Gesellschaft “Wiener Wohnen“ gegründet. Dass dies ohne einen Kommentar, innerhalb der Sozialdemokratie, über die Bühne ging, zeigt, wie wenig den heutigen Sozialdemokraten an ihrer Vergangenheit liegt.
“Wohnend richtet der Mensch sich in seiner Umwelt ein, gestaltet jenes Miteinander, das wir Heimat oder Lebenswelt nennen, lebt in einer kulturell und sozial vertrauten Umwelt. Dieser Ort des ‘Gehaltenseins‘ kann Identitätsgewissheit, Selbstsein über Begegnen ermöglichen, aber er kann natürlich auch zum ‘Kultur-Kerker’ oder zur ‘Sozial-Zelle’ werden” (Greverus 1995: 9).
“Wenn wir einst nicht mehr sind, werden diese Steine für uns sprechen“. Nichts versinnbildlicht mehr als dieses Zitat des ehemaligen Wiener Bürgermeister Karl Seitz, wie der Gemeindebau untrennbarer Bestandteil des Mythos um das “Rote Wien“ ist. Dabei war der kommunale Wohnbau in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ursprünglich die erzwungene Antwort auf die Tatsache, dass das Kapital infolge des von den ArbeiterInnen erzwungenen Mieterschutzes den Wohnungsbau komplett einstellte. Die Mieterschutzverordnungen von 1917/18 und das Mietengesetz 1922 führten zunächst einmal zu einer unbeschreiblichen Verschärfung der Wohnungsnot.
Mit der Erkenntnis Otto Bauers, dass nun mal nicht beides zu haben sei, Mieterschutz und privater Wohnungsbau, machten die Sozialisten aus der Not eine Tugend. Sie nutzten die kurz davor erreichte Steuerhoheit von Wien um mit der so genannten “Breitnersteuer“, die vor allem das begüterte Bürgertum traf, einen beispiellosen kommunalen Wohnungsbau zu finanzieren.
Die Gemeindebauwohnungen selbst wurden mit getrennt begehbaren Zimmern geplant, die eine bestmögliche private Nutzung der einzelnen Räume erlaubte. Privater Wohnraum wird also immer mehr als Fluchtort vor der ständigen Definition der eigenen Rolle und des Selbst gegenüber Fremden. Mit den Gemeindebauten wurde versucht, Nachbarschaft als heile Gegenwelt zur Unterdrückung der industrialisierten Arbeitswelt der Wiener ArbeiterInnen zu schaffen. Während dies in der Zwischenkriegszeit bedeutete, dass relativ homogene Gruppen ein lokales “Wir“ herausbilden konnten, bedeutet es heute, dass die gemischten Gruppen mit unterschiedlichen Funktionen kaum aufeinander zugehen werden, sich auf ihre Privatheit beziehen. So wird heute Nachbarschaft wohl von vielen eher als beengende soziale Kontrolle gesehen, weniger jedoch als wünschenswerte Gemeinschaft. Dieses Phänomen wird sichtbar am Beispiel der WohninspektorInnen: “Die Wohninspektoren, als Vollzugsorgane der Gemeinde Wien, achteten bei ihren regelmäßigen Kontrollen auf den ‚pfleglichen Umgang’ der Stiegenhäuser, der Höfe und der Grünanlagen. Aber auch der neue Privatbereich der Arbeiter selbst, die Wohnungen war Gegenstand einer permanenten Kontrolle durch die Gemeinde. Das Selbstverständnis, mit dem die Bewohner dieser neuen Wohnungen diese Kontrolle zulassen, lässt auf einen noch unsicheren Umgang mit diesem neuen Wert der ‚Privatheit’ schließen“.
“Wiener Wohnen“ ist die Wohnhäuserverwaltung der Stadt Wien. Mit der Ausgliederung aller Liegenschaften der Wiener Gemeindebauten mit ihren 220 000 Wohnungen und den Grünanlagen in die Privatgesellschaft “Wiener Wohnen“ hat die Rathaus-SP die Rahmenbedingungen geschaffen, um das legale Abzocken der ArbeiterInnen in den Gemeindebauten zu ermöglichen.
Unter der Regie heutigen Rathaus-SP macht die “Wiener Wohnen“-Kapitalgesellschaft das Wohnen in den Gemeindebauten zu einem ausgesprochenen “Luxus“. Die Mieten in den Gemeindewohnungen fressen im Schnitt 45 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens der ArbeiterInnen auf. Bei den niedrigen Einkommen der Alleinerziehenden, PensionistInnen, Teilzeit- und atypisch Beschäftigten liegt die Miete der Gemeindewohnungen weit über 60 Prozent des Einkommens.
Im Jahr 1962 betrug die Miete einer 80m²-Gemeindewohnung bei einem durchschnittlichen Nettoverdienst von 1600 Schilling um die 200
Schillinge; das macht 13 Prozent vom Einkommen aus. Im Jahr 2008, beträgt die Miete für die gleiche Gemeindewohnung, bei einem Einkommen von 1050 Euro, über 560 Euro. Das sind in dieser Wohnungskategorie über 53 Prozent. Es sind 185.000 Menschen betroffen, die zwei Drittel ihres Nettoeinkommens der Gesellschaft “Wiener Wohnen“ überlassen müssen. Heute sind die Mieten noch höher, nicht zuletzt müssen die MieterInnen diese unsagbar unnötige und teilweise recht tragbare Renovierung der Häuser zahlen, die bis zu € 100.- pro Monat kostet und das in einem Zeitraum von 10 Jahren.
Tausende Menschen, die einer geregelten Arbeit nachgehen, müssen sich Monat für Monat um Unterstützungsgelder anstellen und darum betteln, dass sie sich den „Luxus“ Wohnen leisten können. Seit der Gründung der Gesellschaft “Wiener Wohnen“ sind Verarmung und Obdachlosigkeit in Wien sprunghaft und unübersehbar angestiegen. Die Zahlen hierfür werden nicht veröffentlicht, um dem Image der Wiener SP nicht zu schaden.
Auch die Gewinne von „Wiener Wohnen“ werden geheim gehalten. In die
Geschäfte mit dem gehorteten Kapital ist nur ein kleiner Kreis der Wiener Sozialdemokratie eingeweiht.
Die Renditemöglichkeiten steigen nur langsam. Freifinanzierter privater Wohnungsbau findet eigentlich nur im Hochpreis Segment statt. ArbeiterInnenwohnungen werden, wie schon vor dem Krieg, alleine von der öffentlichen Hand gebaut, diesmal aus den Mitteln der Wohnbauförderung finanziert. Neben dem Gemeindebau werden auch Genossenschaftswohnungen gebaut.
Als stellvertretende Eigentümerin der größten Wohnungsgesellschaft gibt die Wiener SP den Ton an, wenn es um die Profite am Wohnungsmarkt geht. Folglich ist sie mit ihrer Gesellschaft “Wiener Wohnen“ für die Steigerung der Mieten und die explosionsartige Gewinne der Hauseigentümer verantwortlich.