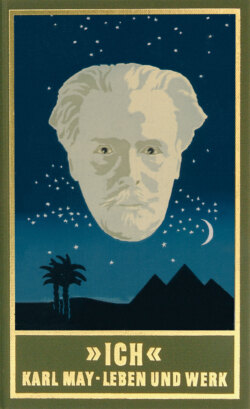Читать книгу "Ich" - Karl May - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Seminar- und Lehrerzeit (1857–1861)
ОглавлениеKeine Pflanze zieht das, was sie in ihren Zellen und in ihren Früchten aufzuspeichern hat, aus sich selbst heraus, sondern aus dem Boden, dem sie entsprossen ist, und aus der Atmosphäre, in der sie atmet. Pflanze ist in dieser Beziehung auch der Mensch. Körperlich ist er freilich nicht angewachsen, aber geistig und seelisch wurzelt er, und zwar tief, sehr tief, tiefer als mancher Baumriese in kalifornischer Erde. Darum ist kein Mensch für das, was er in seiner Entwicklungszeit tut, in vollem Maß verantwortlich zu machen. Ihm alle seine Fehler vollauf anzurechnen, würde ebenso falsch sein wie die Behauptung, dass er alle seine Vorzüge nur allein sich selbst verdanke. Nur wer den Heimatboden und die Jugendatmosphäre eines ‚Gewordenen‘ genau kennt und richtig zu beurteilen weiß, ist im Stande, einigermaßen nachzuweisen, welche Teile eines Lebensschicksals aus den gegebenen Verhältnissen und welche Teile aus dem rein persönlichen Willen des Betreffenden geflossen sind. Es war eine der größten Grausamkeiten der Vergangenheit, jedem armen Teufel, den die Verhältnisse zur Verletzung der Gesetze / führten, zu seiner eigenen, vielleicht geringen Schuld auch noch die ganze, schwere Last dieser Verhältnisse mit aufzubürden. Es gibt leider auch heute mehr als genug Menschen, welche die Grausamkeit sogar jetzt noch begehen, ohne zu ahnen, dass sie selbst es sind, die, wenn es hier Gesetze gäbe, mit verantwortlich gemacht werden müssten. Und gewöhnlich sind es nicht etwa die Fernstehenden, sondern gerade die lieben ‚Nächsten‘, die Stein um Stein auf den anderen werfen, obgleich die Einflüsse, denen er unterlegen ist, besonders auch von ihnen mit ausgegangen sind. Sie tragen also an der Schuld, die sie auf ihn werfen, selbst mit Schuld.
Wenn ich es hier unternehme, die Verhältnisse, aus denen ich erwuchs, einer ungefärbten Prüfung zu unterwerfen, so geschieht das nicht etwa in der Absicht, irgendeinen Teil meiner eigenen Schuld von mir ab- und auf andere zu werfen, sondern nur, um einmal durch ein laut sprechendes Beispiel zu zeigen, wie vorsichtig man sein muss, wenn man sich die Aufgabe stellt, eine menschliche Existenz nach ihrer Entstehung und Entwicklung hin genau zu untersuchen.
Hohenstein und Ernstthal waren damals zwei so nah beieinander liegende Städtchen, dass sich ihre Gässchen stellenweise wie die Finger zweier gefalteter Hände ineinanderschoben. In Hohenstein wurde der Naturphilosoph Gotthilf Heinrich von Schubert26 geboren, dessen Werke zunächst unter Schellingschem Einfluss entstanden, sich dann aber dem pietistisch-asketischen Mystizismus zuwandten. Seine Vaterstadt hat ihm ein Denkmal gesetzt. Aus Ernstthal stammt der verdienstvolle Philosoph und Publizist Pölitz27, dessen Bibliothek über 30.000 Bände zählte, die er der Stadt Leipzig vermachte. Ich habe es hier weniger mit Hohenstein als vielmehr mit Ernstthal / zu tun, in dem ich, wie der Hobble-Frank sich auszudrücken pflegt, ‚das erste Licht der Welt erblickte‘. Die ersten und ältesten Eindrücke meiner Kindheit sind diejenigen einer beklagenswerten Armut, und zwar nicht nur in materieller, sondern auch in anderer Beziehung. Niemals in meinem Leben habe ich so viel geistige Anspruchslosigkeit beisammen gesehen wie damals. Der Bürgermeister war ein unstudierter Mann. Es gab zwar einen Nachtwächter, aber die Bewohner hatten sich reihum an der Nachtwache zu beteiligen. Die Hauptbeschäftigung bildete die Weberei28. Der Verdienst war kärglich, ja oft überkärglich zu nennen. Zu gewissen Zeiten gab es wochen-, zuweilen sogar monatelang wenig oder gar keine Arbeit. Da sah man Frauen in den Wald gehen und Körbe voll Reisig heimschleppen, um im Winter Feuerung zu haben. Des Nachts konnte man auf einsamen Pfaden Männern begegnen, die Baumstämme nach Hause trugen, die noch während der Nacht zu Feuerholz zersägt und zerhackt werden mussten, damit, wenn die Haussuchung kam, nichts gefunden werden könne. Es galt für die armen Weber, fleißig zu sein, um den Hunger abzuwehren. Am Sonnabend war Zahltag. Da trug ein jeder sein ‚Stück zu Markte‘. Für jeden Fehler, der sich zeigte, gab es einen bestimmten Lohnabzug. Da brachte gar mancher weniger heim, als er erwartet hatte. Dann wurde ausgeruht. Der Abend war der Heiterkeit und – – – dem Schnaps gewidmet. Man fand sich beim Nachbar ein. Da ging die Bulle rundum. Bulle ist Abkürzung von Bouteille. In einigen Familien sang man dazu, aber was für Lieder oft! In anderen regierte die Karte. Da wurde ‚gelumpt‘, ‚geschafkopft‘ oder gar ‚getippt‘. Das Letztere ist ein verbotenes Glücksspiel, dem mancher den Verdienst der ganzen Woche opferte. / Man trank dazu aus einem einzigen Glas. Dies ging von Hand zu Hand, von Mund zu Mund. Auch während der Sonntagsausgänge und überhaupt bei jedem Gang ins Freie war man mit Branntwein versehen. Da saß man im Grünen und trank. Schnaps war überall dabei; man mochte ihn nicht entbehren. Man betrachtete ihn als den einzigen Sorgenbrecher und nahm seine schlimmen Wirkungen hin, als ob sich das so ganz von selbst verstünde.
Freilich gab es auch sogenannte bessere Familien, über die der Alkohol keine Macht besaß, aber die waren in ganz geringer Zahl. Patriziergeschlechter gab es in beiden Städtchen nicht. In Hohenstein wohnten einige Familien, die man höher schätzte als andere, in Ernstthal aber nicht. Die Pfarrer und die Ärzte waren die einzigen akademisch gebildeten Personen, hierzu kam vielleicht ein Rechtsanwalt, dessen Liquidationen absolut nicht das Geschick besaßen, sich in klingende Einnahmen zu verwandeln. So war die ganze Lebensführung überhaupt ungemein niedrig und der allgemeine Umgangston auf eine Note gestimmt, die man jetzt kaum mehr für möglich hält. Im persönlichen Verkehr waren Spitznamen oft gebräuchlicher als die wirklichen, richtigen Namen. Als einziges Beispiel, das ich da anführe, diene der Name Wolf. Es gab einen Weißkopfwolf, einen Rotkopfwolf, einen Daniellobwolf, einen Schlagwolf und noch eine Menge anders genannter Wölfe. Die Häuser waren klein, die Gassen eng. Ein jeder konnte in die Fenster des anderen sehen und alles beobachten, was geschah. So wurde es fast zur Unmöglichkeit, Geheimnisse voreinander zu haben. Und da kein Mensch ohne Fehler ist, so hatte ein jeder seinen Nachbarn im Sack. Man wusste alles, aber man schwieg. Nur zuweilen, wenn man es für nötig hielt, ließ man / ein Wörtchen fallen, und das war genug. Man kam dadurch zur immerwährenden, aber stillen Hechelei, zur niedrigen Ironie, zu einem scheinbar gutmütigen Sarkasmus, der aber nichts Reelles an sich hatte. Das war ungesund und griff immer weiter um sich, ohne dass man es beachtete. Das ätzte; das wirkte wie Gift. So hatte sich aus den sonnabendlichen Kartenspielen ein lichtscheues Unternehmen gebildet, das den Zweck verfolgte, verbotenes, ja sogar falsches, betrügerisches Kartenspiel zu pflegen. Die Betreffenden kamen zusammen, um sich in der Zubereitung und im Gebrauch von falschen Karten zu üben. Sie etablierten sich in einer vor der Stadt gelegenen Wirtschaft. Sie schickten Zubringer aus, um Opfer einzufangen. Da saß man nächtelang und spielte um hohe Einsätze. Mancher kam da mit vollen Taschen und ging mit leeren fort. Dieses Treiben war im Städtchen wohlbekannt. Man erzählte sich von jedem neuen Coup, der gemacht worden war. Man sprach von den erbeuteten Summen, und man freute sich darüber, statt dass man diese Betrügereien verwarf. Man verkehrte mit den Falschspielern wie mit ehrlichen Leuten. Man leistete ihnen Vorschub. Ja, man achtete, man rühmte ihre Pfiffigkeit, und man verriet nicht das Geringste von allem, was man von ihnen wusste. Dass hierdurch eigentlich das ganze Städtchen an dem Betrug gegen die herbeigeschleppten Opfer beteiligt wurde und dass jedermann, der von diesen Gaunereien wusste, sich, streng genommen, als Hehler zu betrachten hatte, das leuchtete keinem Menschen ein. Wer damals gesagt hätte, dass dies einen beklagenswerten, allgemeinen moralischen Tiefstand bedeutete, der wäre wohl ausgelacht worden, oder gar noch Schlimmeres. Das allgemeine Rechtsgefühl war irregeführt. Man bewunderte die Falschspieler, wie man / die Rinaldo Rinaldini und die Himlo Himlini der alten Leihbibliothek bewunderte, deren Bände man verschlang, weil sie die einzige war, die es in den beiden Städtchen gab. Ich habe niemals gehört, dass der Bürgermeister, der Pfarrer oder ein sonst hierzu berufener Beamter einen dieser Falschspieler zu sich kommen ließ, um ihn zu ermahnen, von dem bösen Beispiel, welches der ganzen Gemeinde gegeben wurde, abzulassen. Man duldete es. Man ging schweigend darüber hinweg. Die Jugend aber, die das alles mit ansah und mit anhörte, musste den Eindruck gewinnen, dass diese Betrügereien bewundernswerte und sehr lohnende Taten seien, und so ein Eindruck wird nie wieder verwischt. Mir wurde einst von einem Juristen gesagt, ich sei in einem Sumpf geboren worden. Ob dieser Herr wohl Recht gehabt hat?
Zwei eigenartige Gewächse dieses Sumpfes waren die beiden Namen ‚Batzendorf‘ und die ‚Lügenschmiede‘. Der erste leitet sich auf die bekannte alte süddeutsche und Schweizer Scheidemünze, Batzen genannt, zurück. Batzendorf war eine fingierte Dorfgemeinde, der jeder Einwohner Ernstthals beitreten konnte. Es war ein Jux, aber ein Jux, der häufig zum Ausarten kam. Batzendorf hatte seinen eigenen Gemeindevorstand, seinen eigenen Pfarrer, seine eigene Gemeindeverwaltung, das alles aber von der heiter sein sollenden Seite genommen. Das allerkleinste Häuschen Ernstthals, das der alten Gemüsehändlerin Dore Wendelbrück, wurde zum Batzendorfer Rathaus erhoben. Eines Morgens stand ein Turm darauf, den man aus Latten und Zigarrenkistchen gezimmert und der alten Dore auf das Dach gesetzt hatte, ohne sie zu fragen. Sie war aber sehr stolz darauf. Die Wirtin zum Meisterhaus war Dorfnachtwächter. Sie musste die / Stunden ansagen und tuten. Jede Behörde und jede Charge war vertreten, bis tief herunter zum Kartoffel- und zum Schotenwächter, auch das alles in das Komische gezogen. Des Sonnabends war Versammlungstag. Da kam die Gemeinde zusammen, und es wurden die tollsten Sachen ausgeheckt, um dann wirklich ausgeführt zu werden: Taufen fünfzigjähriger Säuglinge, Verheiratung zweier Witwen miteinander, eine Spritzenprobe ohne Wasser, Neuwahl einer Gemeindegans, öffentliche Prüfung eines neuen Bandwurmmittels und ähnliche tolle, oft sogar sehr tolle Sachen. Der Herr Stadtrichter Layritz war alt geworden und duldete das. Der Herr Pastor war noch älter und glaubte von allem das Beste. Er sagte immer: „Nur nicht übertreiben, nur nicht übertreiben!“ Damit glaubte er, seiner Pflicht genügt zu haben. Der Herr Kantor schüttelte den Kopf. Er war zu bescheiden, öffentlich mit einem Tadel hervorzutreten. Aber unter vier Augen hatte er den Mut, meinen Vater zu warnen: „Machen Sie nicht mit, Herr Nachbar, machen Sie ja nicht mit! Es ist nicht gut für Sie und auch nicht gut für den Karl! Was man da treibt, ist alles weiter nichts als Persiflage, Ironie, Verhöhnung und Verspottung von Dingen, an deren Heiligkeit ja niemand rühren soll! Und zumal Kinder sollen so etwas nie zu sehen und zu hören bekommen!“
Er hatte sehr, sehr Recht. Dieses ‚Batzendorf‘, in dem man nur mit Batzengeld zahlen durfte, hat eine ganze Reihe von Jahren bestanden und manche stille, heimliche, doch umso bösere Wirkung gehabt. Da lockerten sich ‚die Bande frommer Scheu‘. Da gab es wöchentlich etwas Neues. Wir Kinder verfolgten die Albernheiten der Erwachsenen mit riesigem Interesse und höhnten und persiflierten mit, freilich ohne uns dessen bewusst / zu werden. Das ging so fort, bis ein neuer, strammerer Zug in die Ortsverwaltung und in die Kirchenleitung kam und Batzendorf an sich selbst zu Grunde ging. Aber einen Nutzen hatte es keinem Menschen gebracht. Es war eine Versumpfung, in welche nicht nur die Alten gestiegen sind, sondern wir Jungen wurden auch mit hineingeführt und haben sehr viel von unserer Kindlichkeit drin stecken lassen müssen. Dem Unbegabten schadet das weniger; in dem Begabten aber wirkt es fort und nimmt in seinem Innern Dimensionen an, die später, wenn sie zu Tage treten, nicht mehr einzudämmen sind.
Die ‚Lügenschmiede‘ war etwas neueren Datums. Indem ich von ihr spreche, nenne ich absichtlich keine Namen. Ich will das, was ich sage, nur gegen die Sache selbst, nicht aber gegen Personen richten. Es gab in Ernstthal einige jüngere Leute, die außerordentlich satirisch begabt waren. An sich sehr achtbare, liebenswürdige Menschen, hätten sie in anderen, größeren Verhältnissen durch diese Begabung ihr Glück machen können; so aber blieben sie unten in den kleinen Verhältnissen hängen und konnten also auch nur Kleinliches und Gewöhnliches, oft sogar nur sehr Triviales leisten. Es war wirklich schade um sie!
Einer von ihnen, vielleicht der Unternehmendste und Witzigste, brachte es zum Hausbesitzer und hatte die Kühnheit, in diesem Ernstthal, wo so wenig Sinn und Mittel für Delikatessen vorhanden waren, ein Delikatessengeschäft zu errichten, aber natürlich mit Restauration, denn ohne diese wäre es ganz unmöglich gegangen. Diese Restauration hatte zunächst keinen besonderen Namen; aber nicht lange, so wurde ihr einer gegeben, und zwar ein sehr bezeichnender. Man nannte sie die Lügenschmiede und ihren Besitzer, den Wirt, den Lügenschmied. / Weshalb? Sowohl dem Wirt als auch seinen Stammgästen saß allen der Schalk im Nacken. Ein anderer konnte öfters dort verkehren, ohne dass er etwas davon bemerkte. Aber plötzlich brach es über ihn herein, plötzlich, ganz unerwartet und mit einer Sicherheit, der nicht zu widerstehen war. Er wurde ‚gemacht‘, wie man es nannte. Man hatte seine schwächste Seite und seinen stärksten Nagel entdeckt und hängte an diesem irgendeine wohlausgedachte Lüge auf, die er glauben musste, er mochte wollen oder nicht. An dieser Lüge blamierte er sich, mochte er sich noch so sehr dagegen sträuben oder mochte er zehnmal und hundertmal klüger sein als alle die, welche beschlossen hatten, ihn zu Fall zu bringen. Diese Lügenschmiede wurde weithin bekannt. Tausende von Fremden kamen, um da einzukehren, und ein jeder, dem es etwa einfiel, mit dem Wirt und seinen Stammgästen anzubinden, nahm seine Backpfeife mit und zog beschämt von dannen.
Gewöhnliche Gäste kaufte man sich billig. Verlangte einer ein Glas Bier, so bekam er einen Kognak. Begehrte er einen Schnaps, so erhielt er Limonade. Wollte er einen marinierten Hering essen, so setzte man ihm Kartoffeln in der Schale und Apfelmus vor. Und keiner weigerte sich, dies zu nehmen und zu bezahlen, denn jeder wusste, die Blamage kommt dann hinterher. Bessere Gäste hatten keine so gewöhnlichen Witze zu befürchten. Die ließ man warten. „Der muss erst noch reif werden“, pflegte der Lügenschmied zu sagen. Und jeder wurde reif, jeder, mochte er sein, wer oder was er wollte, ob studiert oder nicht studiert, ob hoch gestellt oder niedrig. Es gab da oft geradezu geniale Witze, immer aber mit einem Einschlag aus dem Gewöhnlichen heraus. Einem Gast, der sich rasieren lassen wollte, wurde gesagt, der Barbier / sei nicht zu Hause, sondern er sitze grad hier neben ihm. Dieser war aber kein Barbier, sondern ein Bäckermeister. Er seifte den Betreffenden mit Anilinwasser ein und rasierte ihn, ohne dass einer der Anwesenden eine Miene dabei verzog. Der Rasierte bezahlte und ging dann vergnügt von dannen, vollständig blau im Gesicht. Er konnte sich wochenlang nicht sehen lassen, zur Strafe dafür, dass er in der Lügenschmiede behauptet hatte, er sei gescheiter als alle, ihn könne niemand foppen. Einem andern Gast wurde weisgemacht, sein Bruder sei heut’ Vormittag auf dem Jahrmarkt verunglückt und mit dem rechten Bein in das Räderwerk geraten; man habe ihm infolgedessen das Bein unterhalb des Knies abnehmen müssen. Der Mann sprang erschrocken auf und rannte fort, kam aber sehr bald lachend und mit seinem vollständig gesunden Bruder zurück. Auch die Herren von der Behörde verkehrten sehr gern in der Lügenschmiede, doch nur zu Zeiten, in denen sie sich dort allein und unbeobachtet wussten. Sie ließen sich auch einen Ulk gefallen, und oft hatte der Lügenschmied es nur ihrem Einfluss zu verdanken, dass seine oft zu weit gehenden Witze ohne unangenehme Folgen blieben. Denn die Sache artete, wie alles, was unten aus dem Niedrigen stammt, nach und nach aus. Die Witze wurden gewöhnlicher; sie verloren den Reiz. Man hatte sich verausgabt. Und ein jeder, der die Lügenschmiede betrat, glaubte, Lügen machen und Unwahrheiten präsentieren zu dürfen. Der Geist ging aus. Was früher wirklicher Humor, wirkliche Schalkhaftigkeit und wirklicher Scherz und Schwank gewesen war, das wurde jetzt zur Zote, zur Zweideutigkeit, zur Unwahrheit, zur Fälschung, zur unvorsichtigen Klatscherei und Lüge. Die Lügenschmiede ist jetzt ver- / schwunden. Das Haus wurde der Erde gleichgemacht29. Leider aber sind die Folgen dieser unangebrachten Witzbolderei nicht auch verschwunden. Sie existieren noch heute. Sie wirken fort. Auch das war ein Sumpf, und zwar ein unter hellem Grün und winkenden Blumen verborgener Sumpf. Nicht nur die Ortsseele hat unter ihm gelitten, sondern seine Miasmen sind auch im weiten Umkreis rund über das Land gegangen, und leider, leider bin auch ich einer von denen, die sehr und schwer darunter zu leiden hatten und noch heutigen Tages leiden müssen. Dass meine Gegner es wagen konnten, den Karl May, der ich in Wirklichkeit und Wahrheit bin, in die verlogenste aller Karikaturen zu verwandeln und mich sogar als Marktweiberbandit und Räuberhauptmann durch alle Zeitungen zu schleppen, das wurde zum größten Teil durch die Lügenschmiede ermöglicht, deren Stammgäste gar nicht bedachten, was sie an mir begingen, als sie einander mit immer neuen Erfindungen über meine angeblichen Abenteuer und Missetaten traktierten. Ich komme hierauf an anderer Stelle zurück und habe hier noch ganz kurz zu sagen:
Was ich über jene Falschspielergesellschaft, über ‚Batzendorf‘ und über die ‚Lügenschmiede‘ zu berichten hatte, sind nur einige kurze Einblicke in die damaligen Verhältnisse meiner Vaterstadt. Ich könnte diese Einblicke noch überaus erweitern und vertiefen, um nachzuweisen, dass es wirklich und wahrhaft ein sehr verseuchter Boden gewesen ist, in den meine Seele gezwungen war, ihre Wurzeln zu schlagen, will dies aber gern und mit Vergnügen unterlassen, weil ich kürzlich zu meiner Freude gesehen habe, wie viel sich dort verändert hat. Ich hatte meine Vaterstadt schon lange Zeit gemieden und wollte sie auch ferner meiden, als ich durch eine Rechtssache gezwungen wurde, / sie noch einmal aufzusuchen. Ich wurde angenehm enttäuscht. Das meine ich nicht äußerlich, sondern innerlich. Ich habe der Städte und Orte genug gesehen; da kann mich nichts überraschen und auch nichts enttäuschen. Wie ich bei jeder Begegnung mit einem mir bisher fremden Menschen zunächst und vor allen Dingen seine Seele kennenzulernen suche, so auch die Seele eines jeden Ortes, den ich neu betrete. Und die Seele Hohenstein-Ernstthals war zwar noch die alte; das sah ich sofort; aber sie hatte sich gehoben; sie hatte sich gereinigt; sie hatte ein ganz anderes, besseres und würdigeres Aussehen bekommen. Ich hatte Gelegenheit, sie einige Tage lang beobachten zu können, und darf wohl sagen, dass mir diese Beobachtungen Freude bereiteten. Ich fand Intelligenz, wo es früher keine gegeben hatte. Ich begegnete einem regen Rechtsgefühl, das nicht so leicht wie früher irrezuleiten war. Es gab mehr Gemeindesinn, mehr Zusammenhangsgefühl. Ja, die materiellen Verhältnisse zeigten überall schon einen Aufblick hinauf in das Ideale. Der Boden, auf dem man lebte, hatte sich gehoben und zeigte die Fähigkeit, sich auch fernerhin zu veredeln. Ich begegnete alten Bekannten, aus denen in Wirklichkeit ‚etwas geworden‘ war. Das war mir eine Genugtuung, die ich nicht erwartet hatte. Da gab es nicht mehr jene alten, indolenten Gesichter mit dem Ausdruck unangenehmer Bauernpfiffigkeit, sondern die Züge sprachen von Einsicht und Fähigkeit, von gesunder Klugheit und überlegsamer Urteilskraft. War dies etwa nur eine Folge des Zuzugs von außen her? Gewiss nicht ausschließlich, obwohl nicht abgeleugnet werden kann, dass fremdes Blut auch im Gemeindeleben auffrischend, stärkend und verbessernd wirkt. Ich gestehe aufrichtig, dass ich seit jenem Besuch und seit jenen Be- / obachtungen mit meiner Vaterstadt wieder sympathisiere und von Herzen wünsche, dass der jetzt so deutlich sichtbare Fortschritt auch nach geistigen Zielen anhalten möge. Der Beweis ist erbracht, dass die alten Zeiten vorüber sind. Man hat sich aufgerafft und steigt mit jugendlicher Energie empor; das bringt Erfolg, und mit dem Erfolg kommt auch der Segen. –
Nach diesen allgemeinen Bemerkungen kann ich nun zu mir selbst zurückkehren und zu jener Morgenfrühe, in der ich aus Ernstthal fortging, um mir bei einem edlen spanischen Räuberhauptmann Hilfe zu holen. Man glaube ja nicht, dass dies eine ‚verrückte‘ Idee gewesen sei. Ich war geistig kerngesund. Meine Logik war zwar noch kindlich, aber doch schon wohlgeübt. Der Fehler lag daran, dass ich infolge des verschlungenen Leseschunds den Roman für das Leben hielt und darum das Leben nun einfach als Roman behandelte. Die überreiche Fantasie, mit der mich die Natur begabte, machte die Möglichkeit dieser Verwechslung zur Wirklichkeit.
Neumarkt in Ernstthal; von links: „Stadt Glauchau“, Wohnhaus May nach 1845, Häuser Kantor Strauch und Pfarrer Schmidt, Kirche St. Trinitatis (Zeichnung 1843)
Die „Lügenschmiede“ an der Braugasse in Ernstthal mit Blick in die Hermannstraße. Das Restaurant wurde 1900 abgerissen.
Meine Reise nach Spanien dauerte nur einen Tag. In der Gegend von Zwickau wohnten Verwandte von uns. Bei ihnen kehrte ich ein. Sie nahmen mich freundlich auf und veranlassten mich zu bleiben. Inzwischen hatte man daheim meinen Zettel gefunden und gelesen. Vater wusste, nach welcher Richtung hin Spanien liegt. Er dachte sofort an die erwähnten Verwandten und machte sich in der Überzeugung, mich sicher dort anzutreffen, sofort auf den Weg. Als er kam, saßen wir rund um den Tisch, und ich erzählte in aller Herzensaufrichtigkeit, wohin ich wollte, zu wem und auch warum. Die Verwandten waren arme, einfache, ehrliche Webersleute. Von Fantasie gab es bei ihnen keine Spur. Sie waren über mein Vorhaben einfach entsetzt. Hilfe bei / einem Räuberhauptmann suchen! Sie wussten sich zunächst keinen Rat, was sie mit mir anfangen sollten, und da war es wie eine Erlösung für sie, als sie meinen Vater hereintreten sahen. Er, der jähzornige, leicht überhitzige Mann, verhielt sich ganz anders als gewöhnlich. Seine Augen waren feucht. Er sagte mir kein einziges Wort des Zorns. Er drückte mich an sich und sagte: „Mach so etwas niemals wieder, niemals!“ Dann ging er nach kurzem Ausruhen mit mir fort – wieder heim.
Der Weg betrug fünf Stunden. Wir sind in dieser Zeit still nebeneinander hergegangen; er führte mich an der Hand. Nie habe ich deutlicher gefühlt als damals, wie lieb er mich eigentlich hatte. Alles, was er vom Leben wünschte und hoffte, das konzentrierte er auf mich. Ich nahm mir heilig vor, ihn niemals wieder ein solches Leid wie das heutige an mir erleben zu lassen. Und er? Was mochten das wohl für Gedanken sein, die jetzt in ihm erklangen? Er sagte nichts. Als wir nach Hause kamen, musste ich mich niederlegen, denn ich kleiner Kerl war zehn Stunden lang gelaufen und außerordentlich müde. Von meinem Ausflug nach Spanien wurde nie ein Wort gesprochen; aber das Kegelaufsetzen und das Lesen jener verderblichen Romane hörte auf. Als dann die Zeit gekommen war, stellte sich die nötige Hilfe ein, ohne aus dem Land der Kastanien geholt werden zu müssen. Der Herr Pastor legte ein gutes Wort für mich bei unserm Kirchenpatron, dem Grafen von Hinterglauchau, ein, und dieser gewährte mir eine Unterstützung von fünfzehn Talern pro Jahr, eine Summe, die man für mich für hinreichend hielt, das Seminar zu besuchen30. Zu Ostern 1856 wurde ich konfirmiert. Zu Michaelis bestand ich die Aufnahmeprüfung für das Proseminar zu Waldenburg und wurde dort aufgenommen. /
Also nicht Gymnasiast, sondern nur Seminarist! Nicht akademisches Studium, sondern nur Lehrer werden! Nur? Wie falsch! Es gibt keinen höheren Stand als den Lehrerstand, und ich dachte, fühlte und lebte mich derart in meine nunmehrige Aufgabe hinein, dass mir alles Freude machte, was sich auf sie bezog. Freilich stand diese Aufgabe nur im Vordergrund. Im Hintergrund, hoch über sie hinausragend, hob sich das über alles andere empor, was mir seit jenem Abend, an dem ich den Faust gesehen hatte, zum Ideal geworden war: Stücke für das Theater schreiben! Über das Thema Gott, Mensch und Teufel! Konnte ich das als Lehrer nicht ebenso gut wie als gewesener Akademiker? Ganz gewiss, vorausgesetzt freilich, dass die Gabe dazu nicht fehlte. Wie stolz ich war, als ich zum ersten Mal die grüne Mütze trug! Wie stolz auch meine Eltern und Geschwister! Großmutter drückte mich an sich und bat:
„Denk immer an unser Märchen! Jetzt bist du noch in Ardistan; du sollst aber hinauf nach Dschinnistan. Dieser Weg wird heut beginnen. Du hast zu steigen. Kehre dich niemals an die, welche dich zurückhalten wollen!“
„Und die Geisterschmiede?“, fragte ich. „Muss ich da hinein?“
„Bist du es wert, so kannst du sie nicht umgehen“, antwortete sie. „Bist du es aber nicht wert, so wird dein Leben ohne Kampf und ohne Qual verlaufen.“
„Ich will aber hinein; ich will!“, rief ich mutig aus.
Da legte sie mir ihre Hand auf das Haupt und sagte lächelnd:
„Das steht bei Gott: Vergiss ihn nicht! Vergiss ihn nie in deinem Leben!“
Diesem Rat bin ich gehorsam gewesen, muss aber, / wenn ich ehrlich sein will, eingestehen, dass mir das niemals schwer geworden ist. Ich kann mich nicht besinnen, dass ich je mit dem Zweifel oder gar mit dem Unglauben zu ringen gehabt hätte. Die Überzeugung, dass es einen Gott gebe, der auch über mir wachen und mich nie verlassen werde, ist, sozusagen, zu jeder Zeit ein festes, unveräußerliches Ingrediens meiner Persönlichkeit gewesen, und ich kann es mir also keineswegs als ein Verdienst anrechnen, dass ich diesem meinem lichten, schönen Kinderglauben niemals untreu geworden bin. Freilich, so ganz ohne alle innere Störung ist es auch bei mir nicht abgegangen; aber diese Störung kam von außen her und wurde nicht in der Weise aufgenommen, dass sie sich hätte festsetzen können. Sie hatte ihre Ursache in der ganz besonderen Art, in welcher die Theologie und der Religionsunterricht am Seminar behandelt wurde. Es gab täglich Morgen- und Abendandachten, an denen jeder Schüler unweigerlich teilnehmen musste. Das war ganz richtig. Wir wurden sonn- und feiertäglich in corpore in die Kirche geführt. Das war ebenso richtig. Es gab außerdem bestimmte Feierlichkeiten für Missions- und ähnliche Zwecke. Auch das war gut und zweckentsprechend. Und es gab für sämtliche Seminarklassen einen wohldurchdachten, sehr reichlich ausfallenden Unterricht in Religions-, Bibel- und Gesangbuchslehre. Das war ganz selbstverständlich. Aber es gab bei alledem eines nicht, nämlich gerade das, was in allen religiösen Dingen die Hauptsache ist; nämlich es gab keine Liebe, keine Milde, keine Demut, keine Versöhnlichkeit. Der Unterricht war kalt, streng, hart. Es fehlte ihm jede Spur von Poesie. Anstatt zu beglücken, zu begeistern, stieß er ab. Die Religionsstunden waren diejenigen Stunden, für welche man sich am allerwenigsten zu erwärmen vermochte. / Man war immer froh, wenn der Zeiger die Zwölf erreichte. Dabei wurde dieser Unterricht von Jahr zu Jahr in genau denselben Absätzen und genau denselben Worten und Ausdrücken geführt. Was es am heutigen Datum gab, das gab es im nächsten Jahr an ganz demselben Tag unweigerlich wieder. Das ging wie eine alte Kuckucksuhr; das klang alles so sehr nach Holz, und das sah alles so aus wie gemacht, wie fabriziert. Jeder einzelne Gedanke gehörte in sein bestimmtes Dutzend und durfte sich beileibe nicht an einer anderen Stelle sehen lassen. Das ließ keine Spur von Wärme aufkommen; das tötete innerlich ab. Ich habe unter allen meinen Mitschülern keinen einzigen gekannt, der jemals ein sympathisches Wort über diese Art des Religionsunterrichts gesagt hätte. Und ich habe auch keinen gekannt, der so religiös gewesen wäre, aus freien Stücken einmal die Hände zu falten, um zu beten. Ich selbst habe stets und bei jeder Veranlassung gebetet; ich tue das auch noch heute, ohne mich zu genieren; aber damals im Seminar habe ich das geheim gehalten, weil ich das Lächeln meiner Mitschüler fürchtete.
Ich hätte gern über diese religiösen Verhältnisse geschwiegen, durfte dies aber nicht, weil ich die Aufgabe habe, alles aufrichtig zu sagen, was auf meinen inneren und äußeren Werdegang von Einfluss war. Dieses Seminar-Christentum kam mir ebenso seelenlos wie streitbar vor. Es befriedigte nicht und behauptete trotzdem, die einzige reine, wahre Lehre zu sein. Wie arm und wie gottverlassen man sich da fühlte! Die andern nahmen das gar nicht etwa als ein Unglück hin; sie waren gleichgültig; ich aber mit meiner religiösen Liebebedürftigkeit fühlte mich erkaltet und zog mich in mich selbst zurück. Ich vereinsamte auch hier, und zwar mehr, viel mehr / als daheim. Und ich wurde hier noch klassenfremder, als ich es dort gewesen war. Das lag teils in den Verhältnissen, teils aber auch an mir selbst.
Ich wusste viel mehr als meine Mitschüler. Das darf ich sagen, ohne in den Verdacht der Prahlerei zu fallen. Denn was ich wusste, das war eben nichts weiter als nur Wust, eine regellose, ungeordnete Anhäufung von Wissensstoff, der mir nicht den geringsten Nutzen brachte, sondern mich nur beschwerte. Wenn ich ja einmal von dieser meiner unfruchtbaren Vielwisserei etwas merken ließ, sah man mich staunend an und lächelte darüber. Man fühlte instinktiv heraus, dass ich weniger beneidens- als vielmehr beklagenswert sei. Die andern, meist Lehrersöhne, hatten zwar nicht so viel gelernt, aber das, was sie gelernt hatten, lag wohlaufgespeichert und wohlgeordnet in den Kammern ihres Gedächtnisses, stets bereit, benutzt zu werden. Ich fühlte, dass ich gegen sie sehr im Nachteil stand, und sträubte mich doch, dies mir und ihnen einzugestehen. Meine stille und fleißige Hauptarbeit war, vor allen Dingen Ordnung in meinem armen Kopf zu schaffen, und das ging leider nicht so schnell, wie ich es wünschte. Das, was ich da aufbaute, fiel immer wieder ein. Es war wie ein mühsames Graben durch einen Schneehaufen hindurch, dessen Massen immer wieder nachrutschen. Und dabei gab es einen Gegensatz, der sich absolut nicht beseitigen lassen wollte. Nämlich den Gegensatz zwischen meiner außerordentlich fruchtbaren Fantasie und der Trockenheit und absoluten Poesielosigkeit des hiesigen Unterrichts. Ich war damals noch viel zu jung, als dass ich eingesehen hätte, woher diese Trockenheit kam. Man lehrte nämlich weniger das, was zu lernen war, als vielmehr die Art und Weise, in der man zu lernen / hatte. Man lehrte uns das Lernen. Hatten wir das begriffen, so war das Weitere leicht. Man gab uns lauter Knochen; daher die geradezu schmerzende Trockenheit des Unterrichts. Aber aus diesen Knochen fügte man die Skelette der einzelnen Wissenschaften zusammen, deren Fleisch dann später hinzuzufügen war. Bei mir aber hatte sich bisher gerade das Umgekehrte ereignet: Ich hatte mir zwar eine Unmasse von Fleisch zusammengeschleppt, aber keinen einzigen tragenden, stützenden Knochen dazu. In meinem Wissen fehlte das feste Gerippe. Ich war in Beziehung auf das, was ich geistig besaß, eine Qualle, die weder innerlich noch äußerlich einen Halt besaß und darum auch keinen Ort, an dem sie sich daheim zu fühlen vermochte.
Und das Schlimmste hierbei war: Das knochenlose Fleisch dieser Qualle war nicht gesund, sondern krank, schwer krank; es war von den Schundromanen des Kegelhausbesitzers vergiftet. Das begann ich jetzt erst eigentlich einzusehen und fühlte mich umso unglücklicher dabei, als ich mit keinem Menschen darüber sprechen konnte, ohne mich dadurch bloßzustellen. Gerade die Trockenheit und, ich muss wohl sagen, die Seelenlosigkeit dieses Seminarunterrichts war es, die mich zu der Erkenntnis meiner Vergiftung führte. Ich fand für die Skelette, die uns geboten wurden, damit wir sie beleben möchten, kein gesundes Fleisch in mir. Alles, was ich zusammenfügte und was ich mir innerlich aufzubauen versuchte, wurde formlos, wurde hässlich, wurde unwahr und ungesetzlich. Ich begann, Angst vor mir zu bekommen, und arbeitete unausgesetzt an meiner seelischen Gestalt herum, mich innerlich zu säubern, zu reinigen, zu ordnen und zu heben, ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen, die es ja auch gar nicht gab. Ich hätte mich wohl gern einem unserer Lehrer / anvertraut, aber die waren ja alle so erhaben, so kalt, so unnahbar, und vor allen Dingen, das fühlte ich heraus, keiner von ihnen hätte mich verstanden; sie waren keine Psychologen. Sie hätten mich befremdet angesehen und einfach stehengelassen.
Hierzu kam der angeborene, unwiderstehliche Drang nach geistiger Betätigung. Ich lernte sehr leicht und hatte demzufolge viel Zeit übrig. So dichtete ich im Stillen; ja, ich komponierte. Die paar Pfennig, die ich erübrigte, wurden in Schreibpapier angelegt. Aber was ich schrieb, das sollte keine Schülerarbeit werden, sondern etwas Brauchbares, etwas wirklich Gutes. Und was schrieb ich da? Ganz selbstverständlich eine Indianergeschichte! Wozu? Ganz selbstverständlich, um gedruckt zu werden! Von wem? Ganz selbstverständlich von der ‚Gartenlaube‘, die vor einigen Jahren gegründet worden war, aber schon von jedermann gelesen wurde31. Da war ich sechzehn Jahre alt. Ich schickte das Manuskript ein. Als sich eine ganze Woche lang nichts hierauf ereignete, bat ich um Antwort. Es kam keine. Darum schrieb ich nach weiteren vierzehn Tagen in einem strengeren Ton, und nach weiteren zwei Wochen verlangte ich mein Manuskript zurück, um es an eine andere Redaktion zu senden. Es kam. Dazu ein Brief, von Ernst Keil32 selbst geschrieben, vier große Quartseiten lang. Ich war fern davon, dies so zu schätzen, wie es zu schätzen war. Er kanzelte mich zunächst ganz tüchtig herunter, sodass ich mich wirklich aufrichtig schämte, denn er zählte mir höchst gewissenhaft alle Missetaten auf, die ich, natürlich ohne es zu ahnen, in der Erzählung begangen hatte. Gegen den Schluss hin aber milderten sich die Vorwürfe, und am Ende reichte er mir, dem dummen Jungen, vergnügt die Hand und sagte mir, dass er nicht übermäßig entsetzt / sein würde, wenn sich nach vier oder fünf Jahren wieder eine Indianergeschichte von mir bei ihm einstellen sollte. Er hat keine bekommen; aber daran trage nicht ich die Schuld, sondern die Verhältnisse gestatteten es nicht. Das war der erste literarische Erfolg, den ich zu verzeichnen habe. Damals freilich hielt ich es für einen absoluten Misserfolg und fühlte mich sehr unglücklich darüber. Inzwischen verging die Zeit. Ich stieg aus dem Proseminar in die vierte, dritte und zweite Seminarklasse, und in dieser zweiten Klasse war es, wo mich jenes Schicksal überfiel, aus dem meine Gegner so übelklingendes Kapital geschlagen haben.
Es herrschte im Seminar der Gebrauch, dass die Angelegenheiten jeder Klasse reihum zu besorgen waren, von jedem eine Woche lang. Darum wurde der Betreffende als ‚Wochner‘ bezeichnet. Außerdem gab es in der ersten Klasse einen ‚Ordnungswochner‘ und in der zweiten einen ‚Lichtwochner‘, welch Letzterer die Beleuchtung der Klassenzimmer zu übersehen hatte. Diese Beleuchtung geschah damals mit Hilfe von Talglichtern, von denen, wenn eines niedergebrannt war, ein anderes neu aufgesteckt wurde. Der Lichtwochner hatte täglich die Säuberung der alten, wertlosen Leuchter vorzunehmen und insbesondere die Dillen von den stecken gebliebenen Docht- und Talgresten zu reinigen. Diese Reste wurden entweder einfach weggeworfen oder vom Hausmann zu Stiefel- oder anderer Schmiere zusammengeschmolzen. Sie waren allgemein als wertlos anzusehen.
Es war anfangs der Weihnachtswoche, als die Reihe, Lichtwochner zu sein, an mich kam33. Ich besorgte diese Arbeit wie jeder andere. Am Tag vor dem Weihnachtsheiligenabend begannen unsere Ferien. Am Tage vorher kam eine meiner Schwestern, um meine Wäsche ab- / zuholen und das wenige Gepäck, welches ich mit in die Ferien zu nehmen hatte. Sie tat dies stets, sooft es Ferien gab. Der Weg, den sie da von Ernstthal nach Waldenburg machte, war zwei Stunden lang. So auch jetzt. Als sie diesmal kam, war ich gerade beim Reinigen der Leuchter. Sie war traurig. Es stand nicht gut daheim. Es gab keine Arbeit und darum keinen Verdienst. Mutter pflegte, wie selbst die ärmsten Leute, für das Weihnachtsfest wenigstens einige Kuchen zu backen. Das hatte sie heuer kaum erschwingen können. Aber beschert werden konnte nichts, gar nichts, denn es fehlte das Geld dazu. Es gab keine Lichte für den Weihnachtsleuchter. Sogar die hölzernen Engel der kleineren Schwestern sollten ohne Lichte sein. Zu diesen Engeln gehörten drei kleine Lichte, das Stück für fünf oder sechs Pfennig; aber wenn diese achtzehn Pfennig zu andern, notwendigeren Dingen gebraucht wurden, so hatte man sich eben zu fügen. Das tat mir weh. Der Schwester stand das Weinen hinter den Augen. Sie sah die Talgreste, die ich soeben aus den Dillen und von den Leuchtern herabgekratzt hatte. „Könnte man denn daraus nicht einige Pfenniglichte machen?“, fragte sie. „Ganz leicht“, antwortete ich. „Man braucht dazu eine Papierröhre und einen Docht, weiter nichts. Aber brennen würde es schlecht, denn dieses Zeug ist nur noch höchstens für Schmiere zu gebrauchen.“ „Wenn auch, wenn auch! Wir hätten doch eine Art von Licht für die drei Engel. Wem gehört dieser Abfall?“ „Eigentlich niemandem. Ich habe ihn zum Hausmann zu schaffen. Ob der ihn wegwirft oder nicht, ist seine Sache.“ „Also wäre es wohl nicht gestohlen, wenn wir uns ein bisschen davon mit nach Hause nähmen?“ „Gestohlen? Lächerlich! Fällt keinem Menschen ein! Der ganze Schmutz ist nicht drei Pfennige / wert. Ich wickle dir ein wenig davon ein. Daraus machen wir drei kleine Weihnachtslichte.“34
Gesagt, getan! Wir waren nicht allein. Ein anderer Seminarist stand dabei. Einer aus der ersten Klasse, also eine Klasse über mir. Es widerstrebt mir, seinen Namen zu nennen. Sein Vater war Gendarm. Dieser wackere Mitschüler sah alles mit an. Er warnte mich nicht etwa, sondern er war ganz freundlich dabei, ging fort und – zeigte mich an. Der Herr Direktor kam in eigener Person, den ‚Diebstahl‘ zu untersuchen. Ich gestand sehr ruhig ein, was ich getan hatte, und gab den ‚Raub‘, den ich begangen hatte, zurück. Ich dachte wahrhaftig nichts Arges. Er aber nannte mich einen ‚infernalischen Charakter‘ und rief die Lehrerkonferenz zusammen, über mich und meine Strafe zu entscheiden. Schon nach einer halben Stunde wurde sie mir verkündet. Ich war aus dem Seminar entlassen und konnte gehen, wohin es mir beliebte.35 Ich ging gleich mit der Schwester – in die heiligen Christferien – ohne Talg für die Weihnachtsengel – es waren das sehr trübe, dunkle Weihnachtsfeiertage. Ich habe wohl überhaupt schon gesagt, dass gerade Weihnacht für mich oft eine Zeit der Trauer, nicht der Freude gewesen sei.
An diesen Weihnachtstagen erloschen heilige Flammen in mir, Lichter, die mir wert gewesen waren. Ich lernte zwischen dem Christentum und seinen Bekennern unterscheiden. Ich hatte Christen kennengelernt, die unchristlicher gegen mich verfahren waren, als Juden, Türken und Heiden verfahren würden.
Glücklicherweise zeigte sich das Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts, an welches ich mich wandte, verständiger und humaner als die Seminardirektion. Ich erlangte ohne Weiteres die Genehmigung, meine unter- / brochenen Studien auf dem Seminar in Plauen fortzusetzen. Ich kam dort in dieselbe Klasse36, also in die zweite, und bestand nach zurückgelegter erster Klasse das Lehrerexamen37, worauf ich meine erste Stelle in Glauchau38 erhielt, bald aber nach Altchemnitz kam, und zwar in eine Fabrikschule39, deren Schüler ausschließlich aus ziemlich erwachsenen Fabrikarbeitern bestanden. Hier haben meine Bekenntnisse zu beginnen. Ich lege sie ab, ohne Scheu, der Wahrheit gemäß, als ob ich mich nicht mit mir selbst, sondern mit einer anderen, mir fremden Person beschäftigte.
Ich komme auf die Armut meiner Eltern zurück. Das Examen hatte einen Frackanzug erfordert, für unsere Verhältnisse eine kostspielige Sache. Hierzu kam, da ich als Lehrer nicht mehr wie als Schüler herumlaufen konnte, eine wenn auch noch so bescheidene Ausstattung an Wäsche und anderen notwendigen Dingen. Das konnten meine Eltern nicht bezahlen; ich musste es auf mein Konto nehmen; das heißt, ich borgte es mir, um es von meinem Gehalt nach und nach abzuzahlen. Da hieß es sparsam sein und jeden Pfennig umdrehen, ehe er ausgegeben wurde! Ich beschränkte mich auf das Äußerste und verzichtete auf jede Ausgabe, die nicht absolut notwendig war. Ich besaß nicht einmal eine Uhr, die doch für einen Lehrer, der sich nach Minuten zu richten hat, fast unentbehrlich ist.
Der Fabrikherr, dessen Schule mir anvertraut worden war, hatte kontraktlich für Logis für mich zu sorgen. Er machte sich das leicht. Einer seiner Buchhalter besaß auch freies Logis, Stube mit Schlafstube. Er hatte bisher beides allein besessen; nun wurde ich zu ihm einquartiert; er musste mit mir teilen. Hierdurch verlor er seine Selbstständigkeit und seine Bequemlichkeit; ich genierte ihn an allen Ecken und Enden, und so lässt es sich gar / wohl begreifen, dass ich ihm nicht sonderlich willkommen war und ihm der Gedanke nahelag, sich auf irgendeine Weise von dieser Störung zu befreien. Im Übrigen kam ich ganz gut mit ihm aus. Ich war ihm möglichst gefällig und behandelte ihn, da ich sah, dass er das wünschte, als den eigentlichen Herrn des Logis. Das verpflichtete ihn zur Gegenfreundlichkeit. Die Gelegenheit hierzu fand sich sehr bald. Er hatte von seinen Eltern eine neue Taschenuhr bekommen. Seine alte, die er nun nicht mehr brauchte, hing unbenutzt an einem Nagel an der Wand. Sie hatte einen Wert von höchstens zwanzig Mark. Er bot sie mir zum Kauf an, weil ich keine besaß; ich lehnte aber ab, denn wenn ich mir einmal eine Uhr kaufte, so sollte es eine neue, bessere sein. Freilich stand dies noch in weitem Feld, weil ich zuvor meine Schulden abzuzahlen hatte. Da machte er selbst mir den Vorschlag, seine alte Uhr, wenn ich in die Schule müsse, zu mir zu stecken, da ich doch zur Pünktlichkeit verpflichtet sei. Ich ging darauf ein und war ihm dankbar dafür. In der ersten Zeit hängte ich die Uhr, sobald ich aus der Schule zurückkehrte, sofort an den Nagel zurück. Später unterblieb das zuweilen; ich behielt sie noch stundenlang in der Tasche, denn eine so auffällige Betonung, dass sie nicht mir gehöre, kam mir nicht gewissenhaft, sondern lächerlich vor. Schließlich nahm ich sie sogar auf Ausgängen mit und hängte sie erst am Abend, nach meiner Heimkehr, an Ort und Stelle. Ein wirklich freundschaftlicher oder gar herzlicher Umgang fand nicht zwischen uns statt. Er duldete mich nur notgedrungen und ließ es mich zuweilen absichtlich merken, dass ihm die Teilung seiner Wohnung nicht behage.
Königliches Seminar zu Waldenburg um 1850
Königliches Seminar zu Plauen um 1870