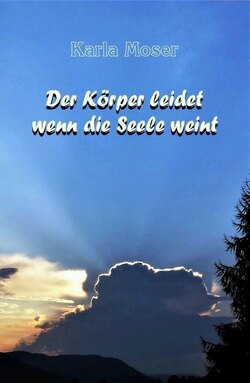Читать книгу Der Körper leidet wenn die Seele weint - Karla Moser - Страница 12
ОглавлениеErkältungskrankheiten
Halsschmerzen
Sag mir, was plagt dich?
Ist es dein Hals, der weh‘ dir tut?
Er tut dir weh beim Schlucken.
Was ist’s, was du nicht schlucken kannst?
Hat man dir etwas angetan?
Du brauchst es nicht zu schlucken.
Es ist nicht deins, es geht dich gar nichts an.
Volksmund
An etwas schwer zu schlucken haben
Der Hals fühlt sich an wie zugeschnürt
Etwas bleibt einem im Hals stecken
Etwas kann einfach nicht mehr geschluckt werden
Es verschlägt einem glatt die Sprache
Pathogenese
Am häufigsten treten Halsschmerzen im Rahmen einer Erkältung auf. Dabei führen Viren zu einer Entzündung der gesamten Rachenhinterwand, eventuell unter Mitbeteiligung der Mandeln. Bakterielle Infektionen führen am häufigsten zu einer meist eitrigen Mandelentzündung. Diese kann die Rachenmandeln (Angina) oder die Seitenstrangmandeln (Seitenstrangangina) betreffen.
Auch hier gilt, wie bei den Erkältungskrankheiten, dass die Infektion auf der Basis einer momentan vorhandenen Abwehrschwäche auftritt.
Die Beschwerden beginnen meist plötzlich. Die Halsschmerzen machen sich akut durch Schmerzen beim Schlucken bemerkbar. Auch die Stimme verändert sich. Sie wird kratzig und rauchig. Die Halslymphknoten sind geschwollen und es tritt in dem betroffenen Bereich eine Druckschmerzhaftigkeit auf.
Diese Erkrankung verläuft in der Regel unkompliziert und zeigt sich durch eine gerötete Rachenhinterwand, eventuell mit
• geschwollenen und geröteten Mandeln,
• Schluckbeschwerden,
• Schleimhautreizungen,
• Mundgeruch und
• Lymphknotenschwellungen.
Bei einem schweren Verlauf können noch begleitend Fieber, Kopfschmerzen oder Abgeschlagenheit dazu kommen.
Die Stimme kann plötzlich versagen.
Bei einigen Patienten findet sich als Ursache der Halsschmerzen ein Kloßgefühl im Hals. Dieses kann durch organische Ursachen im Rachenraum, der Luftröhre oder der Speiseröhre entstehen. Es gibt auch eine psychisch bedingte Variante (Globus hystericus). Diese ist ein Zeichen von Stress und Überanstrengung.
Therapie
In Fällen einer eitrigen Angina ist eine Behandlung mit Antibiotika notwendig. Hier drohen immer die Gefahr einer durch die Infektion entstehenden Herzerkrankung oder Gelenkentzündungen. Tritt eine eitrige Angina immer wieder auf oder sind die Rachenmandeln extrem vergrößert, müssen die Mandeln eventuell sogar operativ entfernt werden.
Bei weniger ausgeprägten Halsschmerzen helfen Spülungen und Gurgeln mit entsprechenden naturheilkundlichen Medikamenten. Falls dies nicht reicht, stehen selbstverständlich pflanzliche und homöopathische Mittel als Tropfen oder Tabletten und Tees zur Verfügung. In vielen Fällen reichen diese Medikamente schon aus.
Wirkungsvoll kann diese Behandlung mit Phototherapiepflastern unterstützt werden.
Auch durch Anwendung von Halsumschlägen und Kneipp‘sche Wickeln lassen die Schluckbeschwerden nach.
Der naturheilkundlich behandelnde Arzt oder Heilpraktiker sollte entscheiden, ob diese Produkte ausreichend sind beziehungsweise ein Antibiotikum notwendig ist.
Abwehrstärkende Mittel aus dem biologischen Bereich sind ebenfalls sinnvoll. Vor allem in Fällen von immer wiederkehrenden Erkrankungen sollten die Betroffenen dauerhaft und regelmäßig ihr Abwehrsystem stärken. Dann ist zusätzlich an eine Darmflorasanierung zu denken. Diese sollte nach einer Antibiotikatherapie auf jeden Fall erfolgen. Zusätzlich sollten scharfe Gewürze oder säurehaltige Nahrungsmittel vermieden werden.
Psychodynamik
Es sind allgemein sehr sensible und empfindsame, etwas vorsichtige und ängstliche Menschen, die zu diesen Krankheitsbildern neigen. Sie sagen ja und denken nein um gut anzukommen. Sie können irgendwann etwas nicht mehr Schlucken. Da sie sich jedoch nicht ausdrücken können, reagieren sie mit Schluckbeschwerden. Das Umfeld nimmt dann oft Rücksicht auf sie. Dadurch kommt es häufig zu den vom Betroffenen gewünschten Veränderungen.
Sie sind kontaktfreudig. Sie ziehen sich jedoch schnell zurück, sobald sie befürchten, zu sehr beansprucht zu werden. Innerlich ist der Kontakt zur Umwelt distanziert.
Allgemein erholen sich diese Personen relativ rasch. Durch ihr ausgeprägtes Pflichtbewusstsein wollen sie auch so schnell wie möglich wieder ihren täglichen Verpflichtungen nachkommen. Auch die Kommunikation mit dem Umfeld ist ihnen so wichtig, dass sie darüber ihre Erkrankung und ihre Schwierigkeiten, die sie letztendlich mit ihrem Umfeld haben, vergessen.
Sobald sie gesund sind, gehören sie wieder zur Gemeinschaft, werden beachtet, gebraucht und „geliebt“.
Bei Halsschmerzen ohne Anzeichen einer Infektion möchte der Betroffene „etwas nicht schlucken“. Dies ist ein Ausdruck der großen psychischen Anspannung, unter der derjenige gerade leidet.
Fazit
Wichtig ist, dass zunächst das aktuelle Problem dem Betroffenen bewusst wird. Dann kann an einer Lösung gearbeitet werden.
Dabei geht es zum einen darum, die Konfliktsituation zu klären, die akut die Erkrankung ausgelöst hat. Zum anderen sollte auf jeden Fall der zugrundeliegende Konflikt in der Persönlichkeitsstruktur besprochen werden. Vor allem beim wiederholten Auftreten der gleichen Beschwerden. Die Betroffenen müssen lernen, nein zu sagen.
Ob es denjenigen letztendlich gelingt, ihr Verhalten anzupassen oder nicht: Allein das Erkennen ist schon Hilfe zur Selbsthilfe.
Etwas Ruhe einkehren zu lassen in dem stressigen Alltag ist ganz wichtig. Dabei sollten für sie individuell angepasste Stressbewältigungsstrategien ausgearbeitet werden. Diese können die Betroffenen dann nach und nach in ihr tägliches Leben übernehmen.
Zusätzlich hilft die Einstellung: Nichts wichtiger nehmen als es tatsächlich ist.
Schnupfen
Sag mir, was plagt dich?
Wovon hast du die Nase voll?
Was willst du alles noch erdulden?
Für andere zu leben, das war dein Sinn.
Jetzt leidest du, um Abstand zu gewinnen.
Um Respekt und Ruhe bittest du.
Hoffentlich wird es dir bald gelingen.
Dann lässt die Nase dich in Ruh.
Volksmund
Jemanden nicht riechen können
Die Nase gründlich voll haben
Es gehört mal alles ausgeputzt
Jemanden gefällt diese Nase nicht
Es stinkt einem jetzt etwas gewaltig
Pathogenese
Eine Rhinitis ist ein oberflächiger Katarrh der Nasenschleimhaut. Die Nase geht zu und die Augen werden müde. Weitet sich die Infektion auf den Stirnhöhlenbereich oder die anderen Nasennebenhöhlen aus, wird dies als Sinusitis bezeichnet.
Die Erkrankung kann durch eine Infektion oder im Rahmen einer Allergie auftreten. Die Herkunft ist auf jeden Fall abzuklären, um in der Therapie den richtigen Behandlungsansatz zu finden.
Bei allergischer Rhinitis sind oft auch die Bindehäute in Mitleidenschaft gezogen.
Therapie
Dem Betroffenen ist hier in erster Linie mit naturheilkundlichen Mitteln geholfen, die seine Nase wieder zum Abschwellen bringen und den Schnupfen stoppen. Dazu gehören das Einatmen heilender Dämpfe oder auch biologische Nasensprays. Die Nase wird schnell wieder frei. Auch soll damit verhindert werden, dass sich diese Erkrankung in den Nasenneben- bzw. Stirnhöhlenbereich ausbreitet.
Eine weitere medikamentöse Unterstützung erfolgt aus dem Bereich der Homöopathie und Phytotherapie.
Bestrahlungen mit Farblicht, Unterstützung durch Phototherapiepflaster, Akupunkturinjektionen, Eigenbluttherapie sowie Injektions- oder Infusionstherapie gehören mit in dieses Spektrum.
Ergänzend und stärkend wirken Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente.
Psychodynamik
Auch diese Menschen sind empfindsam und empfindlich. Menschen mit ständigem und immer wiederkehrendem Schnupfen sind mit ihrer gegenwärtigen Situation unzufrieden. Sie haben buchstäblich die „Nase voll”.
Den Betroffenen fällt es schwer, etwas zu verändern. Sie nörgeln lieber rum.
Sie pochen gerne auf Rücksichtnahme.
Sie sind mit sich in einer ständigen Konfliktsituation. Dabei erwarten sie, dass sich die Umgebung verändert und nicht sie selbst.
Andere, vor allem ihre Partner, sollen sich ihren Erwartungen und ihren Vorstellungen anpassen.
Durch die Erkrankung verschafft sich derjenige die Ruhe und die Zeit, die er braucht, um dem Alltag wieder die „Stirn“ zu bieten und sich dem tagtäglichen Lebenskampf stellen zu können.
Stellen sie fest, dass ihre Umgebung nicht auf ihre Erwartungen reagiert, beginnen sie, wenn auch widerstrebend, mit einer Änderung ihrer Einstellung. Sie versuchen dann ihren Konflikt selbst zu lösen.
Fazit
Wovon hat der Betroffene gründlich die Nase voll? Das ist die vordergründige Frage, die es zu beantworten gilt. „Stinkt“ einem die Arbeit oder hat man von dem Familienleben die „Nase voll“. Da muss das Leben mal gründlich gereinigt und ausgeputzt werden.
Dazu muss sich der Betroffene jedoch verbalisieren und sich seiner Umgebung mitteilen. Nur aufgrund dessen ist eine Veränderung der Situation, die ihn so sehr stört, möglich.
Der Erkrankte sollte erkennen, dass, um zu gesunden und auch gesund zu bleiben, Körper, Seele und Geist in Einklang gebracht werden müssen.
Sie sollten lernen, die Personen in ihrem Umfeld so sein zu lassen, wie sie sind. Und nicht sie so verändern zu wollen, dass es ihren eigenen Vorstellungen entspricht.
Durch das bewusst machen und einer Umstellung seiner Verhaltensweise bekommt der Betroffene wieder eine freie Nase.
Fieber
Sag mir, was plagt dich?
Ständig und stetig das Fieber steigt
so stark wie dein Konflikt.
Du bist zu lösen ihn nicht bereit.
Willst dich nicht groß belasten.
Der Kopf weicht deinem Körper aus.
Jetzt musst du lösen das Problem.
Der Kampf wird ausgetragen.
Entscheide dich im Kopf, lass los.
Du kannst es ruhig wagen.
Volksmund
Sich einer Sache nicht mehr erwehren können
Etwas nicht mehr hören können/wollen
Auf sein Innerstes nicht mehr hören wollen
Sich gehörig den Mund verbrennen
Mit sich nicht einig sein
In einem ständigen Konflikt mit sich sein.
Pathogenese
Einer Erkältungskrankheit liegt meist eine Virusinfektion zugrunde. Jedoch macht uns erst ein – zumindest zeitweise – geschwächtes Abwehrsystem für die Erkältung angreifbar
• Kälte,
• Stress,
• Überbelastungen,
• Enttäuschungen,
• körperliche oder seelische Traumata,
• verminderte Durchblutung oder auch
• Fehl- bzw. ungesunde Ernährung
sind Ursachen für eine Schwächung des Abwehrsystems.
Eine Erkältungskrankheit zeigt sich oft mit akut auftretendem Fieber, Gliederschmerzen, Schnupfen, Entzündung der Atemwege und Ohren bzw. des Gehörganges, des Harntrakts, der Tonsillen oder auch einer schmerzhaften Muskelverspannung (Myalgie).
Therapie
Im Vordergrund steht für einen naturheilkundlich behandelnden Therapeuten zuerst einmal die medikamentöse Unterstützung aus dem Bereich der Homöopathie und Phytotherapie. Bäder (Balneotherapie), Wickel (Kneipp’sche Anwendungen), Dämpfe und Nasen- und Rachenspülungen. Je nach Stärke der Erkrankung auch Bettruhe, die unterstützend auf das Abwehrsystem wirkt.
Eigenblut-, Injektions- und Infusionstherapie sowie Phototherapiepflaster ergänzen das therapeutische Spektrum. Zusätzlich hilfreich ist auch eine Verabreichung von Enzymen, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
Zur Stärkung der Kondition und des Allgemeinbefindens sollte der Betreffende so oft wie möglich an die frische Luft gehen und Spaziergänge machen, die sich immer weiter ausdehnen.
Vorbeugend kann, je nach Konstitution und Interesse, das Abwehrsystem durch Radfahren, Schwimmen, Fitness oder Wandern gestärkt werden.
Bei immer wiederkehrenden Erkältungskrankheiten sollten auf jeden Fall abwehrstärkende Maßnahmen getroffen werden, um dem ständigen auf und ab ein Ende zu bereiten. Mit einem stabileren Abwehrsystem ist auch die Person eher in der Lage, Ordnung in ihre seelischen Abläufe zu bringen.
Psychodynamik
Hier liegt immer ein akuter Konflikt mit sich selbst vor. Dieser wird auf geistiger Ebene nicht gelöst und verschafft sich durch die körperlichen Beschwerden Ausdruck. Durch den Infekt bekommt derjenige die Zeit, die er benötigt, um seinen Konflikt zu lösen oder aber auch zu verdrängen. Eine ständige Verdrängung hat jedoch im Laufe der Zeit chronische Krankheiten zur Folge.
Die Betroffenen sind mit sich unzufrieden wie die Dinge laufen. Oft können sie sich aus einer Situation nicht befreien. Dann streikt ihr Abwehrsystem und sie werden anfällig für Erkältungskrankheiten. Damit gönnen sie sich eine Verschnaufpause.
Bezeichnend ist der im Laufe der Persönlichkeitsentwicklung aufgebaute Schutz vor Impulsen, Gefühlen und Erfahrungen, die mit dem Bild von sich und der „realen“ Welt nicht übereinstimmen. Unbewusst baut sich im Laufe der Zeit eine Konfliktsituation auf.
Eine gewisse Weichheit und Nachgiebigkeit zeichnet die Betroffenen aus. Dies zeigt sich körperlich in einer allgemeinen Bindegewebsschwäche.
Sie sind sehr sensibel und können nicht nein sagen. Sie sind angepasst und versuchen, die gestellten Aufgaben und ihre Verpflichtungen zu erfüllen.
Man kann sie auch als „Steh-auf-Männchen“ bezeichnen. Haben sie die Erkrankung überwunden, sind sie voller Optimismus. Sie lassen sich nicht so schnell unter kriegen.
Sie sind gegenüber ihrer Umwelt zeitweise etwas depressiv. Vor allem, wenn die Erkrankung länger dauert, fallen sie von einem Loch ins andere.
Sie vermeiden Konfliktsituationen mit ihrer Umwelt. Dies drückt sich in seiner extremsten Form als Neigung zum Intrigieren aus.
Sie haben die Vorstellung, dass sich der Partner im Laufe der Zeit ihnen anpassen sollte. Wenn dies nicht geschieht, reagieren sie mit wiederholten Erkältungskrankheiten. Damit ziehen sie dann die Aufmerksamkeit und Zuwendung des Partners auf sich.
Durch ihre nette und zuvorkommende Art ist der Partner gewillt, auf ihre Vorstellungen einzugehen. Dauerhaft funktioniert dies in der Partnerschaft jedoch nicht. Durch die Enttäuschung kommt es erneut zu einem Konflikt mit nachfolgender Abwehrschwäche.
Fazit
Eine intensive seelische Betreuung ist während der Erkrankung und Rekonvaleszenz besonders sinnvoll. In den begleitenden Gesprächen sollte der Therapeut mit dem Betroffenen zusammen herausfinden, worin sein Konflikt besteht. Was lässt er nicht los, damit er wieder frei atmen kann? Was will oder kann er nicht mehr schlucken? Wovon hat er die Nase voll hat? Was „stinkt“ ihm usw.
Durch geschickte Fragen kann sehr schnell herausgefunden werden, wo der „Schuh“ drückt. Welcher Situation weicht der Betroffene aus? Mit was will er sich nicht beschäftigen?
Die Zeit ist für ihn reif, sich mit seinen Konflikten auseinander zu setzen.
Oftmals liegt eine falsche Vorstellung von den Verhaltensweisen in seinem Umfeld zugrunde. Geht der Betroffene sein Problem an, stellt er überrascht fest, dass die Reaktionen anders sind als gedacht.
Der Betroffene sollte in der Zeit seiner Erkrankung erkennen, dass er Körper, Seele und Geist in Einklang bringen sollte um zu gesunden und gesund zu bleiben. Er muss sich seine Verhaltensmuster bewusst machen. Dies bedeutet mit dem Herzen denken zu lernen, sich körperlich zu bewegen und eventuell auch Veränderungen in seinen persönlichen Beziehungen vorzunehmen.
Zeigt sich ein grundsätzlicher Konflikt, sollte derjenige sein zugrunde liegendes Verhaltensmuster verändern. Da dies sehr vielfältige Probleme und Verhaltensweisen sein können, ist eine fachliche Unterstützung hilfreich.
Übereinstimmendes Denken, Handeln und Fühlen sollten für denjenigen im Vordergrund stehen. Er muss eins mit sich selbst werden. Dazu sollte er aufhören, auf Kosten anderer zu leben und nicht mehr andere auf seine Kosten leben zu lassen. Der Betroffene sollte sich darüber im Klaren sein, dass jeder Mensch ein Individuum ist und dass niemand verändert werden kann. Nur er selbst kann sich verändern. Jeder Mensch hat den Anspruch darauf, sich zu leben und nicht die Erwartungen anderer. Jetzt beginnt er sein Leben zu leben.
Atmung
Sag mir, was plagt dich?
Was ist mit deiner Atmung los?
Atmest tief ein und wieder aus.
Hältst ihn fest, lässt ihn nicht los.
Hast große Mühe und auch Not.
Kannst deine Lungen nicht mehr weiten.
Lass alles los, sonst ist’s dein Tod,
um wieder frei und tief zu atmen.
Volksmund
Es ist ganz schön dicke Luft
Jemandem bleibt die Luft weg
Einen langen Atem haben
Nicht mehr atmen können
Jemandem etwas husten
Pathogenese
Bei Atemwegsinfektionen können die Bronchien und die Lunge betroffen sein. Jedoch auch Allergien verursachen akute Atemwegsprobleme. Dies muss selbstverständlich vor Beginn der Therapie abgeklärt werden.
Bei einem normalen Verlauf hört ein Lungen- bzw. Bronchialinfekt noch 2-4 Wochen auf. Bei allergischen Reaktionen kann er länger andauern oder in einen chronischen Verlauf übergehen. Es ist darauf zu achten, dass sich nach Abklingen der Erkrankung die Atemfunktion normalisiert. Ansonsten kann eine bronchial-asthmatische Erkrankung entstehen.
Durch die den Infekt begleitende Kurzatmigkeit können Konzentrationsstörungen, Energieverlust und bei langanhaltenden Beschwerden Herz-Kreislauferkrankungen die Folge sein.
Raucher können in der Regel nicht auf eine vollständige Ausheilung hoffen. Es kommt zu wiederholten Infekten. Häufig werden dabei die Abstände im Laufe der Zeit immer kürzer. Im Endeffekt entwickelt sich eine chronische Lungenerkrankung oder im schlimmsten Fall sogar Krebserkrankung.
Therapie
In der Naturheilkunde finden sich viele Therapiemöglichkeiten und -ansätze. Im Vordergrund steht hier eine Stärkung des Allgemeinbefindens durch Mineralien, Spurenelemente, Enzyme, Aminosäuren, Vitamine.
Durch Infusionstherapien, Eigenbluttherapie, Homöosiniatrie (eine Kombinationstherapie von Akupunktur, Neuraltherapie und Homöopathie), Akupunktur, Lichttherapie und mit Phototherapiepflaster kann eine Regulierung und Stärkung des Stoffwechsels erreicht und dadurch das Allgemeinbefinden zusätzlich unterstützt werden.
Ganz wichtig – wie so häufig – ist der Aufbau einer gesunden Darmflora durch eine probiotische Therapie.
Dazu gehört eine umfassende Ernährungsumstellung bzw. - verbesserung.
Gerade der Asthmatiker ist angehalten, sich durch Aufenthalte an der frischen Luft, ausgedehnte Spaziergänge, Atemübungen, Fitness, Radfahren oder andere Ausdauer-Sportarten fit zu halten. Dadurch wird seine Kondition aufgebaut und sein Allgemeinbefinden verbessert.
Bei einer Blütenpollenallergie als Ursache ist es ratsam, in der problematischen Zeit den Kontakt mit der Natur zu vermeiden. In dieser Phase wäre eher eine meditative Betätigung sinnvoll.
Psychodynamik
Bei Rauchern spielt eine starke Verunsicherung eine große Rolle. Diese Persönlichkeiten haben Angst, loszulassen. Sie brauchen etwas, an dem sie sich festhalten können. Der Saug-Effekt erinnert sie unbewusst an ihre frühere Kindheit. Das gibt ihnen Vertrauen und Sicherheit. Es ist ein kindliches Urbedürfnis, das bei ihnen noch vorhanden ist.
Da die Bronchien oder Lungen paarig angeordnete Organe sind, spricht die Erkrankung für einen Konflikt in einer Partnerschaft. Partnerschaft ist nicht nur auf einen Ehepartner oder Lebenspartner beschränkt. Das sind alle engeren Beziehungen, die wir mit unserem Umfeld eingehen.
Wenn die Atembeschwerden ausgeheilt sind, hat sich die Konfliktsituation gelöst. Dies kann bewusst oder unbewusst geschehen sein. Das Loslassen, besonders auch von partnerschaftlichen Problemen, macht eine Genesung möglich.
Um welchen Konflikt es sich im Einzelnen handelt, muss mit den Betroffenen herausgefunden werden. Es kann sich dabei um ganz unterschiedliche Problemstellungen handeln. Sie haben jedoch alle mit dem Problem „Loslassen“ zu tun. Loslassen von Verstorbenen, bei Trennungen, einer bestimmten Situation usw. Diese können bekannt oder nur unterschwellig vorhandenen sein.
Während der Erkrankung ist die Vitalität auf ein Mindestmaß geschrumpft. Das ist die Folge des Sauerstoffmangels und der Atemnot. Je nach Stärke und Intensität der Erkrankung kann es sehr lange dauern, bis die alte Vitalität und Leistungsfähigkeit wieder hergestellt ist. Danach können diejenigen wieder tief Luft holen und durchatmen. Sie können ihre Umwelt wieder an sich herankommen lassen.
Fazit
Menschen, die an Atemstörungen leiden, können etwas nicht loslassen. Das kann der Tod eines geliebten Menschen sein, der Verlust von Organen oder Organteilen als Folge einer Operation und vieles andere.
Es ist eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Zustand notwendig. Dieser sollte akzeptiert werden, damit derjenige nicht ständig mit seinem Schicksal hadert.
Bei einem überraschenden Tod eines geliebten Menschen, ist dies unbedingt notwendig. Der Abschied muss ganz bewusst erfolgen. Dazu empfiehlt sich ein Abschiedsschreiben. In diesem teilt man dem geliebten Menschen mit, dass man nicht verstanden hat, dass er so schnell ging und ohne darauf vorbereitet zu sein.
Man erinnert sich an die schönen Zeiten und dankt ihm dafür. Auch verzeiht man die Situationen, die nicht so gut waren. Dann verabschiedet man sich, indem wir ihm alles Gute auf seiner Reise wünschen. Dadurch können sich die Wege trennen. Denn jeder hat sein Schicksal und muss es leben. Dieses Schreiben dann verbrennen und die Asche dem Wind mitgeben.
Eine intensive seelische Betreuung ist in dieser Zeit besonders notwendig.
Für sich selbst ist es ganz wichtig zu sagen:
Verzeihe dir, dass du dir nicht verzeihen konntest.
„Lass los, dann bist du frei“.
Raucher müssen wirklich bereit sein, mit dem Rauchen aufzuhören. Das ist eine notwendige Voraussetzung für jedes weitere Vorgehen. Hat sich der Raucher dazu entschlossen, können alle weiteren Schritte erst effektiv angegangen werden.
Bei Rauchern müssen zum einen die tief verborgenen Verunsicherungen herausgearbeitet werden. Da diese häufig in und durch die Kindheit entstanden sind, ist dies eine sowohl für den Behandler als auch den Betroffenen anspruchsvolle Aufgabe. Es kommt zu einem Reifungsprozess, der es den ehemaligen Rauchern ermöglicht, ihr Urbedürfnis nach Vertrauen und Sicherheit auf anderen Wegen zu erhalten.
Zum anderen spielen bei Rauchern viele Gewohnheiten eine große Rolle. Sie rauchen zu bestimmten Tätigkeiten oder speziellen Gelegenheiten. Dafür sollten Ersatzhandlungen gefunden werden, die dann das Rauchen überflüssig machen.