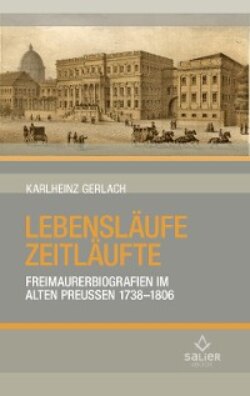Читать книгу Lebensläufe Zeitläufte - Karlheinz Gerlach - Страница 10
D
ОглавлениеDacke, Friedrich Adolf (18.3.1742 Harburg [heute Stadtteil von Hamburg]/Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg-1793 Berlin), luth., V Adolf Dacke, ∞ N. N., die Witwe Dacke führte nach dem Tod ihres Mannes das Hotel.
Friedrich Adolf Dacke war der Wirt des Hotels Zur Stadt Paris in der Altköllner Brüderstraße (39), das nach → Friedrich Nicolai „besonders wegen der Größe und der guten innern Einrichtung, Reinlichkeit und Ordnung zu den vorzüglichsten Wirtshäusern in Deutschland“ gehörte (Beschreibung der königlichen Residenzstädte Berlin und Potsdam, 120, 965f.). Das Hotel war ein wichtiger Ort der Berliner Freimaurer. Dort gründeten mit sentement de la Cour, welche sie nachgesucht und erhalten hatten, → Étienne Jordan, → Philippe Simon, der in Paris aufgenommene Juwelier Jean Serre, → Christian Gregory und Paul Bénézet am 13.9.1740 die Loge Aux trois Globes (Zu den drei Weltkugeln). Das Hotel gehörte ab 1739 Kapitän de Montgobert.
Paul Bénézet, Kaufmann in Berlin, Gründer der Loge Aux trois Globes, 9.11.1740 Mitglied, 1740/1741/1744-1747/1749/1751-1757 2. Vorsteher
Über Urbain du Moutier de Montgobert ist sehr wenig bekannt. Wir kennen weder die Lebensdaten, noch die Herkunft, noch die Lebensumstände, etwa in welcher Armee er gedient hatte. Die Loge Aux trois Globes nahm ihn auf Vorschlag Gregorys am Gründungstag als Freimaurer im I. und II. Grad an, nahm ihn am 9.11.1740 als Mitglied auf, beförderte ihn am 30.11.1740 zum Meister, lehnte aber am 11.2.1743 seine Annahme zum Schottenmeister ab, wählte ihn am 23.2.1741 und erneut am 20.4.1742 und 5.5.1742 zum 2. Vorsteher. Er reiste im April 1742 nach Sachsen, worüber nichts weiter bekannt ist, ebenso wenig darüber, warum er 1750 abwesend war. Moutier de Montgobert war im folgenden Jahr wieder in Berlin, als ihn die altschottische Loge L'Union am 13.9.1751 im IV. Grad aufnahm. Die Loge nannte ihn letztmals am 2.11.1758. Er war noch 1760 Besitzer des Hôtels de Montgobert, als der russische General Gottlob Kurt Graf v. Tottleben während der Besetzung Berlins vom 9. bis 13. Oktober 1760 bei ihm logierte.
Wann Dacke oder vielleicht sein Vater vermutlich von Moutier de Montgobert das Hotel erwarben, ist nicht ermittelt. Wir hören von Friedrich Adolf Dacke erstmals im Jahre 1779. Am 1.11.1779 nahm die Loge Zum Pilgrim (GLL) den 37-jährigen Gastwirt auf, beförderte ihn am 12.7.1780 zum Gesellen und am 28.10.1782 zum Meister. Sie nannte ihn letztmals 1789. Die Große Landesloge schloß am 21.4.1780 mit Dacke einen von allen Logenmeistern und Aufsehern unterschriebenen sechsjährigen Mietvertrag. Danach mietete sie zu einer Jahresmiete von 200 Rtl den Saal in der oberen Etage des Gasthauses sowie zwei geräumige, ständig verschlossene Kammern in der mittleren Etage, um dort die Logensachen aufzubewahren. Man hielt zweimal in der Woche, am Montag und an einem anderen Tag, Loge, was dem Wirt acht Tage vorher gemeldet werden sollte. Dieser lieferte zu den Tafellogen gute Gerichte zu je 7 Groschen. Übelstände behob Dacke schnell. Vermutlich quartierte er einen Mieter um, der neben dem Logenzimmer wohnte, da zu befürchten war, daß er manches hörte und sah, was verborgen bleiben sollte. Auch störte manchmal der laute Hof die Zusammenkünfte. So übertönte einmal der Arbeitslärm eines Faßbinders eine Festrede. Die Große Landesloge arbeitete bis 1791, bis zum Kauf des Logenhauses Oranienburger Straße 10 (später 27), bei Dacke.
Dames, Georg Friedrich (23.1.1753 Stolp/Hinterpommern-25.4.1837 Frankfurt/Oder), luth., V David Dames, Kämmerer in Stolp, ∞ 1780 die Tochter des Kaufmanns Kaspar Heinrich Döllen.
Georg Friedrich Dames besuchte das Akademische Gymnasium in Stettin, studierte Jura 1771 in Halle und 1773 in Frankfurt (Oder) und begann seine berufliche Laufbahn 1774 als Regierungssekretär mit Sitz und Stimme am fürstlichen Gerichtshof in Carolath/Schlesien. Er ließ sich 1778 in Frankfurt als Advokat an Magistrat und Stadtgericht nieder, wo ihn am 1.7.1779 die 1776 gegründete Loge Zum aufrichtigen Herzen (GNML3W) aufnahm. Sie beförderte ihn am 17.11.1779 zum Gesellen, 1780 zum Meister und 1781 zum schottischen Meister und wählte ihn am 24.6.1781 zum Sekretär, am 5.5.1787 zum 2. Vorsteher, am 14.11.1789 zum 1. Vorsteher und 1804 zum deputierten Meister. Dames avancierte zum Justizkommissar und Notar (1782) und Stadtsyndikus (1791) sowie zum Mitglied des Magistrats mit der Justizoberaufsicht über das Bankkontor. Er war 1805 einer der Mitgründer der Industrieschule. Die Stadt wählte ihn nach der Städtereform 1809 zum Stadtrat, Syndikus und städtischen Kassenrendanten. Er besaß das Brauhaus Richtstraße 49 (1945 zerstört). Dames war bis 1801 Vormund Heinrich v. Kleists und wurde 1807 zum Verwalter des Kleistschen Hauses bestellt.
Darbès (Darbes), Josef Friedrich August (29.9.1747 Hamburg-26.6.1810 Berlin), V Johan Francesco Darbès (um 1705 Italien-1768), Opernkomponist, Theaterdichter in Hamburg, Hofviolinist der kgl. Kapelle in Kopenhagen, M Charlotte Christiane Amalie geb. Kayser (um 1715-1802, V Johann Kayser, Stadtmusiker in Hamburg, M Margarethe Susanne geb. Vogel [1690 Hamburg-1774? Stockholm, V Johann Heinrich Vogel, Opernsänger in Hamburg], Sopranistin, berühmte Opernsängerin, unter Georg Philipp Telemann an der Gänsemarkt-Oper in Hamburg engagiert, Direktorin, zuletzt kgl. Hofsängerin), ∞ Anne Marie Montendre († 1818),
Bruder:
Johan Anton Peter Paul Darbès (1750-1815), Violinist, Komponist, Mitglied der kgl. Kapelle in Kopenhagen, Generalkriegskommissar.
Josef Darbès besuchte 1759 die Akademische Zeichenschule in Kopenhagen, setzte seine Ausbildung in St. Petersburg bei dem dänischen Maler Vigilius Eriksen (1722 Kopenhagen-1782 Rungstedgárd), 1757-1772 kaiserlicher Hofmaler Katharinas II., fort, unternahm Studienreisen nach Deutschland, Holland, Frankreich und Polen, kehrte 1773 nach St. Petersburg zurück, wo er Katharina II. (1774), ihren Sohn Paul I. und Leonhard Euler porträtierte. Er hielt sich bis 1785 im Herzogtum Kurland auf, wo ihn die Schwestern Dorothea Herzogin von Kurland (1761-1821), Ehefrau des kurländischen Herzogs Peter von Biron, und Elisa v. d. Recke (Charlotta Elisabeth Konstantine v. d. Recke, 1754-1833), die er porträtierte, förderten. Darbés wurde in St. Petersburg von einer Loge strikter Observanz aufgenommen. Am 23.12.1782 affiliierte ihn die Revaler Loge Isis (Isida) und beförderte ihn am 10.2.1783 zum Meister. Er war 1784 Mitglied der Strikten Observanz-Loge Zum Schwert in Riga (VII. Provinz Kapitel Riga) und Ritter des Ordens mit dem Ordensnamen Josephus Eques a stella erratica. (Wistinghausen: Freimaurer und Aufklärung, III, 86f.) Auf seinem Rückweg nach Deutschland nahm Johann Joachim Christoph Bode (1731-1793) ihn im Juli 1785 in Weimar als Novize (erste Stufe) in den Illuminatenorden auf. Darbès kam 1785 nach Berlin, wo er im folgenden Jahr eine Professur der Porträtmalerei mit dem Prädikat Hofrat antrat. Die Akademie der Künste wählte ihn im selben Jahr zum Mitglied. Er traf in Berlin sicher Elisa v. d. Recke bei → Friedrich Nicolai in der Brüderstraße (Gedenktafel) wieder, der 1787 ihr Aufsehen erregendes Buch Nachricht von des berüchtigten Cagliostro Aufenthalt in Mitau, im Jahre 1779, und von dessen dortigen magischen Operationen verlegte. Daniel Chodowiecki beeinflußte Darbès nachhaltig (in der Pastelltechnik, im Miniaturzeichnen mit Silberstift) und förderte ihn. Darbès zeigte 1786 in der ersten Akademieausstellung acht Porträts. Er porträtierte Friedrich Wilhelm II. und bis 1789 weitere Mitglieder der Königsfamilie, bereits im Sommer 1781 in Karlsbad Johann Wolfgang v. Goethe, Miriam und Daniel Itzig (um 1787), die Schauspielerin und Sängerin Friederike Unzelmann-Bethmann, Ehefrau des Schauspielers Bethmann.
Heinrich Eduard Bethmann (1774 Rosenthal/Hochstift Hildesheim-8.4.1857 Halle/Saale an Typhus), ∞ Berlin 1805 Friederike Unzelmann geb. Flittner (1760 Gotha-1815 Berlin, ∞ 1. 1786 den Schauspieler und Sänger Karl Wilhelm Ferdinand Unzelmann [1753-1832, 1803 geschieden]), debütierte 18-jährig 1792 in der Bossannschen Gesellschaft in Kreuznach (Friedrich Wilhelm Bossann [1756 Berlin-1813 Dessau], später Theaterdirektor in Dessau), 1794-1815 als Charakterdarsteller am kgl. Nationaltheater in Berlin engagiert, 27.4.1801 Berlin affiliiert von der Loge Urania zur Unsterblichkeit (RY), bis 1809 Mitglied, 1824-1826 Regisseur am Königstädtischen Theater in Berlin, 1826 Aachen, danach Dessau, Leipzig und Magdeburg, starb verarmt 1857 in Halle.
Karl August Varnhagen v. Ense schrieb über Darbès, er sei "ein nicht ungeschickter Portraitmahler, vorzüglich aber als heitrer und kundiger Lebemann geschätzt und gesucht, war in der Berliner Gesellschaftswelt sehr ausgebreitet; seine Kunst, sein unterhaltender Humor, seine gewandte Sprechfertigkeit, und besonders auch die Freimaurerei, welche er von Grund aus zu kennen und mit Eifer zu treiben im Rufe stand, gaben ihm in den vornehmsten wie in den mittlern Kreisen leichten Zutritt und ein gewisses Ansehn“ (Varnhagen v. Ense: Denkwürdigkeiten, 290f.). Darbès besuchte in Berlin erstmals am 8.4.1790 als Visiteur die Loge Royale York de l'Amitié, befreundete sich mit → Ignaz Aurelius Feßler, der ihn später in die Mittwochsgesellschaft (1797-1800) und in die Gesellschaft der Freunde der Humanität (1800 Ehrenmitglied) einführte. Die Loge Royale York de l'Amitié nahm ihn am 29.4.1794 auf und wählte ihn 1795/96 im VII. Grad zum Architecte du Temple. Er entwarf 1796 die Pläne für einen Verbindungsbau zwischen dem Kamekschen Landhaus und der Orangerie, dem Tempel, mit einem großen Fest- und Speisesaal für 180 Personen, den die Loge am 17.6.1797 einweihte. Sie wählte ihn am 9.6.1796 mit 29 zu 28 Stimmen zum deputierten Meister. Die Altschottische Mutter-Loge Royale York zur Freundschaft erwählte ihn 1797 zum 1. Großvorsteher (bis 1799), der Innerste Orient 1800 zum 1. Oberaufseher und das 1. Kollegium der Großen Loge von Preußen genannt Royal York zur Freundschaft 1802/03 zum vorsitzenden Meister. Er wurde nach der Logenreform der Filia Urania zur Unsterblichkeit zugeordnet, die ihn 1800 zum 1. Zensor und Präparateur wählte, die er indes bereits 1802 deckte (30.8.1802 Entlassungsgesuch).
Darjes, Joachim Georg (23.6.1714 Güstrow/Herzogtum Mecklenburg-Schwerin-17.7.1791 Frankfurt/Oder, Grabdenkmal von → Johann Gottfried Schadow im Gertraudenpark, 1796), V Joachim Darjes, Prediger zu St. Marien in Güstrow, M Elisabeth Darjes († 1714 im Kindbett), ∞ Jena? 1751 Martha Friederica Reichardt (12.3.1739-29.8.1794, sie erhielt nach dem Tod ihres Mannes eine jährliche kgl. Pension [verwandt mit Christian Reichardt, mit dem Darjes das 1754 in Erfurt gedruckte Buch Von vieljähriger Nutzung der Aecker ohne Brache und wiederholte Düngung: woher zugleich eine Anweisung die Korn- und Hülsenfrüchte, nebst deren Hanfe, Flachse und einigen Klee-Gewächsen zu erbauen, gegeben, veröffentlichte]?).
Joachim Georg Darjes besuchte in Güstrow das Gymnasium, studierte 1728 in Rostock Theologie und Philosophie und 1731 Philosophie, Mathematik und Kirchengeschichte in Jena, wo ihn der Universalgelehrte Jakob Carpov (1699-1768), Schüler des rationalistischen Philosophen Christian Wolff, nachhaltig beeinflußte. Er war zwei Jahre Prediger in Güstrow, erwarb 1735 in Jena den theologischen Magistertitel und unterrichtete anschließend als Privatdozent Philosophie und Mathematik. Er zog sich mit einer ohne sein Wissen 1737 in Jena veröffentlichten Schrift über die Hypothese, ob es möglich sei, die Dreieinigkeit philosophisch zu erklären (De pluratitate personarum Deitate ex solis rationis principiis demonstrata), den Vorwurf des Atheismus zu. Darjes studierte nun ab 1737 in Jena Jura, wonach die Universität ihn 1738 zum Adjunkt der philosophischen Fakultät ernannte und 1739 zum Dr. jur. promovierte. Herzog Ernst August I. von Sachsen-Weimar-Eisenach (1688-1748), der ihn förderte, berief Darjes 1744 zum ordentlichen Professor der Moral und Politik an die Universität Jena mit dem Titel herzoglich sachsen-weimarischer Hofrat. Er entwickelte eine erfolgreiche Lehrtätigkeit und führte als Erster das Fach Kameralistik in den Universitätsunterricht ein. Vermutlich nahm ihn 1744 die von Studenten im selben Jahr gegründete Loge Zu den drei Rosen, eine Deputation der Loge Zu den drei Degen in Halle, auf. Das erste sichere Datum ist der 8.10.1745, als er in Erfurt mit Zustimmung der Berliner Schottenloge L'Union den IV. (Schotten-)Grad erteilt erhielt. Die Loge Zu den drei Rosen wählte ihn spätestens 1761 zum Meister vom Stuhl (bis 1764). Darjes errichtete 1761, mitten im Siebenjährigen Krieg, in Camsdorf bei Jena eine von seiner Loge unterstützte Schule, die Rosenschule, erste Realschule in Thüringen nach denen in Berlin und Halle. Die zwischen Pietismus und Philanthropie stehende Schule nahm verwahrloste Bettelkinder auf, die sie zu erwerbstüchtigen, nützlichen Menschen bilden wollte. Sie ging nach seinem Weggang und der Schließung der Loge 1765 ein. Friedrich II. berief Darjes 1763 an die Viadrina, die reformierte kgl. Universität in Frankfurt an der Oder. Er führte die Kameralwissenschaften ein, war 1772 ihr Rektor, außerdem Ordinar der Juristenfakultät. Die Universität verlieh ihm 1786 zum 50-jährigen Lehrjubiläum eine von dem Berliner Medailleur Abraham Abramson gestaltete Goldmedaille. Darjes und Karl Gottlieb Svarez (1746-1798), der bei ihm Jura studierte, gründeten 1766 die Gelehrte Gesellschaft zum Nutzen der Künste und Wissenschaften (1. Sitzung 24.1.1767), deren Vorsitz Darjes übernahm. Er habe, schrieb der Frankfurter Professor für Philosophie und Geschichte Karl Renatus Hausen (1740-1805), 1776 an der Gründung der Loge Zum aufrichtigen Herzen mitgewirkt, wurde aber nicht ihr Mitglied, besuchte sie dennoch (Visiteur, besuchender Bruder), hielt anläßlich der Aufnahme des Studenten → Johann Friedrich Zöllner am 7.6.1777 in der Loge einen Vortrag, auch überreichte der Br. Darjes in der folgenden Lehrlingsloge durch den Br. Redner sein Ius naturae für die Logenbibliothek. In Frankfurt ist die Darjesstraße nach ihm benannt.
Daum, Friedrich Karl Maria (28.10.1727 Berlin-14.3.1787 Berlin, bestattet Hedwigskirche in Berlin), luth.,1746 in Hamburg mit dem Vornamen Maria katholisch konvertiert, Gv Gottfried Christian Daum († 2.5.1720), iuris practicus in Großenhain, Gm Barbara Elisabeth geb. Uschner (V Andreas Uschner, Bürgermeister in Großenhain),
Vater:
Gottfried Adolf Daum (18.6.1679 Amt Großenhain [Hayn/Kursachsen]-7.2.1743 Potsdam), Großunternehmer, Bankier, Handelshaus Daum & Splitgerber (David Splitgerber [1683-1764], stiller Teilhaber), 1722 Pacht der Kgl. Gewehrfabrik Potsdam-Spandau und 1725 des Hochofens Zehdenick für die Produktion von Kanonenkugeln, 1740 betrug sein Geschäftsanteil 650 000 Rtl, was etwa einem Drittel des preußischen Staatsschatzes entsprach, den Friedrich Wilhelm I. seinem Sohn hinterließ, ∞ 1. 1713 Johanna Susanna Engeling († 1713), T Christiane Charlotte Daum (* 1714) ∞ Friedrich Gotthold Köppen (S → Karl Friedrich Köppen), ∞ 2. 1727 Carolina Maria Ohloff (aus Magdeburg, V Apotheker), T Caroline Marie Elisabeth Daum (27.7.1730-10.3.1810, Grab in Zernikow, heute Ortsteil von Großwoltersdorf/Naturpark Stechlin-Ruppiner Land) ∞ 1. Potsdam 1753 → Michael Gabriel Fredersdorff, 2. 20.12.1758 Rittmeister v. Aschersleben (Ehe geschieden), 3. Hans (Johann, Johannes) Freiherr v. Labes (1731-27.7.1776, Grab in Zernikow; Titel in Preußen 1786 anerkannt), T Amalie Caroline v. Labes (1761-1781, Grab in Zernikow) ∞ → Joachim Erdmann Freiherr v. Arnim (1741-1804), starb im Kindbett nach der Geburt ihres Sohnes, des Romantikers Achim [Karl Joachim Friedrich Ludwig] v. Arnim [1781-1831]), S Hans (Johann) v. Labes-Schlitz (1763-1831, Herr auf Karstorf) ∞ 1794 Louise Gräfin v. Schlitz (1774-1832), deren V Johann Eustach Graf Görtz v. Schlitz (1737-1821), Erzieher der herzoglichen Prinzen von Sachsen-Weimar-Eisenach und preußischer Diplomat, ihn adoptierte, daher Labes-Schlitz.
M Carolina Maria geb. Ohloff, ∞ 1. 1750 Maria Theresia Tassi (aus Hannover, † 1756), 2. 1757 Ludmilla (Maria Luise?) v. Rava verw. v. Carcani (aus Breslau, † 1776), 3. 1777 Maria Barbara v. Rava (aus Polnisch-Gandau?, † 19.5.1823 im Benediktinerinnenkloster Striegau/Schlesien, dessen letzte Äbtissin ihre Schwester war),
Söhne:
Adolf Daum (13.5.1751-23.5.1817), Privatmann in Berlin und Danzig
Friedrich Franz Daum (5.6.1777-22.1.1801), betrieb nach dem Studium der Naturwissenschaften Botanik und Astronomie
Über die Kindheit und Jugend von Friedrich Karl Daum ist nichts bekannt. Er hatte keinen direkten Anteil an dem Handelshaus Splitgerber & Daum. Friedrich II. erteilte dem 26-Jährigen am 13.8.1753 eine 15-jährige Konzession zur Barchentmanufaktur mit Monopol im Altstädtischen Rathaus in Brandenburg (Havel), die er mit eigenem Kapital und dem seiner Schwester Caroline Maria Elisabeth Daum finanzierte. Er schied 1756 aus der Leitung der Manufaktur aus, die 1762 sein Schwager Gustav Wilhelm Köppen und der Brandenburger Kaufmann C. W. Wagner unter dem Namen Köppen & Wagner weiter betrieben (1807 aufgehoben?). Daum lebte nun von dem großen ererbten väterlichen Vermögen ganz seinen Neigungen. Er wohnte mit Frau und Söhnen winters in seinem Altköllner Haus Breite Straße 15 (in dem er Räume an die Kasse der Witwenverpflegungsanstalt vermietete) und sommers auf seinem Gut Lietzow bei Charlottenburg, Grüne Carls-Ruhe genannt. Er besaß eine Bibliothek mit 4000 Bänden aller Wissensgebiete (die 1811 versteigert wurde), bedeutende Kunstsammlungen (Porträt seines Vaters von Antoine Pesne, Stiche, Zeichnungen, Porzellan, Keramik, Waffen, Münzen) und botanische Sammlungen. Eine seine Liebhabereien galt den Bienen. Daum publizierte im Periodikum der 1766 gegründeten Oberlausitzer Bienengesellschaft ein Verzeichniß dererjenigen Blumen und Blüthen, so die Bienen am vorzüglichsten lieben (1768/69) sowie den Aufsatz Seltsame Nachricht von einem versteinerten Bienenstocke oder Neste, welchen Herr Lippi, der Arzneykunst Licentiat bey der Facultät in Paris, auf den Gebirgen Siout in Oberegypten entdeckt hat (1770). Wann und wo Daum Freimaurer wurde, ist nicht ermittelt. Er war bereits ein Freimaurer höherer Grade und offenbar hoch angesehen, als die Mutterloge zu den drei Weltkugeln, deren Mitglied er im selben Jahr geworden war, ihn 24.6.1762 zum 1. Großvorsteher des Maurerischen Tribunals, einer Schiedsstelle der Berliner Logen zur Beilegung ihrer Streitigkeiten, wählte. Daum hielt am selben Tag auf dem Johannisfest die Festansprache Über Stärke, Weisheit, Schönheit, die Grundlagen des Bundes, müssen im Charakter der Brr. zum Ausdruck gelangen; die von → Georg Jakob Decker gedruckte Rede ist nicht überliefert. Am 5.10.1765 nahm ihn die Hauptloge der Afrikanischen Bauherren auf als Zeichen der Verbrüderung mit den Vereinigten Logen strikter Observanz (Mutterloge zu den drei Weltkugeln, Zur Eintracht, Zum flammenden Stern), blieb aber Mitglied der Mutterloge zu den drei Weltkugeln. Die Afrikaner wählten ihn 1766 zum Großmeister. Er trat am 15.10.1768 von dem Amt zurück. Mit dem Niedergang der Afrikanischen Bauherren endete seine aktive Zeit als Freimaurer. Er hatte gehofft, daß es ihm gelingen würde, "alles in Ordnung zu bringen und unseren Logen den Ruhm zu verschaffen, Vorbilder wahrer und vollkommener Maurer zu sein. Aber ach, ich sehe mich getäuscht. Jeder Bruder tut, was ihm gut scheint, jeder will befehlen und Regeln aufstellen, ohne selbst zu wissen, was Maurerei ist.“ Daum war einer der Mitgründer der St. Hedwigs-Kirche in Berlin, die Ignacy Graf Krasicki (1735-1801), Fürstbischof von Ermland und später Primas von Polen, ein aufgeklärter Schriftsteller, am 1.11.1773 weihte. Krasicki hatte 1772 Friedrich II. kennengelernt, der ihn an seinen Hof und zu seiner Tafelrunde in Sanssouci einlud. Er hielt in Heilsberg, seinem ermländischen Bischofssitz, seine schützende Hand über die Loge Äskulap, die sein Leibarzt? Watzel gegründet hatte (GLL, 10.11.1780 Stiftungsurkunde).
Andreas Ludwig Christian Watzel († 11.1.1791 Heilsberg), Arzt in Heilsberg, Kreisphysikus des Ermlandes, vermutlich Leibarzt des Bischofs, a. 1773 in Königsberg von der Loge Zum Totenkopf (GLL), 1775 Mitglied der Königsberger Schwesterloge Phönix, 1777/78 Sekretär, 1778 10.9.1779 Logenmeister, gründete 1780 in Heilsberg die Loge Äskulap
Daum machte 1786, ein Jahr vor seinem Tod, sein Testament. Er gab einen Teil seines Vermögens in ein beständiges Familien-Fideikommiß (zwei Güter in Lietzow bei Charlottenburg, das Haus Breite Straße in Berlin, wertvolle Sammlungen; Majorat wurde 1805 und 1813 in Geldkapital umgewandelt).
Decker I, der Vater, der Ältere, Georg Jakob (12.2.1732 Basel/Schweiz-17.11.1799 Berlin), ref., entstammte einer Basler Drucker- und Verlegerfamilie, V Johann Heinrich Decker (vor 1710-1754), Rats- und Universitätsbuchdrucker in Basel, M Anna Katharina geb. Respinger (1706-1780, V Nik. Respinger [1677-1737], Kaufmann in Basel, M Anna Katharina geb. Silbernagel), ∞ 1755 Dorothea Luise Grynaeus (2.8.1734-23.11.1784, V Jean [Johann] Grynaeus [1685-1749], akademischer Oberhofbuchdrucker, M Katharina Louise geb. Caravacini [1705-1763], übernahm nach dem Tod ihres Mannes die Geschäftsführung der Offizin), von den zehn Kindern überlebten sechs das Kindesalter:
→ Georg Jakob Decker II
Katharina Dorothea Decker (* 1756) ∞ 29.10.1780 Christian Sigismund Spener (28.10.1753-30.10.1813), Buchdrucker
Luise Elisabeth Decker (1764-1832) ∞ 28.10.1781 → Friedrich Philipp Rosenstiel, deren Tochter Karoline Henriette Rosenstiel (1784-1832) ∞ 1817 → Johann Gottfried Schadow
Katharina Maria Susanna Decker (* 28.11.1767) ∞ 19.11.1788 Heinrich August Rottmann (1755 Bülzig/Herzogtum Württemberg-1837 Basel), im Geschäft Deckers tätig, 3.6.1788 Buchhändlerprivileg, 1791 Verlagsbuchhändler in Berlin, verlegte 1791 Wilhelm August Iffland Figaro in Deutschland. Lustspiel in fünf Aufzügen; 1791 → Sigismund Friedrich Hermbstädt Systematischer Grundriß der allgemeinen Experimentalchemie, zum Gebrauch seiner Vorlesungen (3 Teile)
Johanna Henrietta Decker (28.8.1768-1852) ∞ 19.11.1788 den Baseler Schrift- und Stempelschneider Wilhelm Haas (15.1.1766 Basel-22.5.1838 Basel), Besitzer einer Schriftgießerei und eines Verlags
Georg Jakob Decker besuchte das Gymnasium in Basel, begann 14-jährig eine Lehre bei dem Berner Buchdrucker (Emanuel?) Hortin, arbeitete anschließend in der Offizin seiner Großmutter Dorothea Decker geb. Wild (1671 Basel-1754), die nach dem Tod ihres Mannes Johann Heinrich Decker (1705-1754), Rats- und Universitätsdrucker in Basel, dessen Druckerei im elsässischen Colmar fortführte, studierte anderthalb Jahre an der Universität Straßburg, wo er bei seinem Onkel Johann Daniel Schöpflin (1694-1771), Professor für Geschichte und Rhetorik (1770/71 Universitätslehrer Johann Wolfgang Goethes), wohnte. Er ging 1750 auf die Walz über Mainz, Frankfurt am Main, Leipzig und Zeitz, kam Ostern 1751 nach Berlin. Er arbeitete bei dem Hofbuchdrucker Christian Friedrich Henning (verlegte Karl Philipp Emanuel Bach: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, 1753; fertigte den Satz von Voltaires Siècle de Louis XIV), dann bei dem Buchdrucker Christian Ludwig Kunst, schließlich in der Akademischen Buchdruckerei (in der Wallstraße, 1762 fünf Pressen) des Oberhofbuchdruckers Jean Grynaeus, dessen Tochter Dorothea Louise Grynaeus er 1755 heiratete. Seine Schwiegermutter, die verwitwete Katharina Louisa Grynaeus, nahm ihn 1756 als Teilhaber in die Buchdruckerei (Grynaeus & Decker) auf, in deren alleinigen Besitz er nach ihrem Tod 1763 kam. Decker erwarb 1757 das Berliner Bürgerrecht sowie die Mitgliedschaft in der französischen Kolonie. Er verband Energie und berufliches Können mit Weltgewandtheit und politischem Gespür. Sein Aufstieg begann im Siebenjährigen Krieg 1758 mit zwei Flugschriften gegen die Gegner Preußens ([Johann Heinrich Gottlob]? Justi: Rechnung ohne Wirth, oder das eroberte Sachsen, Rentmeister Grüne: Ernsthaftes und vertrauliches Bauerngespräch, in brandenburgischem Niederdeutsch, mit großen Erfolg, 12 Fortsetzungen, druckte 15 000 Exemplare). Friedrich II. erteilte Decker wichtige Aufträge und verlieh ihm bedeutende Auszeichnungen: 1) 1763 die Direktion der typographischen Anstalt (Druckerei) für das kgl. Lotto, deren fünf Pressen im Gartensaal des Finckensteinschen Palais in der Wilhelmstraße standen; Faktor war sein Schwager Simon Kaspar Reinhard Grynaeus († 23.8.1781); 2) den Titel kgl. Hofbuchdrucker, dessen Rechte nach dem Tod des Hofbuchdruckers Henning auf ihn übergingen, der Titel wurde 1769 in der Familie erblich; 3) den Druck aller kgl. Arbeiten; 4) 1769 den Nachdruck aller im Ausland erschienenen, durch kein Spezialprivileg geschützten französischen Bücher. Decker nahm 1769 Werke für eigene Rechnung in Verlag. Er besaß Niederlagen in Mannheim, Frankfurt am Main, Basel, Halle (Saale), wo er ab 1772 Formulare und Accidenzien druckte, Wittenberg, Potsdam (bei dem Buchdrucker Sommer). Zudem eröffnete er einen umfangreichen Buchhandel, besuchte Jahr für Jahr die Messen in Leipzig, wo er bei dem Verlagsbuchdrucker Bernhard Christoph Breitkopf (1695–1777) Quartier nahm. In seinem Unternehmen arbeiteten 1772 25 Setzer und Drucker, 1782 31 Setzer und Drucker, 1783 in Schriftgießerei und Druckerei 50 Arbeiter, 1788 47 Setzer und Drucker. Der Berliner Arzt und Enzyklopädist Johann Georg Krünitz (1728-1796) stand 1776-1784 als Korrektor in seinen Diensten. Friedrich Wilhelm II. verlieh 1787 ihm und → Christian Friedrich Voß (1724-1795) das kgl. Privileg zu Druck und Verlag der Werke Friedrichs II. (Œvres Posthumes de Frédéric II Roi de Prusse, 1788). Die Offizin mit zehn Pressen befand sich im Stadtschloß über dem Schloßportal. Herausgeber war → Johann Christoph v. Wöllner, Faktor → Johann Heinrich Wilhelm Dieterici. Bis 1789 erschienen 25 Bände der Œvres in großem Quartformat mit einer Auflage von 200 Exemplaren. Decker hatte schon früher Schriften Friedrichs II. verlegt, unter anderen Dialogue de morale à l'usage noblesse (1770), Essai sur les Formes de Gouvernement et sur les Devoirs des Souverains (1777) und De la littérature Allemande (1780). Seine Autoren waren Königin Elisabeth Christine, Ewald Friedrich v. Hertzberg, August Wilhelm Iffland, Johann Heinrich Jung (Jung-Stilling), → Anna Luisa Karsch, Friedrich Maximilian Klinger, Johann Kaspar Lavater, Johann Karl Wilhelm Möhsen, Johann Heinrich Pestalozzi. Er druckte musikalische Werke, so die von Karl Heinrich Graun. Daniel Chodowiecki lieferte zu vielen seiner Verlagstitel die Illustrationen. Zudem gab Decker mehrere Zeitungen und Zeitschriften heraus, ab 1762 Gazette françoise de Berlin (ab 1793 sein Sohn → Georg Jakob Decker), 1764-1790 die von → Joseph du Fresne de Francheville gegründete und redigierte Gazette littéraire de Berlin, deren Redaktion 1781-1790 → Claude Étienne Le Bauld de Nans hatte, Journal littéraire mit dem Hauptmitarbeiter → Frédéric Adolphe de Castillon, 1772-1807 Nouveaux mémoires, ab 1792 das Intelligenzblatt. Der Verlagskatalog 1792 verzeichnete 400 Titel. Decker kaufte am 1.4.1765 das dreigeschossige Haus im Zopfstil Brüderstraße 29. Er wohnte bis zu seinem Tod in der Mitteletage des Vorderhauses, während sich die Buchdruckerei im Seitenflügel und im Quergebäude und die Schriftgießerei (1767) im linken Hofflügel befanden, außerdem ab 1769 der Verlag und das Sortiment. Das schmiedeeiserne Geländer des Treppenhauses befindet sich heute im Märkischen Museum Berlin. Decker war gastfreundlich, betrieb keinen falschen Aufwand, litt aber auch keine kleinliche Sorge und Kümmerlichkeit, besaß viel Gefühl für Natur. Er gab oft kleine Konzerte mit Dilettanten und Virtuosen in seinem Haus. Er hatte einen großen Freundeskreis. Bei ihm verkehrten der Schriftsteller und Direktor des kgl. Nationaltheaters Johann Jakob Engel (1741-1802), eines der Häupter der Berliner Aufklärung, Johann Karl Wilhelm Möhsen (1722-1795), Leibarzt Friedrichs II. und Mitglied der Gesellschaft der Freunde der Aufklärung, der Astronom Johann Elert Bode (1747-1826), Direktor des Berliner Observatoriums, Johann Gottlieb Gleditsch (1714-1786), Professor für Anatomie und Botanik am Collegium medico-chirurgicum und Direktor des Botanischen Gartens, → Anna Luisa Karsch. Decker trat am 15.3.1762 in Berlin, während des Siebenjährigen Krieges, der französisch arbeitenden Loge De la Concorde bei, einer Gesellschaft mit starkem gewerblichem Anteil. Die Loge beförderte ihn innerhalb eines Dreivierteljahres bis zum IV. Grad: 15.3.1762 Lehrling, Geselle, 26.4.1762 Meister, 26.11.1762 Schottenmeister, Mitglied der altschottischen Loge L'Union. Die Johannisloge wählte ihn am 7.6.1762 mit 11 zu 3 Stimmen zum Sekretär, 1768 zum 1. Vorsteher (bis 1776) und 1778 zum deputierten Meister. Er machte wie die Mehrheit der Berliner Freimaurer 1764 den Systemwechsel von der englischen Maurerei zur tempelherrlichen Strikten Observanz mit, erhielt als Ordensbruder der Präfektur Templin der VII. Provinz am 17.5.1765 den Ritterschlag mit dem Ordensnamen Eques a plugula (VI. Grad); sein Wappen zeigt in blauem Schild einen zusammengerollten Bogen weißen Papiers mit der Inschrift Oculis errantibus lucem invenit. Er blieb indes für andere freimaurerische Ideen und Systeme offen und schloß sich 1768, gleichzeitig mit seiner Zugehörigkeit zur Loge Zur Eintracht, den Afrikanischen Bauherrenlogen an (bis 1771). Nach dem Niedergang der Strikten Observanz folgte er der Führung seiner Großloge in den Gold- und Rosenkreuzerorden, der ihn 1778 in den Berliner Zirkel Heliconus einordnete (Direktor → Johann Christoph Wöllner) mit dem Ordensnamen Gobii Gareus Keder Cocus. Wöllner erteilte ihm bis 1785 alle Grade bis zu dem VIII. des Meisters, der das große Werk, den Lapis philosophorum, den Stein der Weisen, bereitete, damit den höchsten in Preußen verliehenen Ordensgrad, und ernannte ihn zum Zirkelkassierer. Er charakterisierte seine Gemütsneigungen 1781 mit Großmut, Mitleiden, Gefühl für Religion u. Tugend. Decker erreichte 1785 den Höhepunkt seiner maurerischen Laufbahn mit der Wahl zum Meister vom Stuhl der hoch angesehenen Loge Zur Eintracht, der ältesten Berliner Tochter der Mutterloge zu den drei Weltkugeln. Er beklagte zuletzt die Uneinigkeiten und Unordnungen in der Großen National-Mutterloge, wodurch sein maurerischer Eifer merklich erkaltet sei, und legte am 9.12.1794 die Leitung der Eintracht enttäuscht nieder. Der 60-Jährige zog sich 1792 aus dem Geschäft zurück, das er seinem gleichnamigen Sohn übergab. Decker schrieb 1799 Erinnerungsblätter seines Lebens (bis 1763), die bisher nicht veröffentlicht sind.
Decker II, der Sohn, der Jüngere, Georg Jakob (9.11.1765 Berlin-26.8.1819), ref., V → Georg Jakob Decker, M Dorothea Luise geb. Grynaeus, ∞ 1792 Caroline Luise Elisabeth Eyssenhardt (1769-1815, V → Friedrich Wilhelm Eyssenhardt, Tuch- und Seidenhändler),
Söhne:
Karl Gustav Decker (1801-1829)
Rudolf Ludwig (1863 nobilitiert) v. Decker (1804-1877)
Georg Jakob Decker besuchte das Berlinische Gymnasium zum Grauen Kloster, durchlief eine Lehre in der väterlichen Offizin, arbeitete anschließend als Drucker in Stettin, wonach er eine Bildungsreise durch Deutschland (Leipzig, Weimar), die Schweiz (Basel, Zürich, Bern), Italien (Turin, Florenz, Rom, Mailand) und Frankreich (Straßburg, Paris) unternahm. Sein Vater schlug 1783 den 18-jährigen Sohn seiner Loge Zur Eintracht vor, die ihn als Lufton, als den noch nicht 25 Jahre alten Sohn eines angesehenen Freimaurers, am 9.3.1784 in den beiden ersten Graden aufnahm, ihn am 24.3.1784 zum Meister beförderte, 1790 zum 1. Steward wählte (bis 1801) und ihn auf Vorschlag → Martin Heinrich Klaproths am 22.11.1797 zum Schottenmeister beförderte. Die Johannisloge wählte ihn 1798 zum deputierten 2. Vorsteher (bis 1805), 1803 zum Zensor (bis 1806) und 1806 zum 2. Aufseher (bis 1809). Er wurde 1803 Mitglied der Großen National-Mutterloge. Auch gehörte er ab 1802 dem Musikalischen Kollegium an. Decker deckte im Dezember 1812 die Loge. Der Vater nahm den 23-Jährigen 1788 als Teilhaber in das Unternehmen G. J. Decker & Sohn auf, ab 1789 mit dem Geh. Oberhofbuchdrucker. Als sich der Vater 1792 aus dem Geschäft zurückzog, trat der Sohn in den vollen Besitz der Firma ein. Er verkaufte 1792 die Buchhandlung und den Verlag an seinen Schwager Heinrich August Rottmann und 1795 das Haus in der Brüderstraße an die Seidenfabrikanten Jean Paul Humbert (1766-1831) und → Jean François Labry, den Großvater Theodor Fontanes, die dort ihr Warenlager und Verkaufsräume einrichteten; Humbert zog nach dem Tode Deckers sen., der in der Beletage gewohnt hatte, 1799 mit seiner Familie in das Vorderhaus ein. Decker jun. behielt den Verlag der Werke Friedrichs II., der seit 1789 in seiner Hand lag, sowie die Druckerei, fügte ihr einen Papierhandel hinzu, baute die Schriftgießerei aus, führte neue Drucktechniken ein, so als erster in Berlin mit seinem Schwager Christian Sigismund Spener die von dem Briten Charles Stanhope um 1800 konstruierte Schnellpresse, 1815 die von Alois Senefelder (1771-1834) entwickelte Stereotypie. Er gründete am 1.1.1794 in Posen die Südpreußische Hofbuchdruckerei Decker & Cie. (4 Pressen), welche die Südpreußische Zeitung verlegte. Decker jun. kaufte 1794 von → Friedrich August Herzog von Braunschweig das Palais Wilhelmstraße 75, deren erste Etage, die Hälfte der Mansarden und den schönen Garten er am 1.10.1795 der Großen National-Mutterloge zu den drei Weltkugeln vermietete (das 1735 errichtete Palais beherbergte im 19. Jh. das preußische Auswärtige Amt, damit den Amtssitz Otto v. Bismarcks). Im Jahre 1809 übernahm er die Sommersche Hofbuchdruckerei des Hofbuchdruckers Michael Gottlieb Sommer in Potsdam. Decker druckte das Allgemeine Gesetzbuch für die Preußischen Staaten (1794, Allgemeines Landrecht), das Oktoberedikt (1807) und den Aufruf Friedrich Wilhelms III. An mein Volk (1813). Er übertrug schließlich 1818 die Deckersche Geheime Oberhofbuchdruckerei an seinen Sohn Rudolf Ludwig Decker. Sie kam 1877 als Kaiserlich Deutsche Reichsdruckerei in Staatsbesitz (heute Bundesdruckerei).
Delagarde, François-Théodore (1756 Königsberg/Pr.-1824), ref., aus Berliner Hugenottenfamilie (Kaufleute, Gärtner, Handwerker), V David de la Garde, Wardein der Münze in Königsberg, M (∞ 1752 Königsberg) Sophie geb. Bellon, ∞ 1783 Susanne Louise Gillet,
Tochter
Charlotte Delagarde ∞ den Pädagogen und Buchhändler H. August Köchly (1768-1821)
François-Théodore Delagarde absolvierte nach dem Besuch der Altstädtischen Schule in Königsberg eine Lehre in der Galanteriehandlung Binetti & Lorique, arbeitete zweieinhalb Jahre in Berlin in der Galanteriewarenhandlung De la Garde und drei Jahre in der französischen Buchhandlung von → Étienne de Bourdeaux. Er war befreundet mit den Buchhändlern → Johannes Friedrich Vieweg und Georg Joachim Göschen. Delagarde erwarb am 6.3.1783 das Privileg für den Handel mit französischen Büchern und Materien in allen Fakultäten, freien Künsten und Wissenschaften in Berlin. Die Loge Zu den drei Seraphim (GNML) nahm den 27-jährigen Buchhändler auf Vorschlag → Marschall v. Biebersteins (21.4.1785) nach vorteilhafter Ballotierung (10.5.1785) am 23.5.1785 auf, beförderte ihn am 5.9.1785 zum Gesellen, am 16.11.1789 zum Meister und wählte ihn am 22.9.1789 zum Zeremonienmeister (trat das Amt erst nach seiner Meisterbeförderung an, bis 1795); die Loge nannte ihn letztmals 1806/07. Delagarde nahm 1785 den ihm vermutlich von Königsberg her bekannten → Johann Daniel Friedrich als Juniorpartner der Verlagsbuchhandlung Lagarde & Friedrich in Berlin und Libau auf, führte aber ab 1791 die Berliner Handlung mit aufklärerischem Verlagsprogramm allein weiter. Er verlegte → Theodor Gottlieb v. Hippel (Pseudonym Quittenbaum), u. a. dessen Schrift Zimmermann I. und Friedrich II., Leonhard Euler (Differentialrechnung, 1790), Immanuel Kant (Kritik der Urteilskraft, 1790) und erweiterte das Verlagsprogramm nach Frankreichreisen 1796 und 1797/98 um mathematisch-naturwissenschaftliche und französische Literatur (Michel de Montaigne: Gedanken und Meinungen über allerlei Gegenstände,1793-1799). Er ließ den Großteil seiner Titel von Friedrich Unger drucken. Delagarde war während der französischen Besetzung Berlins 1806 Vorsteher des Comité administratife. Er übergab 1812 den Buchhandel an seinen Schwiegersohn und Faktor August Köchly.
Delagoanère (de La Goanère), Jean-Pierre (1726 Manciet/Guienne-1802 A Coruña/Spanien), kath.
Über Herkunft, Kindheit und Jugend Jean-Pierre Delagoanères ist nichts ermittelt. Das früheste sichere Datum ist der 24.6.1770, als die Berliner Loge Royale York de l'Amitié den 58-jährigen Direktor der Generalverwaltung der Steuern (Bureau General de contentieux à l’Administration Générale Droits du Roi) aufnahm. Die Loge beförderte ihn am 6.5.1771? zum Gesellen und Meister, wählte ihn am 3.6.1771 zum 2. und am 4.6.1773 zum 1. Aufseher, am 23.5.1781 mit 44 zu 2 Stimmen zum Meister vom Stuhl (bis 1783), 1783 und nach seiner Rückkehr nach Berlin erneut am 30.5.1794 (durch Akklamation, er besaß den VII. Grad) zum 1. Großmeister der Altschottischen Mutter-Loge Royale York zur Freundschaft (bis 5.10.1798). Friedrich II. ernannte Delagoanère am 6.7.1784 zum Akzisedirektor in Emmerich im preußischen Herzogtum Kleve. Ob er Mitglied der vermutlich 1788 dort gegründeten, wohl bald wieder eingegangenen Loge wurde, wissen wir nicht; die Logenakten verbrannten 1853. Sicher ist indes, daß er sich 1793 an den Beratungen über die Konstituierung der Loge Pax inimica malis beteiligte, welcher die Großloge der sieben vereinigten Provinzen der Niederlande in Den Haag am 22.10.1793 das Konstitutionspatent erteilte. Die deutsch, aber meist holländisch arbeitende Loge mit den Farben Schwarz und Weiß, denen Brandenburgs, bezog ihren Namen auf den Niedergang der Stadt im Siebenjährigen Krieg und den neue Hoffnung weckenden Hubertusburger Frieden und übersetzte ihn mit „Der Frieden ist dem Bösen verhaßt“. Nach dem Edikt wegen der geheimen Verbindungen vom 20. Oktober 1798, das Logen ausländischer Konstitution in Preußen verbot, wollte Delagoanère, der nach Berlin zurückgekehrt war, auf Bitten der Loge sich bei dem Nationalgroßmeister → Friedrich August von Braunschweig-Oels um eine preußische Konstitution bemühen. Die Loge Pax inimica malis erhielt am 28.12.1798 ein Konstitutionspatent der Großen Loge von Preußen genannt Royal York zur Freundschaft, der Loge Delagoanères. Friedrich Wilhelm III. ernannte Delagoanère 1798 zum Konsul in der nordwestspanischen Hafenstadt A Coruña, wonach die Berliner Filiale Zur siegenden Wahrheit ihn 1798-1802 als abwesendes Mitglied führte. Die Große Loge von Preußen gedachte am 6.2.1803 Jean Pierre Delagoanères in einer Trauerloge.
Denis, Jean-Baptiste (um 1720 Lyon-nach 1797 Florenz), ∞ Neapel August 1748 die Tänzerin Giovanna (Marie-Anne) Cortini, genannt la Pantaloncina (um 1728 Venedig-nach 1797, V Pantalon Andree Cortini), debütierte als Sechsjährige, 1741-1749 Neapel, 1749-1754 1. Tänzerin des kgl. Balletts in Berlin, nach Trennung von Denis 1754-1757 in Brüssel 1. Tänzerin am Theatre de la Monnaie, sie ∞ 2. am 19.1.1760 den Schauspieler Jean-François Lejeune, 1760 im Ballett am Theatre-Italien in Paris.
Jean-Baptiste Denis war 1739 Tänzer der Académie Royale de Musique in Paris, trat um 1747 in Neapel auf, wo er Giovanna Cortini heiratete. Friedrich II. engagierte 1749 das Ehepaar an das kgl. Ballett in Berlin. Jean-Baptiste Denis und Giovanna Cortini-Denis debütierten am 26.4.1749 in Berlin in der französischen Komödie Arlequin devenan par hazard Chataignier. Denis, auch Choreograph und Komponist, war von 1749 bis zu seiner Pensionierung 1765/66 Ballettmeister. Wo und wann er Freimaurer wurde, ist nicht ermittelt. Er besuchte erstmals am 25.5.1750 die Berliner Loge Aux trois Globes als Visiteur. Am 25.5.1750 schlug → Christian Konrad Hundertmarck ihn zum Mitglied vor, was die Loge einstimmig akzeptierte. Die Meister wählten ihn am 5.10.1750 mit 4 zu 2 und erneut am 17.12.1750 zum 2. Vorsteher und am 3.1.1751 zum interimistischen 1. Vorsteher. Denis dimittierte am 7.8.1752 aus freien Stücken. Die Mutterloge zu den drei Weltkugeln reaffiliierte ihn am 14.7.1755. Sie nannte ihn letztmals am 8.8.1757 als Mitglied.
Deutecom, Johann Konrad Anton Friedrich v. (1742 Unna/Grafschaft Mark-nach 1804), V Johann Heinrich Friedrich v. Deutecom (um 1710 Unna-1761/1767), Hofgerichtsrat am klevischen Hofgericht, Landrichter in Unna, M Anna Elisabeth geb. Luckemey († 1767),
Bruder:
Karl Heinrich Friedrich v. Deutecom (Juli 1744 Unna-1792), ∞ vermutlich Auguste Henriette Nettelbladt (V→ Daniel Nettelbladt), studierte ab Mai 1764 in Halle Jura, 1765 Fähnrich im Infanterieregiment Nr. 3 Prinz von Anhalt-Bernburg in Halle, (1779) Premierleutnant, (1791) Kapitän, II. 24.6.1779 in Halle in der Loge Zu den drei Degen, III. 1783, 1789-1792 2. Vorsteher, 27.4.1792 Trauerloge
Schwester:
Luise Caecilia Friederica v. Deutecom (* 1748) ∞ um 1767
Karl Dietrich Wilhelm v. Sudthausen (* 1739 Hamm?), V Dietrich Gerhard Friedrich Sud(t)hausen (1704 Kamen/Grafschaft Mark-vor 1778), preußischer Offizier, (1773) Kriegs- und Domänenrat der Mindener Kammer, 1791 Kriegs- und Domänenrat der Kammerdeputation Hamm, a. in Hamburg als Freimaurer, 17.8.1791 in Hamm Mitstifter (im III. Grad) der Loge Zum hellen Licht. 2. Vorsteher, Johannis 1798 1. Vorsteher, deckte 1799 wegen seiner schwächlichen Umstände, 1808 Ehrenmitglied
Brüder:
→ Franz Heinrich August v. Sudthausen (* 1733)
→ Johann Gottfried Friedrich v. Sudthausen (* 1745)
Schwägerin:
Friederike Louise Elisabeth v. Sudthausen geb.v. Winterfeld
Johann Konrad Friedrich v. Deutecom studierte Jura wegen des Siebenjährigen Krieges zunächst in Leiden und 1761-1763 in Halle, wo ihn am 24.1.1763 die Loge Philadelphia zu den drei goldenen Armen aufnahm und bis zum IV. Grad beförderte. Er begann seine berufliche Laufbahn 1763 als Referendar am Kammergericht in Berlin, wurde im selben Jahr als Regierungsreferendar nach Kleve versetzt und war 1765 Referendar am Landgericht Unna. Er wechselte 1772 ins Kameralfach, legte 1775 das große Examen ab, blieb in Berlin, wo er 1777 an der Oberrechenkammer als Assessor angesetzt wurde. Er kehrte 1779 nach Westfalen als Assessor der Kriegs- und Domänenkammer Minden zurück, wo er am 18.9.1780 die Loge Wittekind zur westfälischen Pforte mit gründete, die ihn zum designierten 1. Vorsteher, am 5.5.1781, dem Tag der Installierung der Loge, zum wirklichen 1. Vorsteher (bis 1792) und nach dem Tode des Gründers → Franz Traugott Friedrich Wilhelm Freiherr v. Breitenbauch 1796 zu dessen Nachfolger als Meister vom Stuhl (bis 1802) wählte. Er führte zudem 1801-1803 als Obermeister die Delegierte altschottische Loge. Er deckte 1804 die Loge. Deutecom hatte 1781 vergeblich um ein Ratsamt in Minden gebeten, wurde dann aber 1785, der wohl bis dahin vom eigenen Vermögen gelebt hatte, als Kriegs- und Domänenrat in Minden bestallt. Er verschuldete sich, erkrankte schwer, nahm nach der Genesung seinen Dienst wieder auf, ohne je zu gesunden, wurde März 1799 wegen Krankheit und zerrütteter Vermögensverhältnisse verabschiedet (400 Rtl Pension), seine Wiedereinstellung abgelehnt.
Deutsch, Christian Friedrich (1829 nobilitiert) v. (28.9.1768 Frankfurt/Oder-17.4.1843 Dresden), V Melchior Friedrich Deutsch (1733 Frankfurt/Oder-1776), Diakon an St. Nikolai in Frankfurt, M Henriette geb. Winterfeld (V Johann Christian Winterfeld, Regierungs- und Konsistorialrat in Magdeburg), ∞ 1. Halle 1793 Christiane Sophie Friederike Juliane Franziska Goldhagen († 1812), 2. Dorpat 1818 Christine v. Sivers († 1835).
Die Familie zog nach dem frühen Tod des Vaters nach Halle. Christian Friedrich Deutsch studierte dort nach dem Schulbesuch zunächst Theologie, dann Medizin in Göttingen, Halle und Erlangen und promovierte 1792 in Halle zum Dr. med. et chir. Nach seiner Aufnahme durch die Erlanger Loge Libanon zu den drei Zedern trat er in Halle am 5.3.1790 der Loge Zu den drei Degen (28.10.1787 GNML3W) bei, die ihn am 21.3.1791 zum Meister beförderte und 1791 und 1793 zum Zeremonienmeister wählte. Deutsch lehrte ab 1796 als außerordentlicher Professor Entbindungskunde an der Universität in Erlangen, wo er zudem eine eigene Praxis eröffnete. Er erhielt im Sommer 1805 einen Ruf an die 1692 von König Gustav II. Adolf von Schweden gegründete und 1802 wiedereröffnete nunmehrige Kaiserliche Universität Dorpat (heute Tartu/Estland), an der er als ordentlicher Professur Entbindungskunde und Weiber- und Kinderkrankheiten lehrte (bis 1834). Die Universität wählte ihn 1806, 1810, 1813 und 1820 zum Dekan und 1808-1809 zum Rektor der medizinischen Fakultät. Er wurde 1812 zum Kollegienrat und 1822 zum Staatsrat ernannt und 1829 mit dem Orden des Heiligen Andreas 2. Klasse (damit verbunden der Adelstitel) ausgezeichnet. Deutsch kehrte nach dem Tod seiner Frau nach Deutschland zurück und starb als Witwer in Dresden.
Diederichs, Heinrich Christian (4.5.1752 Pyrmont/Fürstentum Waldeck-28.8.1791 Herford/preußische Grafschaft Ravensberg), luth., V Leopold Christian Diederichs, Brunnenkommissar der Dominalverwaltung Pyrmont, M Anne Sophie Elisabeth geb. Schultze aus Neersen, ∞ Herford 1774 Henriette Philippine Charlotte Rischmüller (1757 Herford-nach 1817, V Ernst Philipp Rischmüller [1732-1777], 1763-1772 1. Bürgermeister in Herford, M Helena Arnoldina geb. Hoffbauer [V Kaufmann in Bielefeld]),
die Witwe Henriette Philippine Charlotte Diederichs ∞ 2. Herford 1794
Heinrich Ludwig Conrad (* 1743/44? Memel), luth., Postmeister in Herford, a. 10.4.1787 Magdeburg 43-jährig von der Loge Ferdinand zur Glückseligkeit, 1803/1804 im Meistergrad Mitglied der Loge Wittekind zur westfälischen Pforte in Minden.
Brüder:
→ Karl Anton Diederichs
Christoph Leopold (Januar 1816 nobilitiert) v. Diederichs (28.10.1772 Pyrmont-11.11.1839 Charlottenburg [heute zu Berlin]), ∞ 1798? Charlotte Bormann (1778?-28.4.1838 Charlottenburg), studierte ab Oktober 1789 in Göttingen Jura, 1792 Auskultator bei der Regierung in Minden-Ravensberg, 1793 Referendar, 1795 Assessor cum voto in Minden, 1795 Rat, bis 1806 bei der Regierung in Posen, 1808 Regierungsrat in Marienwerder, später Geh. Oberjustizrat, Justizminister?, in Berlin Mitglied der Loge Zu den drei Seraphim, Bearbeiter der Bundesstatuten der Großen National-Mutterloge zu den drei Weltkugeln.
Heinrich Christian Diederichs studierte 1768-1771 in Göttingen Jura, zudem Geschichte, begann seine berufliche Laufbahn 1771 als Referendar der Kriegs- und Domänenkammer Minden, erhielt zudem 1773/74 das Amt des Justitiars im Herzogtum Minden und avancierte 1774 zum Steuerrat (Consul dirigens) in Herford und zum Direktor des Serviswesens. Er diente während des Bayerischen Erbfolgekrieges in der preußischen Armee als Bataillonsauditeur und kehrte 1780 in den Zivildienst zurück, nunmehr Stadtdirektor in Herford. Er gab 1782 das Pyrmonter Brunnen-Archiv heraus (bei → Christian Ludwig Stahlbaum: Berlin 1782). Die am 31.5.1776 gestiftete Strikte Observanz-Loge Friedrich zu den drei Quellen in Pyrmont nahm ihn, vermutlich nach dem Bayerischen Erbfolgekrieg, auf und beförderte ihn zum Meister. Er war am 19.9.1780 in Minden Mitgründer der Loge Wittekind zur westfälischen Pforte, die ihn am 5.5.1781 zum Redner und Hospitalier (25.6.1783-1785) und 1789 zum deputierten Meister wählte. Diederichs beendete seine berufliche Laufbahn in der Stadtverwaltung von Herford, 1784 als 2. und 1785 als 1. Bürgermeister.
Diederichs, Karl Anton v. (1817 nobilitiert) (22.10.1762 Pyrmont/Fürstentum Waldeck -25.11.1827 Herford/preußische Provinz Westfalen), luth., V Leopold Christian Diederichs, Brunnenkommissar der Dominalverwaltung Pyrmont, M Anne Sophie Elisabeth geb. Schultze aus Neersen, ∞ Herford 1786 Lucia Charlotte Sophia Menze (1769 Herford-nach 1827, V Johann Christian Menze, Bürgermeister, M Sophia Charlotte geb. Retemeyer),
Brüder:
→ Christoph Leopold v. Diederichs
→ Heinrich Christian Diederichs
Karl Anton Diederichs besuchte das Herforder Friedrich-Gymnasium, studierte Jura in Göttingen und Halle, begann 1784 seine berufliche Laufbahn als Referendar der Kriegs- und Domänenkammer Minden und avancierte zum Kriegs- und Steuerrat. Er war wie sein Bruder Heinrich Christian Mitglied der Loge Wittekind zur westfälischen Pforte in Minden: 1783 Geselle, 1785 Meister, 12.8.1804 Schottenmeister, zuletzt 1810 genannt. Diederichs gehörte ab 1785 bis zu seinem Tod dem Magistrat von Herford an, zunächst vom 1.11.1785-1792 als 2. Bürgermeister und 1792 bis 1827 als Nachfolger seines verstorbenen Bruders Heinrich Christian ununterbrochen als 1. Bürgermeister. Als Herford an das Königreich Westfalen fiel, übernahm er mehrere öffentliche Ämter, war 1808-1811 Mitglied des Departement-Wahlkollegiums des Weser-Departements, 1808-1813 des Distriktrats des Distrikts Herford, 1808-1811 des Departementrats des Weser-Departements, vom 2.6.1808-26.10.1813 der Reichsstände des Königreichs für die Gruppe der Grundeigentümer.
Diedrich, Johann Christian (* 1774 Magdeburg), luth., V Schiffer in Magdeburg.
Johann Christian Diedrich besuchte die Handlungsschule in Magdeburg, wonach er eine Handlungs- und Schifffahrtslehre bei seinem Vater absolvierte. Er etablierte sich 1800 als Großschiffer, wurde Mitglied der Schifferbrüderschaft (1801) und erwarb das Bürgerrecht. Er besaß 1808 mit 240 000 FF das größte Vermögen eines Magdeburger Schiffers. Die Loge Ferdinand zur Glückseligkeit nahm ihn am 12.3.1802 auf und beförderte ihn im selben Jahr zum Gesellen; er gehörte ihr bis 1809 an. Diedrich war am 1.10.1783 einer der Gründer der Harmonie, einer Gesellschaft Magdeburger Kaufleute und Honoratioren in der Petristraße zur Beförderung des geselligen Vergnügens, besonders durch Unterhaltung, Lecture, Spiele, Concerte und Bälle. Sozietäre waren außer ihm weitere Freimaurer, so der Seidenmanufacturier → Georg Friedrich Sulzer, der Getreidegroßhändler → Karl Heinrich Kayser, der Organist → Johann Andreas Seebach, der die Konzerte der Harmonie leitete. Diedrich beteiligte sich 1794 mit zwei Aktien zu je 50 Rtl an der Finanzierung des Schauspielhauses, des unter der Direktion von → Karl Konrad Kasimir Döbbelin stehenden Magdeburger Nationaltheaters.
Diericke, Christoph Friedrich Otto v. (11.9.1743 Potsdam-17.4.1819 Neu-Schöneberg [heute zum Stadtbezirk Tempelhof-Schöneberg von Berlin]), luth., V Kaspar Christoph v. Diericke (1706-1757 Breslau, an der Verwundung in der Schlacht bei Leuthen), Oberstleutnant im Regiment Garde, M Rosine geb. Burgenroth (1718 Potsdam-1780 Königsberg/Pr.), ∞ 1780 Antoinette Henriette Sophie Charlotte v. Quoos (1759-1797, V Otto Heinrich v. Quoos, Amtshauptmann).
Friedrich Otto v. Diericke wurde 1758 in das Kadettenkorps in Berlin aufgenommen, zog 1760 als Gefreiterkorporal des Königsberger Infanterieregiments Nr. 2 in den Siebenjährigen Krieg, geriet 1760 kurzzeitig in russische Gefangenschaft, nahm am 3.11.1760 an der Schlacht bei Torgau, im Dezember 1760 an der Verteidigung von Kolberg und im August 1762 an der Belagerung von Schweidnitz teil. Diericke hörte, nunmehr Sekondeleutnant (1764), in der Garnison Königsberg an der Universität Vorlesungen. Er avancierte 1770 zum Premierleutnant, 1773 zum Stabskapitän und 1777 zum Kapitän und Kompaniechef, als der er 1778/79 am Bayerischen Erbfolgekrieg teilnahm. Die Königsberger Strikte Observanz-Loge Zu den drei Kronen nahm ihn am 29.11.1774 auf, wählte ihn 1776 zum Redner (bis 1791), am 1.10.1779 in die Interimsadministration (zuständig für die Johannisloge), berief ihn am 21.2.1780 in die Administration des Hauses zu den drei Kronen und übertrug ihm am 3.3.1789 als Bibliothekar (bis 1791) die Verwaltung der Logenbibliothek, deren Bibliotheksordnung er 1789 entwarf. Der Königsberger Zirkel Ferreus des Gold- und Rosenkreuzerorden (Direktor → Friedrich Leopold Freiherr v. Schroetter) weihte ihn 1781 mit dem Ordensnamen Kirioton de Cetu ein, beförderte ihn 1783 auf den I. und 1786 auf den II. Grad und übertrug ihm das Amt eines Actuarius. Schroetter charakterisierte ihn als sanft, gottesfürchtig, bescheiden, mit Eifer für Literatur und Schöne Wissenschaften, sei ohne Vermögen, lebe vom Dienst, habe viele Kinder (acht). Major v. Diericke (1785) wurde 1790 in das ostpreußische Infanterieregiment Nr. 14 (Regimentschef 1794 → Johann Karl Leopold v. Larisch) versetzt, das in Bartenstein, Friedland und Schippenbeil garnisonierte. Die Versetzung beendete seine aktive Freimaurerschaft; seine Loge nannte ihn letztmals 1802. Diericke wurde 1793 zum Oberstleutnant und Regimentskommandeur und 1794 zum Oberst befördert, nahm 1794/95 an dem Feldzug in Polen gegen den Kościuszko-Aufstand teil, wurde mit dem Orden Pour le mérite für die Gefangennahme eines polnischen Regiments, wobei er verwundet wurde, ausgezeichnet, erhielt 1799 das Infanterieregiment Nr. 16 (Garnisonen in Braunsberg, Mühlhausen, Preußisch Holland), avancierte 1800 zum Generalmajor und Präses der Obermilitärexaminationskommission in Berlin, führte im IV. Koalitionskrieg 1806-1807 eine Division und wurde schließlich 1810 zum Oberdirektor der Kriegsschulen ernannt. Der gebildete, kenntnisreiche Offizier schrieb das Trauerspiel Eduard Montrose (1774), Gedichte (Fragmente eines alten freimütigen Offiziers über die Veredelung der Soldaten [1798], darin seine Logenrede vom 24.6.1787), die Abhandlung Ein Wort über den Preußischen Adel, weder Schutz- noch Lobschrift, sondern freimüthiges Wort eines wahrheitliebenden Mannes (bei → Wilhelm Dieterici: Berlin 1817).
Dieterici, Johann Heinrich Wilhelm (18.3.1758 Berlin-16.9.1837 Berlin?), ∞ Eva Sophie Haacke verw. Liebenow (1766-1828),
Sohn:
Karl Friedrich Wilhelm Dieterici (1790 Berlin-1859 Berlin) studierte in Königsberg und Berlin Jura und Geschichte, 1813 Ingenieur-Geograf im Hauptquartier → Blüchers, 1834 Professor für Staatswissenschaften an der Berliner Universität, 1844 Direktor des Kgl. Preußischen Statistischen Büros, 1847 Ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin
Tochter:
Henriette Dieterici ∞ 1817 den Buchdrucker Ernst Siegfried Mittler (1785 Halle/Saale-1870 Berlin), an den der Verlag überging
Georg Jakob Decker stellte Wilhelm Dieterici nach der Buchdruckerlehre in Magdeburg 1787 als Faktor ein und übertrug ihm die Oberleitung der Werkausgabe Friedrichs II. Dieterici erwarb am 3.3.1789 das Privileg für den Buchdruck in Berlin (Druckerei, Verlagsbuchhandlung) und errichtete im selben Jahr eine eigene Druckerei. Im Jahre 1816 übernahm sein künftiger Schwiegersohn Ernst Siegfried Mittler, der 1814 aus Leipzig nach Berlin gekommen war, die Firma. Friedrich Wilhelm III. übertrug Mittler das Privileg zu Druck und Verlag der Rangliste für die preußische Armee (militärisches Jahrbuch). Der Verlag entwickelte sich zu einem Fachverlag militärischer Literatur. Die Berliner Loge Zum goldenen Pflug (GLL) nahm Dieterici am 14.10.1803 auf, beförderte ihn am 25.2.1804 zum Gesellen und spätestens 1805 zum Meister. Er druckte ab 1804 den ersten Anhang zum Verzeichnis der Büchersammlung der Hochw. Gr. Landesloge von Deutschland zu Berlin, für den er 8 Rtl 8 g in Rechnung stellte. Die nächsten Anhänge erschienen 1805, 1806 und 1810; die Logenbibliothek besaß nunmehr 1231 Titel. Dieterici gehörte der Loge bis zu seinem Tode an, die ihn am 23.3.1838 in einer allgemeinen Trauerloge ehrte.
Dieu, Pierre (1.8.1721 Berlin-10.6.1792 Berlin), ref., V François Dieu (1682-1745 in Klein Ziethen auf dem Barnim/Mark Brandenburg), betrieb mit der hugenottischen Gemeinde (1686) Tabak- und Obstanbau, Tabakverkäufer, M Elisabeth Marie geb. Perrot (1707?-1754), ∞ 1749 Jeanne Elisabeth Dourguet (1720?-1785),
Töchter:
Henriette Marie Dieu (1759-1798) ∞ 1775 Paul Barandon (1742 Potsdam-25.3.1812 Berlin), ref., 1776 Akzise- und Zolldirektor in Fordon/Netzedistrikt, 1794 auf Vorschlag → Struensees Finanzrat und Regisseur im IV. Departement des Generaldirektoriums in Berlin
Friederike Elisabeth Dieu ∞
Antoine Joyard (1744 Berlin-7.11.1806 Berlin), kath., V Jean Baptiste Joyard, aus Lyon, Oberhaushofmeister Friedrichs II., Leibkoch (schon in Rheinsberg?), M Henriette Elisabeth geb. Pesne (V Antoine Pesne [1683 Paris-1757 Berlin], Hofmaler, um 1754 Bildnis des Malers mit seinen zwei Töchtern), 1767 Übersetzer (traducteur) der General-Akzise- und Zollverwaltung in Berlin, a. 24.6.1769 Berlin von der Loge Royale York de l'Amitié, trat 1772 im Gesellengrad aus der Loge aus, Oktober 1771 seinem Schwiegervater Dieu adjungiert, der ihn in den Dienst einführte, Dezember 1771 Generaldirektor von Zoll und Akzise in der Kurmark mit dem Titel Kriegsrat, die Loge Royale York de l'Amitié reaffiliierte ihn am 24.6.1781, letztmals am 25.6.1786 als Mitglied genannt, Dezember 1786 1. Direktor der Akzisedirektion in Brandenburg (Havel) mit dem Prädikat Kriegs- und Domänenrat, Januar 1789 1. Direktor in Küstrin mit dem Prädikat Geh. Kriegsrat, Februar 1791 auf eigenen Wunsch pensioniert, Pensionär in Berlin.
Sohn:
Paul Heinrich Joyard (* 29.7.1769 Berlin), Ökonom, a. 24.4.1895 Charlottenburg von der Loge Luise, II. 28.8.1805.
Am 29.3.1742 proponierten der Buchhändler → Frédéric Alexandre Fromery und → Ètienne Jordan dessen Diener Pierre Dieu, einen geschickten und zuverlässigen Mann, als frère servant. Da die Loge Aux trois Globes den Vorschlag nicht akzeptierte, wiederholte Fromery ihn am 31.5.1742, wonach die Loge ihn am 7.6.1742 als dienenden Bruder im Lehrlingsgrad rezipierte. Dieu erwarb das besondere Vertrauen der Loge, die ihn zum dienenden Bruder im IV. Grad der schottischen Loge Zum goldenen Löwen beförderte. Die Strikte Observanz schlug ihn zum Ritter mit dem Ordensnamen Eques a pluma rubra. Friedrich II. behielt den Diener seines 1745 verstorbenen Sekretärs Jordan im Auge, setzte ihn um 1746 als Kopist im Geh. Kabinettsministerium (Departement der auswärtigen Angelegenheiten) an, bewilligte 1748 sein Gesuch auf Einsetzung als Akziseinspektor und Assessor der Akzisekammer in Berlin, schrieb ihm 1753 zudem die Visitation über die Ein- und Ausfuhr von Seidenwaren in Berlin zu (Kommerziensekretär) und ernannte ihn schließlich zum 1. Direktor des Akzise- und Zollkorrespondenzbüros im kur- und neumärkischen Departement mit dem Prädikat Kriegsrat. Dieu trat am 19.9.1754 aus der Loge Zu den drei Weltkugeln aus, um die Loge De la Concorde (9.12.1754 Stiftungsurkunde als Loge La petit Concorde) mitzugründen. Der vorsitzende Meister der Mutterloge → Freiherr v. Bielfeld installierte die Loge am 4.1.1755 in dessen Haus hinter dem im Bau befindlichen Palais Prinz Heinrichs, setzte die Beamten ein und ernannte Dieu, nunmehr Vollmitglied, zum Trésorier. Die Loge wählte ihn am 17.6.1755 zum Sekretär. Er deckte am 4.6.1756 aus ungenannten Gründen die Loge, die ihn am 29.12.1760 reaffiliierte und 1761 zum Meister vom Stuhl wählte. Er lehnte am 7.6.1762 eine Wiederwahl wegen seiner Amts- und übrigen Geschäfte ab, trat am 30.1.1764 erneut aus der Loge aus, die ihn 1765 reaffiliierte und die er 1765-Anfang 1768 erneut als Meister vom Stuhl leitete.
Dittmar, Christoph Nathanael (30.10.1741 Berlin-21.8.1792 Berlin), luth., V Jakob Ditmar, Kantor an St. Nicolai in Berlin, M Katharina Sophia geb. Cälius, ∞ 1766 Fridericia Sophia Struve (* 1749, V Karl Dietloff Struve, Prediger in den uckermärkischen Dörfern Schönwerder und Bandelow),
Bruder:
→ Theodor Jakob Dittmar
Christoph Nathanael Dittmar besuchte 1749 das Berlinische Gymnasium zum Grauen Kloster, studierte 1762 in Halle Jura, begann 1765 seine berufliche Laufbahn als Advokat am Obergericht in Prenzlau und wurde 1775 als Advokat am Kammergericht nach Berlin versetzt. Die Berliner Loge Zur Eintracht (GNML3W) nahm Dittmar am 3.3.1778 auf, beförderte ihn am 19.5.1778 zum Gesellen, am 1.3.1779 zum Meister und am 8.7.1780 zum Schottenmeister in der altschottischen Loge L'Union. 1780 weihte ihn der Gold- und Rosenkreuzerorden ein als Bruder des im selben Jahr gegründeten Zirkels Neastes (Direktor → Johann Christian Anton Theden, Stuhlmeister der Loge Zur Eintracht) mit dem Ordensnamen Theophilus Michaos Duranthon. Theden beurteilte seine Gemütsneigungen als geschickt und redlich, er habe aber (1784) noch mäßig Auskommen. Er erhielt 1784 den II. Ordensgrad des Theoretikers, der der inhaltlichen Ausbildung des Rosenkreuzers diente und die Grundlagen der Alchemie vermittelte. Die Johannisloge wählte ihn am 7.3.1782 zum Bibliothekar, für das Maurerjahr 1783/84 zum 2. und am 14.4.1786 (bis 1792) zum 1. Vorsteher. Er hielt in den Vereinigten Logen die Rede in der Trauerloge auf den Tod Friderichs des Zweyten Königs von Preußen den 15. September 1786. Dittmar avancierte 1778 zum Kammergerichtsnotar, 1782 zum Justizkommissar und schließlich 1790 zum Hoffiskal. Er war zugleich 1776-1792 Konsulent (Justitiar) der Streitschen Stiftung, der Sammlungen des Berlinischen Gymnasiums zum Grauen Kloster. Die Loge Zur Eintracht ehrte den Verstorbenen am 25.10.1792 in einer Trauerloge.
Dittmar (eigentlich Dietmar), Siegismund Gottfried (9.7.1759 Primkenau/Niederschlesien-20.11.1834 Potsdam), luth.
Siegismund Dittmar stammte aus armen Verhältnissen. Der Junge lebte in Breslau bei Anna Katharina Garve geb. Förster (1717-1793) und ihrem Sohn, dem spätaufklärerischen Philosophen Christian Garve (1742-1798), dessen Bibliothek er ordnete, besuchte das Maria-Magdalenen-Gymnasium und studierte ab 1783 in Halle Theologie und Naturwissenschaften. Nach Reisen durch Deutschland, Holland, Frankreich und die Schweiz erhielt Dittmar in Berlin eine Stelle als Lehrer am Hofe → Ferdinands Prinz von Preußen. Er gründete in Berlin eine Erziehungsanstalt für Söhne der höheren Stände, 1804 mit dem Titel kgl. Professor. Er war 39 Jahre alt, als ihn am 6.9.1798 die Berliner Loge Pythagoras zum flammenden Stern (RY) aufnahm. Die Loge beförderte ihn am 14.2.1803 zum Gesellen und am 9.7.1804 zum Meister und wählte ihn 1805-1807 zum Redner. Er hielt in der Loge zahlreiche Reden, so Über den Werth des Lebens (9.7.1804), Über die Frage: wer ist ein wahrer und würdiger König (3.8.1804), Über Tod und Unsterblichkeit in der TrauerLoge den 26t. Decbr. 1804, Über das Lied in der maurerischen LiederSammlung: Nenn nicht das Schicksal grausam, Über Herders Lied Am kühlen Bach am luftgen Baum Träum ich nun meines Lebens Traum (22.5.1805), Eine Parodie des Gedichts von Matthisson der AlpenWanderer oder philosophische Erläuterung der Allegorie als eine Reise durch das menschliche Leben (6.3.1806). Dittmar war vom 10.1.1797 bis Juli 1802 Stammglied der Feßlerschen Gesellschaft der Freunde der Humanität. Der Pädagoge und Meteorologe hielt in Berlin öffentliche Vorlesungen. Er besuchte in Jena Friedrich Schiller und wahrscheinlich am 22.7.1786 Johann Wolfgang v. Goethe, wenige Tage vor dessen Abreise nach Karlsbad. Goethe beschwerte sich bei ihm, daß ihn oft Durchreisende mit langweiligen Besuchen quälten, weswegen er ihnen zuweilen seine vorhandenen Knochen vorlege, was den Besuchenden Langeweile errege und sie sich empfehlen; bei ihm habe er diese Vorlage vergessen. (Dietze: Treffliche Wirkungen, 156) Er korrespondierte mit Jean Paul. Dittmar wurde 1816 zum Sekretär am Konsistorium Brandenburg der evangelischen Kirche Preußens, später zum Mitglied im Medizinalkollegium der Provinz Brandenburg ernannt. Staatskanzler → Karl August v. Hardenberg beauftragte ihn 1816, dem Jahr ohne Sommer, mit halbjährlichen Wetterprognosen. Seine Erinnerungen aus meinem Umgange mit Garve, nebst einigen Bemerkungen über dessen Leben und Charakter erschienen 1801 in Berlin im Verlag von Johann Friedrich Unger, 1835 seine Theater-Briefe von Goethe und freundschaftliche Briefe von Jean Paul. Nebst einer Schilderung Weimar’s in seiner Blüthezeit.
Dittmar, Theodor Jakob (8.10.1734 Berlin-7.7.1791), V Jakob Ditmar, Kantor an St. Nicolai in Berlin, M Katharina Sophia geb. Cälius, ∞ 1766 Karoline Wilhelmine Seyffart (um 1746-1775, V Johann Gabriel Seyffart, kgl. Kammermusiker, 1. Violinspieler),
Bruder
→ Christoph Nathanael Dittmar
Theodor Jakob Dittmar besuchte 1742-1748 das Berlinische Gymnasium zum Grauen Kloster und 1748-1754 das Joachimsthalsche Gymnasium, studierte ab 1754 in Halle Theologie und begann 1757 sein Berufsleben als Privatlehrer in Berlin. Er wurde 1762 Mitglied des Kollegiums des Berlinischen Gymnasiums zum Grauen Kloster, zunächst als Subrektor, 1769 als Konrektor, 1774 als Professor für Geographie, Geschichte und deutschen Stil und 1782 zugleich als 1. Prorektor; er wohnte im 2. Stock des Kollegiumhauses. Er war 1778-1791 3. geistlicher Direktor der Streitschen Stiftung. Die Berliner Loge Zur Verschwiegenheit (GNML3W) nahm den 47-Jährigen am 9.3.1781 auf, beförderte ihn am 19.5.1781 zum Gesellen und am 19.6.1781 zum Meister. Er wurde wie sein Bruder → Christoph Nathanael Dittmar Gold- und Rosenkreuzer im Berliner Zirkel Neastes (1784) mit dem Ordensnamen Richamus Rotatus Edorodi. Sein Zirkeldirektor → Johann Christian Anton Theden beurteilte seine Gemütsneigungen als geschickt und sehr rechtschaffen, doch erlaube sein sehr mäßiges Einkommen nicht (1784), große Posten zu zahlen, er halte es aber für unbillig, ihn bei seiner Vortrefflichkeit nicht zu befördern. Dittmar erhielt 1784 den II. Ordensgrad des Theoretikers, der der inhaltlichen Ausbildung des Rosenkreuzers diente und die Grundlagen der Alchemie vermittelte. Die Johannisloge wählte ihn am 2.10.1783 zum 2. und 1791 (im IV. Grad) zum 1. Bibliothekar und Rendanten der Bibliothekskasse. Dittmar veröffentlichte historische und antiquarische Schriften.
Döbbelin, Konrad Karl Kasimir (1763 Kassel-23.1.1821 Berlin), V Karl Theophil Döbbelin (1727 Königsberg/Neumark-1793 Berlin), M Katharina Friederike geb. Neuhoff (1739-1793, V Oberstleutnant v. Kinglin), ∞ 1. Betti Scheel († 1791), Schauspielerin in seiner Theatergesellschaft, spielte erste Liebhaberin, 2. Auguste Feige († 1838), Schauspielerin, Opernsängerin,
Kinder:
Konrad Karl Theodor Ernst Döbbelin (17.11.1799 Neubrandenburg-13.12.1856 Coburg), ∞ die Schauspielerin Auguste Lange (9.8.1803 Berlin-23.1.1842 Coburg), Schauspieler, Regisseur, 1821 Leiter der Döbbelinschen Theatergesellschaft, die den Stamm des Hoftheaters Köthen bildete, 1836 am Hoftheater Coburg-Gotha
Emilie Döbbelin (* 1802), Schauspielerin
Alexander Döbbelin (1806-nach 1855), Schauspieler
Eduard Döbbelin (* 1811)
Konrad Karl Kasimir Döbbelin spielte zunächst in der Schauspielergesellschaft seines Vaters Karl Theophil Döbbelin, zerstritt sich mit ihm und gründete März 1788 eine eigene Truppe. Sein Vater gastierte in den siebziger Jahren in Magdeburg, er selbst erstmals 1791. Wann und wo Döbbelin Freimaurer wurde, ist nicht ermittelt. Die Magdeburger Loge Ferdinand zur Glückseligkeit affiliierte ihn am 31.12.1793 im Lehrlingsgrad und beförderte ihn am selben Tag zum Gesellen. Er deckte 1796 die Loge, die ihn am 31.12.1797 im Meistergrad reaffiliierte; er blieb bis 1800 ihr Mitglied. Mehrere Freimaurer seiner Loge waren an Gründung, Bau und Finanzierung des Nationaltheaters Magdeburg beteiligt und Ensemblemitglieder. Das Theater ging auf einen Vorschlag des Magdeburger Kaufmanns Georgy zurück.
Johann Andreas Joachim Georgy (1751? Magdeburg-1807), Großhändler, Firma Johann Georgy & Co. (Stahl-, Leder-, Materialwaren), Spediteur, Mitglied der Kaufleutebrüderschaft, deren Altermann, a. 9.12.1784 Magdeburg von der Loge Ferdinand zur Glückseligkeit, II. 2.3.1785, III. 1.10.1785, 1787 3. Steward und Speisemeister (bis 1789), 1795 2. Vorsteher, bis 1800 Mitglied.
Er sowie Jorgenson gehörten der siebenköpfigen Theatergesellschaft unter den Direktoren Hofrat Guichard, Ratmann Fritze und Kammerrat Suckro an.
Peter Gottfried Ludwig Jorgenson (1756? Magdeburg-1813 Magdeburg), V Peter Jorgenson, Konditor in Magdeburg, a. 1761 Magdeburg von der Loge De la Félicité, 1761-1762/1767 Mitglied der Loge Zur Beständigkeit, sein Sohn studierte ab 1773 in Halle Jura, in Magdeburg Stadtsekretär des Magistrats, 1798/1806 Ratmann, später Bürgermeister, a. 9.9.1791 Magdeburg von der Ferdinand zur Glückseligkeit, II. 24.2.1792, III. 25.1.1793, 1797 2. Sekretär, 24.6.1798 Sekretär, 1801/1803 1. Sekretär, 12.1.1805 interimistischer deputierter Meister, 24.6.1806-20.3.1807 Meister vom Stuhl.
Die Gesellschaft finanzierte das Theater mit Aktien zu je 50 Rtl. Aktien erwarben die Magdeburger Freimaurer Georgy 4 Aktien, → Johann Christian Diedrich 2 Aktien, Karl Heinrich Kayser 4 Aktien.
Karl Heinrich Kayser (1759? Zerbst-1820), Spediteur, Getreidegroßhändler, Besitzer einer Stärkefabrik, Mitglied der Kaufleutebrüderschaft und der Seidenkramerinnung, 1794-1806 Bürgermeister der Pfälzer Kolonie, T ∞ → Karl Friedrich Pieschel, S Mitgründer der Harmonie, a. 8.6.1792 von der Loge Ferdinand zur Glückseligkeit, II. 18.12.1792, III. 22.2.1793, 1793 2. Zeremonienmeister, deckte 17.7.1806, reaffiliiert 1814, Mitglied bis 1820.
Sie beauftragte den klassizistischen Architekten Friedrich Wilhelm v. Erdmannsdorf (1736-1800) mit dem Bau eines Schauspielhauses hinter dem Gasthof Zu den drei Engeln am Breiten Weg Nr. 154. Die Bauleitung hatten der Ratsmaurermeister Schwarzkopf und der Ratszimmermeister Winterstein, die beim Bau französische Kriegsgefangene beschäftigten.
Johann Gottfried Winterstein (1744? Quenstedt [heute Ortsteil von Arnstein] im Mansfelder Land-1808), ∞ 1773/74 Katharina Elisabeth Bromme?, a. 3.11.1796 in Magdeburg von der Loge Ferdinand zur Glückseligkeit, II.13.1.1797, III. 28.4.1797, V. 27.12.1799, 1797-1801 Baumeister der Loge.
Das Theater eröffnete am 1.4.1795. Die Theatergesellschaft berief Döbbelin zum Prinzipal (Intendanten), dessen Schauspielergesellschaft den Grundstock des Theaterensembles bildete. Dem Ensemble gehörten mehrere Freimaurer an: die künstlerischen Direktoren (Regisseure) ab 1796 → Friedrich Ludwig Schmidt und August Heinrich Fabricius, der Musikdirektor → Friedrich Adolf Pitterlin, der die Winterkonzerte der Loge dirigierte, der Schauspieler Franz Alois Hostovsky, der Schauspieler und Opernsänger → Ludwig Heinrich Christian Geyer, der Hornist → Johann Andreas Seebach. Intendanten des Nationaltheaters waren vom 1.9.1805 bis August 1821 die Freimaurer Hostovsky und Fabricius.
Franz Alois Hostovsky (1756 Prag-13.2.1826) ∞ 1797 Charlotte Friederike Wirth (V Kustos an der ref. Kirche in Magdeburg), ab 1792 Schauspieler am Magdeburger Nationaltheater, spielte Zärtlichen Vater, Charakterrollen, 22.7.1805 Bürger Magdeburgs, a. 21.10.1791 von der Loge Ferdinand zur Glückseligkeit, II. 13.4.1792, III. 21.3.1804, bis 1821 Mitglied
August Heinrich Fabricius (1764 Berlin-4.1.1821 Magdeburg, Selbstmord), 1779 Schauspieler, 1792-1796 in der Theatergesellschaft von Johann Karl Tilly, danach Schauspieler und Opernsänger (Baß) am Nationaltheater Magdeburg, gab komische Rollen, pachtete 1806 das Nationaltheater, 31.3.1797 affiliiert von der Loge Ferdinand zur Glückseligkeit im Gesellengrad, III. 31.3.1797, 1802 letztmals genannt.
Döbbelin nahm 1809 ein Engagement als Schauspieler am Hoftheater Stuttgart (Intendant 1807-1814 Karl v. Wächter) an. Nach seinem Tod übernahm sein Sohn Konrad Karl Theodor Ernst Döbbelin die Leitung der Döbbelinschen Schauspielergesellschaft.
Döbler (Döp[p]ler), Wilhelm Gottlieb Friedrich (24.12.1762 Erfurt-etwa 1810 Berlin?), V Johann Heinrich Gottfried Döbler.
Gottlieb Döbler kam zwischen Anfang 1781 und 1784 nach Berlin, wo er Schüler von → Edward Francis Cunningham wurde. Der Historienmaler und Kupferstecher beteiligte sich 1787, 1789 und 1788 an den Ausstellungen der Berliner Akademie der Künste. Am 27.2.1790 schlug Johann Georg Moser ihn seiner Loge Zum Pilgrim vor.
Johann Georg Moser (15.10.1761 Eutin/Holstein-7.3.1818 Berlin), Bauinspektor am Oberhofbauamt, Stadtrat im Berliner Magistrat, 1797 Oberhofbaurat, 18.11.1785 von → Friedrich Becherer vorgeschlagen, a. 10.2.1786 Berlin von der Loge Zum Pilgrim (GLL), II. 7.3.1788, III. 29.10.1788, 2.11.1789-24.2.1796 Zeremonienmeister, 25.2.1796-26.2.1799 2. Aufseher, 26.2.1799-28.2.1803 1. Aufseher, Mitglied noch 1815.
Die Loge nahm Döbler am 17.4.1790 auf. Er ging bald darauf auf Reisen. In Königsberg porträtierte er 1791 Immanuel Kant. Sein Porträt ist vermutlich das einzige, zu dem Kant im Alter selbst gesessen hat. Es gelangte durch → Ehregott Andreas Christoph Wasianski in den Besitz der Königsberger Loge Zu den drei Kronen (verschollen?). Döbler besuchte im westpreußischen Marienwerder die Loge Zur goldenen Leier, die ihn zum Gesellen beförderte. Er kehrte bald nach 1800 nach Berlin zurück, wo ihn seine Loge Zum Pilgrim am 16.6.1806 zum Meister beförderte.
Döhl, Johann Friedrich (15.4.1765 Magdeburg-11.9.1836 Spandau), ∞ um 1795 Johanne Dorothea Kolbe († 26.8.1816 49-jährig).
Johann Friedrich Döhl war nach der Lehre in Berlin 1782-1787 in Angermünde und Berlin in Stellung, kaufte nach der Approbation zum Apotheker (2.12.1796) am 1.7.1795 in Spandau mit 12 000 Rtl die Stadt-Apotheke Potsdamer Straße 40 (heute Adler-Apotheke in der Carl-Schurz-Straße), womit er dort das Apotheken-Monopol besaß, und 1800 in Potsdam die Garnison-Apotheke Breite Straße 37, die er mit behördlicher Genehmigung schloß. Die Berliner Loge Zur Eintracht (GNML3W) ballotierte auf Vorschlag (4.12.1804) des Apothekers und Logensekretärs → Valentin Rose am 4.1.1805 hell, worauf → Martin Heinrich Klaproth, ebenfalls Apotheker, ihn am 3.3.1805 aufnahm. Die Loge beförderte ihn am 9.5.1806 zum Gesellen, am 15.6.1813 zum Meister und am 15.1.1821 zum Schottenmeister der Allgemeinen Altschottischen Loge. Der Spandauer Stadtteil Heidebezirk (121 Häuser, heute etwa Damerowstraße) wählte Döhl am 9.3.1809 mit Stimmenmehrheit zum Verordneten der Stadtverordnetenversammlung und diese ihn am 12.3.1809 zum unbesoldeten Magistratsmitglied (Stadtrat); er war zuletzt Stadtältester. 1813 traf sich in seiner Apotheke die preußische Patriotenpartei. Seine Loge gedachte des Verstorbenen am 2.11.1836 in einer Trauerloge, deren Gedächtnisrede der Verleger und Schriftsteller Julius Eduard Hitzig (1780-1849) hielt.
Dölle, Johann Christoph (9.8.1765 Großengottern [heute Ortsteil der Landgemeinde Unstrut-Hainrode]/Kursachsen-1837 Heiligenstadt?), ∞ Louise Katharina Strohkirch, sein Teilhaber Karl Dietrich Ludwig Brunn (1810) ∞ 1812 seine noch minderjährige Tochter Johanne Louise Dölle.
Johann Christoph Dölle lernte 1775-1785 bei Brachvogel (Baackvogel) in Langensalza, zu den Amt Großgottern gehörte, den Buchdruck, wonach ihn der Buchdrucker Ernst Wilhelm Gottlieb Kircher (25.9.1758 Gernrode-22.8.1830 Braunschweig, ∞ 1783 Friederike Katharina Wilhelmine Duncker) 1787 als Faktor einstellte, arbeitete nach seinem Umzug nach Braunschweig 1788-1790 in dessen dortigen Schulbuchhandlungs-Druckerei und ließ sich 1790 in Halberstadt nieder, wo er am 12.8.1791 die Druckerei Johann Heinrich Mevius kaufte. Der nunmehrige preußisch privilegierte Regierungsbuchdrucker druckte Schulbücher und Kalender; seine Druckerei war die Hauptkalenderfaktorei zwischen Elbe und Rhein. Dölle erwarb zudem 1803 eine Druckerei in Heiligenstadt und 1811? eine Papierfabrik. Die Loge Zu den drei Kleeblättern (GLL) in Aschersleben nahm den 40-jährigen Drucker am 23.10.1805 auf und beförderte ihn zum Gesellen und Meister. Er trat am 24.6.1808, dem Tag der Konstitutionserteilung durch die Große National-Mutterloge und der Installation, der Loge Zur aufgehenden Sonne in Halberstadt bei, die ihn 1814 zum substituierten 1. Aufseher wählte.
Domhardt, Ludwig Friedrich v. (1744 auf einem Gut im preußisch-litauischen Kammerdepartement-25.1.1821), V Johann Friedrich v. Domhardt (1712 Allrode bei Blankenburg-1781 Königsberg/Pr.), 1762 Präsident der ostpreußischen und litauischen Kammer, 1771 nobilitiert, M Johanna Amalia geb. Keydell (Keudell, 1716-1779, V Johann Kaspar Keydel, herzoglich braunschweigischer Forstinspektor, dann Domänenpächter in Ostpreußen), ∞ Agnes Theresia Honorata Gräfin v. Leszczyc Radolino Radolinska († 1.9.1828 Worienen),
Brüder:
Justus Friedrich v. Domhardt (1741-1792), 9 Jahre im Kürassierregiment Nr. 2 v. Wiersbitzky, 1771 Rittmeister a. D. auf Jesau/Ostpreußen, dann Bombitten bei Heiligenbeil/Ostpreußen, II. 1776 Königsberg in der Loge Zu den drei Kronen, III. 1785
Otto Heinrich Friedrich v. Domhardt (1756-25.12.1835), 1774 in hessen-kasselschen Diensten, später Rittmeister a. D., Erbherr im ostpreußischen Schrombehnen, 1787 westpreußischer Landstallmeister, 1775? Mitglied der Loge Zu den drei Kronen in Königsberg, II. 1785
Schwager:
Peter Paul Le Cocq [† 1781], Direktor der (ostpreußischen) Tabakadministration, 1777 Mitglied der Loge Zu den drei Kronen in Königsberg
Tante
Elisabeth Albertine Henriette v. Domhardt (1754-1795) ∞ Sylvius Heinrich Moritz v. Frankenberg und Proschlitz (1732-1795, 1790 Generalmajor, Chef des Dragonerregiments Nr. 19)
Sohn:
Friedrich Wilhelm Moritz v. Frankenberg (12.1.1781 Tilsit-1843), Leutnant im Dragonerregiment Nr. 6, a. 1806 Königsberg von der Loge Zu den drei Kronen
Cousins:
Johann Heinrich Leopold v. Keudell (22.11.1738 Buylien bei Gumbinnen/Ostpreußen-24.12.1795 Lasdinehlen/Ostpreußen), V Heinrich Christian Keudell, Domänenpächter, verzichtete auf das Adelsprädikat, weil Adlige keine Domänen pachten durften, Friedrich Wilhelm II. stellte das Adelsprädikat 1789 wieder her, M geb. v. Domhardt (Schwester von Johann Friedrich v. Domhardt), ∞ 1763 Louise Dorothea v. Kallenberg (1748-1815 Grumbkowkaiten), Leutnant im Dragonerregiment Nr. 8 v. Busch, mit seinem Bruder Theodor Heinrich Friedrich v. Keudell Generalpächter der ostpreußischen Domänengüter Grumbkowkaiten und Georgenburg, Amtsrat, 1797 Mitglied der Loge Zu den drei Kronen in Königsberg.
Theodor Heinrich Friedrich v. Keudell (13.6.1751 Königsfelde/Ostpreußen-30.12.1820 Königsberg/Pr.), mit seinem Bruder Johann Heinrich Leopold v. Keudell Generalpächter der Domänengüter Grumbkowkaiten und Georgenburg, Amtsrat in Georgenburg, auf Nieder-Gielgudyszczki/Neu-Ostpreußen, a. I. 1785 Königberg von der Loge Zu den drei Kronen.
Ludwig Friedrich v. Domhardt studierte ab Mai 1762 (Jura?) an der Albertina in Königsberg, begann seine berufliche Laufbahn als Referendar in Berlin, unternahm eine Bildungsreise nach England, wo er als Freimaurer angenommen wurde und die höheren maurerischen Grade erwarb. Friedrich II. wollte den 23-jährigen Sohn eines seiner besten Kammerpräsidenten nach seiner Rückkehr sprechen und ihn, wenn er Kenntnisse nachweisen konnte, im Zivildienst platzieren. Die Audienz im Januar 1767 entschied über Domhardts schnelle Karriere. Der König attestierte ihm Fähigkeiten, er wäre aber noch sehr jung, setzte ihn aus Rücksicht auf seinen Vater am 22.1.1767 bei der Regie an, ernannte ihn 1769 zum Kriegs- und Domänenrat bei der Kammer in Kleve, im Mai 1776 zum 2. Kammerdirektor in Minden und am 4.1.1782 zum Präses und Direktor der Kammerdeputation in Bromberg. Domhardt trat 1780 in Königsberg der Loge Zu den drei Kronen bei, besuchte aber nach seiner Versetzung nach Minden vermutlich nur einmal, am 5.5.1781, die dortige Loge Wittekind zur westfälischen Pforte. Sein Dienst- und Ordenschef → Johann Christoph v. Wöllner charakterisierte ihn 1786, er sei mit Minister v. Hagen, der ihn sehr schätze, auf Reisen gewesen, habe viele Landeskenntnisse gesammelt, besitze einen durchdringenden Verstand und richtige Beurteilung, könne ein großer Kameralist werden, habe ein gutes Herz, sei nach der Nobilitierung aber sehr stolz geworden (Straubel: Biographisches Handbuch, 221). Friedrich Wilhelm II. ernannte Domhardt im September 1786 zum Kammerpräsidenten in Marienwerder, 1790 mit dem Charakter Finanzrat, zugleich zum Chef des Feld-Kriegskommissariats der 4. Armee, kassierte ihn am 1.7.1790 als Kammerpräsident, was er Januar 1791 als in leidenschaftlicher Übereilung geschehen bereute, verlieh im aber kein Amt mehr. Domhardt zog sich daraufhin auf sein Gut Worienen zurück.
Dönhoff, Friedrich Wilhelm Graf v. (8.2.1723-1.12.1774), V Alexander v. Dönhoff (9.2.1683 Königsberg/Pr.-9.10.1742 Berlin), Generalleutnant, 1722 Chef des Infanterieregiments Nr. 13, 1730 Mitglied des Kriegsrats im Prozeß → Kronprinz Friedrich und Hans Hermann v. Katte [28.2.1704-6.11.1730 Küstrin]), M Charlotte Gräfin v. Blumenthal [10.4.1701 Berlin-28.9.1761 Berlin]), ∞ 2. Anna Sophie Charlotte v. Langermann (16.5.1740-31.8.1793, V Adolf Friedrich v. Langermann [1694/95 Groß-Driesen?/Mecklenburg?-1757 Insterburg], Generalmajor, Chef des Dragonerregiments Nr. 6], M Christiane Juliane geb. v. Rieben [* 1719]),
Tochter:
Sophie Juliane Friederike v. Dönhoff (17.10.1768 Beynuhnen/Ostpreußen-26.1.1834 Gut Beerbaum/Mittelmark), 1789 Hofdame der preußischen Königin Friederike Luise von Hessen-Darmstadt (1751-1805, ∞ 1769 → Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen, ab 1788 Sommersitz und ab 1797 Wohnsitz in Freienwalde), am 11.4.1790 vollzog Hofprediger → Johann Friedrich Zöllner in der Charlottenburger Hofkapelle die Trauung linker Hand zwischen Friedrich Wilhelm II. und ihr (1792 geschieden),
Kinder:
Friedrich Wilhelm Graf von Brandenburg (1792-1850), preußischer Ministerpräsident Sophie Gräfin von Brandenburg (1793-1848), Herzogin von Anhalt-Köthen
Major Friedrich Wilhelm Graf v. Dönhoff war Kommandeur des Infanterieregiments Nr. 35 Prinz Heinrich in Spandau sowie Herr auf den ostpreußischen Gütern Beynuhnen und Angerau. Die Berliner Loge Zur Eintracht nahm ihn am 18.1.1762 als Lehrling und Gesellen auf und beförderte ihn im selben Jahr zum Meister und am 28.2.1762 zum Schottenmeister der altschottischen Loge L’Union.
Dönhoff-Friedrichstein, August Christian Ludwig Karl Graf v. (12.2.1742 Berlin-30.3.1803 Berlin), ref., V Friedrich II Graf v. Dönhoff (1708-1769), Oberst, Amtshauptmann zu Kloster Zinna, Erbherr, M Sophie Wilhelmine geb. v. Kameke (1712-1758, V Paul Anton v. Kameke [1674-1717], Generalmajor, Regimentschef), ∞ 1761 Charlotte Amalie Rollaz du Rosey (8.3.1742 Königsberg/Pr.-31.7.1813 Friedrichstein, V Melchior Friedrich Philipp Rollaz du Rosey [1699-1744 Königsberg/Pr.], Geh. Rat, Kammerherr der Königin Elisabeth Christine, M Amalie Juliane geb. v. Dönhoff [1714-1760])
Sohn
August Friedrich Philipp Graf v. Dönhoff (1763-1838) ∞ Steinort 1796 Pauline Luise Amalie Gräfin v. Lehndorff (11.6.1776 Steinort-1813, V → Ernst Ahasver Heinrich Graf v. Lehndorff, M Amalie Karoline geb. Gräfin v. Schmettau [1751-1830]), Leutnant im Dragonerregiment Nr. 8 in Insterburg, 1804 Major, dann Oberst, Flügeladjutant Friedrich Wilhelms III. in Potsdam, 1808 Orden Pour le mérite, 1809 Obermarschall (Landtagsmarschall) der Provinz Preußen, Oberhofmarschall, 1823 Landhofmeister, 1782-1787 Königsberg Mitglied der Loge Zu den drei Kronen, II 1785, 1787 Insterburg Mitglied der Loge Zum preußischen Adler, 1804/1811 Berlin Mitglied der Loge Zu den drei Seraphim (IV. Grad), 1811/1815 Ehrenmitglied der Großen National-Mutterloge zu den drei Weltkugeln.
Christian Graf v. Dönhoff studierte ab 1756 in Königsberg. Kaiserin Elisabeth (1709-1762) ernannte ihn während der russischen Besetzung des Königreichs Preußen (Ostpreußen) zum kaiserlich russischen Kammerherrn und zum Deputierten der preußischen Stände in St. Petersburg. Nach dem Krieg ernannte Friedrich II. ihn 1764 zum Kriegs- und Domänenrat in Breslau und 1771 zum außerordentlichen Gesandten in Stockholm. Dönhoff lebte ab 1775 als Privatmann auf seinem ostpreußischen Erbbesitz Friedrichstein im Pregeltal 20 km östlich von Königsberg. Dönhoff soll in Berlin als Freimaurer aufgenommen worden sein, wofür es in den Logenprotokollen keine Hinweise gibt. Als die Königsberger Strikte Observanz-Loge Zu den drei Kronen ihn am 4.12.1770 affiliierte, war er Ritter der Strikten Observanz mit dem Ordensnamen Christianus eques a sancta victoria. Die Loge wählte ihn am 14.10.1779 einstimmig zum Meister vom Stuhl (zuständig für die altschottische Loge), am 21.2.1780 in die neue Administration des Hauses zu den drei Kronen und am 26.1.1780 zum altschottischen Obermeister. Dönhoff ging wie die meisten preußischen Hochgradmaurer von der untergehenden Strikten Observanz zum Gold- und Rosenkreuzerorden über, vermutlich im Oktober 1781, da er am 20.12.1782 1 Jahr 2 Monate im Orden war. Er gehörte mit dem Ordensnamen Fodiforus Chimiarchus Vocatus Melleus Gustus de Nudanosa dem 1782 in Königsberg von → Friedrich Leopold Freiherr v. Schroetter aufgebauten Zirkel Ferreus an, stieg bis zum IV. Grad des Philosophen auf und verwaltete die Zirkelämter 1782 des Kassierers und 1783-1786 des Thesaurius. Sein Zirkeldirektor Freiherr v. Schroetter lobte 1782 seinen gute[n] Willen für Tugend und Religion, Ergebung, Eifer für den Orden. Dönhoff kehrte nach dem Thronwechsel 1786 in den Staatsdienst zurück. Friedrich Wilhelm II., selbst Rosenkreuzer, ernannte ihn zum Etatsminister und Obermarschall des Königreichs Preußen (Ostpreußen) und 1788 im Nebenamt zum Präsidenten des Pupillenkollegiums (bis 1803). Dönhoff blieb aktiver Freimaurer. Am 1.12.1801 übertrug ihm das Berliner Altschottische Direktorium das Amt des Delegierten Inneren Ordensoberen des Delegierten Inneren Provinzialorients für Ostpreußen, Litauen und Neu-Ostpreußen. Die Königsberger Loge ehrte den Verstorbenen am 19.4.1803 in einer Trauerloge, in der sie die Kantate Naenie des Organisten → Wilhelm Ferdinand Halter aufführte.
Dutitre, Étienne (30.1.1734 Berlin-16.7.1817 Berlin, Grab auf dem Französischen Friedhof Chausseestraße 127, 1830 gußeisernes Kreuz aus der Kgl. Eisengießerei, 2015 Berlinisches Ehrengrab), Vorfahren Réfugiés, Färber aus Sedan, V Étienne Dutitre, Kattundrucker, M Sara geb. Claude, ∞ 25.3.1781 Marie Anne George (27.1.1748 Berlin-22.7.1827 Berlin, V Benjamin George [1.3.1712-22.12.1771], Vorfahren Réfugiés aus Metz, Bierbrauer), Madame Dutitre, Berliner Original mit Mutterwitz, nach E. T. A. Hoffmann die einzige Frau, die Berliner Dialekt mit Grazie spräche.
Töchter
Sara Augustine Dutitre (* 18.8.1785) ∞ 1805 Karl Ferdinand Beyrich (V vermutlich
Ferdinand Beyrich [20.9.1745 Wernigerode-21.6.1817 Berlin], M Christiane Caroline geb. Jordan), Manufakturunternehmer, Mitbesitzer der Seidenmanufaktur Blanc & Beyrich (gegründet 1772, großgewerbliche Weberei, 1776 67, 1797 172 , 1805 151 Stühle), später Ferdinand Beyrich Söhne, in Altkölln, Brüderstraße 39 (1782 60 Stühle, 1798 90 Stühle, 255 Arbeitskräfte), besaß 1795 städtische Immobilien im Wert von 30 000 Rtl, a. 24.6.1774 Berlin von der Loge Royale York de l'Amitié, 1797-1811 Berliner Tochterloge Zur siegenden Wahrheit im Meistergrad
Marie Louise Dutitre (1.10.1786-31.12.1875) ∞ 4.2.1808 Wilhelm Christian Benecke, 4.4.1829 preußischer Adelsstand v. Gröditzberg (12.12.1778 Frankfurt/Oder-4.6.1860 Berlin, V Michael Christian Benecke [† 26.9.1807 Frankfurt/Oder], Kaufmann in Frankfurt/Oder, M Helene Christiane geb. Nikisch), trat 1793 in das Waren-, Speditions-, Geld- und Wechselgeschäft (gegründet, 1792, 1795 Bankhaus Gebrüder Benecke) seiner Onkel Christian Benecke und Stephan Benecke ein, das 1794 die Handlung des verstorbenen Bankiers → Friedrich Wilhelm Schütz übernahm, 1806-1823 Geschäftsleitung der Bank, um 1800 eine der bedeutendsten Banken Berlins, 1807 Berliner Bürgerrecht, 1809 Stadtrat, 1819 in Berlin Patent-Papier-Fabrik mit englischen Maschinen, betrieb 1821 Verkauf der großen Gemäldesammlung des Engländers Edward Solly (1776-1848) an Friedrich Wilhelm III., Grundstock der Berliner Gemäldesammlung
Christian Benecke (1763-1805), V Johann Wilhelm Benecke, Chirurg aus Stolp in Hinterpommern, M Susanne geb. Richard, Vormundschaft der vier Kinder übernahm nach Christians Tod der Bruder Nicolas Benecke (1759-1811), a. 5.12.1793 Berlin von der Loge Royale York de l'Amitié, 1796 I, 1802/03 abwesendes Mitglied, Trauerloge am 16.12.1803, Trauerrede → Ernst Ferdinand Klein
Stephan Benecke (1768-1806) ∞ Eleonore Dorothea Rudelius (V Kaufmann in Frankfurt/Oder), a. 1796? Berlin von der Royale York de l'Amitié, 1797-1806 Mitglied Zur siegenden Wahrheit
Étienne Dutitre, Hugenotte und Mitglied der französischen Gemeinde in Berlin, war ein erfolgreicher Baumwoll-, Seiden- und Kattunhändler, Besitzer der größten Berliner Baumwollmanufaktur (großgewerbliche Weberei, gegründet 1736/1756, 1769 150 Stühle, etwa 100 Arbeitskräfte, 1782 60 Stühle Wolle, 74 Arbeitskräfte, 1798 82 Stühle, 1802 40 Stühle) und einer Kattundruckerei (70 Arbeitskräfte), war Altermann der kombinierten deutschen und französischen Kaufmannsgilde (Berlin, Kölln, Friedrichswerder, Dorotheenstadt, Friedrichsstadt). Die Familie wohnte winters in der Altberliner Poststraße 26 (Dütritesches Haus) und sommers in Charlottenburg in der Berliner Straße 54 neben der Gaststätte Türkisches Zelt (ab 1791 im Besitz seines Bruders Benjamin Dutitre). Die Berliner Loge L'Amitié nahm Dutitre am 22.6.1761 auf. Er besaß 1782 den Gesellengrad, habe aber vor mehr als 18 Jahren aufgehört zu arbeiten.