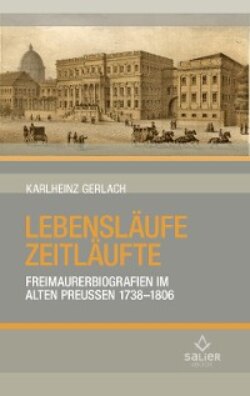Читать книгу Lebensläufe Zeitläufte - Karlheinz Gerlach - Страница 11
E
ОглавлениеEbart, Johann Gottlieb (5.12.1746 Berlin-19.4.1805 Spechthausen), Vorfahr Jakob Ebart, 1654 Papiermacher in Neustadt/Dosse, V Johann Paul Ebart (um 1709-1782), Papiermacher in Pankow (heute Stadtbezirk von Berlin), besaß Papierhandlung in Berlin, M Maria Gertrud geb. Langenbach verw. Fournier (1714?-1796), ∞ 1776 Friederika Charlotte Stein (1753-1787, V Mühlenmeister in Prenzlau),
Sohn:
Johann Wilhelm Ebart (1781-1822), Papierhändler in Berlin, Besitzer der Papiermühle in Spechthausen
Johann Gottlieb Ebart wurde nach der kaufmännischen Lehre 1776 Teilhaber und nach dem Tod des Vaters 1782 Inhaber der Papierhandlung. Die Berliner Loge Zur Verschwiegenheit (GNML3W) nahm den 34-Jährigen nach einstimmiger Ballotage am 20.7.1781 auf, beförderte ihn am 30.10.1781 zum Gesellen und am 27.3.1782 zum Meister. Sie wählte den nunmehrigen Schottenmeister 1784-1794/95 zum Schatzmeister, 1786-1793/94 zudem zum 1. Steward und Juli 1799 zum 1. deputierten Vorsteher. Ebart kaufte am 15.3.1787 für 9000 Rtl von der Witwe des Papiergroßhändlers Peter Andreas Eysenhardt die Papiermühle in Spechthausen auf dem Barnim bei Eberswalde, der sie 1780 gegründet und bis 1786 besessen hatte. Ebart entwickelte die Mühle zu einem der größten und besten preußischen Papierwerke (Firma Johann Gottlieb Ebart), baute in Spechthausen Arbeiterwohnungen, gründete 1789 eine Arbeitsschule für 28 Fabrikkinder, legte eine Viktualienhandlung (1797, Lebensmittelgeschäft) und eine Brauerei mit Gaststätte (heute das Gasthaus Waldhof) an. Er verband sich mit dem Kaufmann Johann Chr. Friedrich Stentz, der in seiner Berliner Papierhandlung tätig war, zu der Firma Ebart & Stentz in der Behrenstraße (1789-1812). Ebart erfand in den 90er Jahren ein Sicherheitspapier, dessen Nachahmung ausgeschlossen und das brauchbarer war als das französische. Die preußische Regierung beauftragte 1799 den nunmehrigen Kommerzienrat (1792), das Papier für die Tresorscheine, das erste preußische Papiergeld mit Zwangskurs, zu produzieren (Wasserzeichen J. G. Ebart, J. G. E. mit heimischen Motiven) (Schulte, in: NDB, 4, 215; Friese: Papierherstellung, 2-4). Das Altschottische Direktorium übertrug Ebart am 6.2.1800 die Repräsentanz bei der Iserlohner Loge Zur deutschen Redlichkeit und nahm ihn am 13.10.1801 als Mitglied auf. Ebart vermachte der Großen National-Mutterloge zu den drei Weltkugeln testamentarisch 100 Rtl zur Armenverteilung.
Ebel, Johann Gottfried (6.10.1764 Züllichau/Neumark-8.10.1830 Schergüetli am Zürcher See/Kanton Zürich), V Kaufmann.
Johann Gottfried Ebel studierte in Frankfurt (Oder), Wien und Zürich Medizin und promovierte 1789 in Frankfurt zum Dr. med., wo ihn am 5.6.1784 die Loge Zum aufrichtigen Herzen aufnahm und am 10.5.1785 zum Gesellen und am 7.1.1786 zum Meister beförderte. Ob er später anderen Logen beitrat, ist nicht ermittelt. Ebel ging im Frühjahr 1790 nach Wien, durchwanderte 1790-1792 die Schweiz und ließ sich 1792 in der freien Reichsstadt Frankfurt als Arzt nieder. Er schrieb Anleitung, auf die nützlichste und genußvollste Art die Schweiz zu bereisen (Zürich 1793), das erste gute Reisehandbuch für die Schweiz, das Friedrich Schiller für sein Drama Wilhelm Tell nutzte. Ebel war ein Anhänger der Französischen Revolution. Die Reichsstadt entsandte ihn 1796 als Attaché ihrer Deputation (Gesandtschaft) nach Paris, wo er unter dem Namen Detmar Bosse das französische Bürgerrecht erwarb, Abbé Sieyès (Emmanuel Joseph Sieyès, 1748-1836) übersetzte, medizinische Forschungen betrieb, mit dem Anatom Samuel Thomas Sömmering (1755 Thorn-1830), einst Gold- und Rosenkreuzer, experimentierte. Er erhielt 1801 das helvetische Bürgerrecht, kehrte 1802 nach Frankfurt am Main zurück und siedelte1810 endgültig nach Zürich über. Ebel betrieb geologische, geognostische und medizinische Studien, befaßte sich mit dem Bau der Alpen und den Ursachen des Kretinismus. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften wählte ihn 1808 zum Korrespondierenden Mitglied. Er schrieb Über den Bau der Erde in dem Alpen-Gebirge (1808) und Abriß des politischen Zustandes der Schweiz (1813).
Ebers, Johannes (19.3.1742 Treysa/Hessen-Kassel [heute Stadtteil von Schwalmstedt]-21.1.1818 Berlin), Eltern und Ehefrau sind nicht ermittelt,
Sohn:
→ Karl Friedrich Ebers
Der junge Johannes Ebers hielt sich in Notariatsgeschäften 1756-1766 in England auf, lernte Englisch sprechen und schreiben gleichsam als Muttersprache und wurde Freimaurer, kehrte 1770 nach Hessen zurück, wo er in Kassel am Collegium Carolinum als englischer Sprachmeister (Englischlehrer) lehrte und zugleich als Hoflehrer die fürstlichen Pagen (bis 1778) unterrichtete. Ebers trat 1781 in preußische Dienste als kgl. Obersalpeterhütteninspektor in Berlin. Er war zugleich wirkliches Mitglied des Magdeburg-Halberstädtischen Oberbergamts und Assessor der Justizdeputation in Rothenburg (Saale), wonach er die Oberaufsicht über die preußischen Salpeterhütten und die Salpeterraffinerie in Berlin hatte. In die Berliner Jahre fällt das erste sichere maurerische Datum, seine Affiliierung am 24.2.1796 durch die Loge Zum flammenden Stern. Sie wählte ihn am 16.6.1796 zum 2. Vorsteher. Ebers erhielt am 25.10.1796 einen Ruf an die Universität Halle als außerordentlicher Professor für Philologie und Anglistik, das zweite Extraordinat in der Geschichte der englischen Philologie in Deutschland. Er trat in Halle 1797 der Loge Zu den drei Degen bei, die ihn 1801, am 8.5.1805 und am 18.4.1806 zum Zeremonienmeister und Archivar, 1806 auch zum Korrespondenzsekretär wählte. Sie beförderte ihn am 3.6.1805 auf den Schottengrad der delegierten altschottischen Loge Zu den drei Nelken, die ihn am 15.11.1805 zum 2. Oberaufseher wählte. Ebers verfaßte zahlreiche englische Lehrbücher, so eine Englische Sprachlehre für die Deutschen nach Sheridan's und Walker's Grundsätzen (bei Johann Samuel Ferdinand Oehmigke: Berlin 1792), und gab Oliver Goldsmith' Vicar of Wakefield (1794, mit Akzenten) heraus. Seine Hauptleistung sind die Wörterbücher, das Vollständige Wörterbuch der englischen Sprache für die Deutschen. Nach den neuesten und besten Hilfsmitteln mit richtig bezeichneter Aussprache eines jeden Wortes ( 2 Bände, bei Johann Gottlob Immanuel Breitkopf Sohn und Compagnie: Leipzig 1793-1794), The New and Complete Dictionary of the German und English Languages, Composed chiefly after the German dictionarie of Mr Adelung and Mr Schwan (3 Bände, 1796-1799). (Lewis: Die Wörterbücher, 44-56, 60-143)
Ebers, Karl Friedrich (25.3.1770 Kassel-9.9.1836 Berlin), V → Johannes Ebers, ∞ zweimal, 1. Ehe geschieden.
Karl Friedrich Ebers bekam eine Ausbildung als Artillerist in Berlin, wo man seine musikalische Begabung entdeckte und ihm Musikunterricht erteilte. Herzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg engagierte den 19-jährigen Musiker 1799 als Kammerkompositeur und Vizekapellmeister. Ebers ging 1806 als Musikdirektor nach Leipzig. Zuvor nahm ihn am 3.8.1806 in Halle die Loge Zu den drei Degen (28.10.1787 GNML3W) in Halle, die Loge seines Vaters, auf, nannte ihn aber schon 1809 nicht mehr. Ob er in Leipzig einer Loge beitrat, ist nicht ermittelt. Ebers geriet nach der Scheidung von seiner Frau in dauernd bedrängte Verhältnisse, gab Musikunterricht, war aber dennoch auf die Unterstützung seiner Loge angewiesen. Er komponierte Lieder und Opern, 1806 in Pest 6 langsame und 6 Wiener Walzer, die in Leipzig in einer bearbeiteten Fassung gedruckt wurden ― der erste Druck eines Wiener Walzers. Joseph Seconda (1761-1820) engagierte Ebers 1814 als Nachfolger E. T. A. Hoffmanns (1813-Februar 1814) als Musikdirektor seiner in Leipzig und Dresden spielenden Operngesellschaft, von der er 1817 nach Magdeburg ans Nationaltheater Magdeburg wechselte. Er zog sich 1820 ins Privatleben zurück und wohnte ab 1822 in Berlin, wo ihn vermutlich die Loge Zum flammenden Stern affiliierte. Ebers gab XV Freimaurer-Lieder für alle vorkommenden Fälle bei den Tafellogen (1800) heraus, schrieb Sarsena, oder Der vollkommene Baumeister, enthaltend die Geschichte und Entstehung des Freimaurerordens und die verschiedenen Meinungen darüber, was er in unsern Zeiten seyn könnte, was eine Loge ist, die Art der Aufnahme, Oeffnung und Schließung derselben, in dem ersten und die Beförderung in dem zweiten und dritten der St. Johannisgrade, so wie auch die höheren Schottengrade und Andreasritter. Treu und wahr niedergeschrieben von einem wahren und vollkommenen Br. Freimaurer. Aus den hinterlassenen Papieren gezogen und unverändert zum Drucke übergeben (bei Kunz: Bamberg 1817).
Eckenbrecher, Johann August v. (24.9.1787 nobilitiert) (7.10.1743 Berlin-8.11.1822 Gutenpaaren [heute Gemeindeteil von Zachow, Ortsteil der Stadt Ketzin]/Mark Brandenburg), V Johann August Eckenbrecher, Bürger, Weinhändler in Berlin, M Sophie Luise geb. Dreyer, ∞ Wollup 1781 Friederike Sophie Wilhelmine Beyer (1755-1810).
Der 17-jährige Johann August Eckenbrecher trat 1760, mitten im Siebenjährigen Krieg, als Bombardier, einem Dienstgrad zwischen dem Gemeinen, dem Kanonier, und dem Unteroffizier, zur preußischen Artillerie, die wegen ihrer technischen und handwerklichen Anforderungen auch dem Bürgertum offen stand. Er nahm, nunmehr Sekondeleutnant, vom 7.8. bis 9.10.1762 an der Belagerung von Schweidnitz teil, die Napoleon als eine der schönsten Kriegsoperationen Friedrichs II. bezeichnete. Nach der Rückkehr in die Berliner Garnison rezipierte ihn 1772 die Loge Zum flammenden Stern, eine am 23.12.1771 gegründete Filiale der Bauherrenloge der Verschwiegenheit der Freunde freier Künste und schönen Wissenschaften, wählte ihn am 2.5.1772 zum Sekretär und beförderte ihn am 29.6.1773 auf den VI. Grad, womit er dem Inneren Orden angehörte. Das kurzlebige Afrikanische Freimaurersystem zerfiel 1774. Die meisten Afrikaner traten in andere Logen ein, allein 43 in die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland, Eckenbrecher am 13.10.1774 in deren Filiale Zum goldenen Schiff, gleichsam eine Militärloge mit allein 13 Artilleristen. Die Neumitglieder mußten eine maurerische Degradierung hinnehmen, Eckenbrecher die Zurückstufung zum Lehrling. Indes beförderte ihn die Loge noch an zwei aufeinanderfolgenden Tagen des Aufnahmejahres, am 11.10.1774 und 12.10.1774, zum Gesellen und Meister und wählte ihn am 11.3.1776 zum 2. Aufseher. Nach dem Bayerischen Erbfolgekrieg kam es in seiner Loge zu Mißverständnissen. Sie suspendierte am 8.3.1780 seine Mitgliedschaft, hob aber am 22.5.1780 die Strafe wieder auf. Eckenbrecher kehrte zunächst nicht in die Loge zurück, sondern suchte erst nach fünf Jahre am 8.10.1785 schriftlich um eine erneute Zulassung nach. Die Loge ballotierte mit einer schwarzen Kugel abschlägig, die der Logenmeister indes als nichtig erklärte, worauf er wieder in die Loge eintrat, deren Mitglied er bis zu seinem Tod 1822 blieb. Eckenbrecher wurde 1777 zum Premierleutnant und 1782 zum Kapitän und Kompaniechef im 3. Artillerieregiment in Berlin am Schiffbauerdamm befördert, nahm 1787 am Feldzug in Holland, in dem er nobilitiert und mit dem Orden Pour le mérite ausgezeichnet wurde, und 1792-1794 am Ersten Koalitionskrieg teil. Nach seiner Rückkehr in die Berliner Garnison wählte das Große Ordens-Kapitel „Indissolubilis“ Eckenbrecher am 15.10.1793 zu ihrem Mitglied und beförderte ihn am 10.6.1802 zum Ritter vom Osten und am 9.1.1813 zum 1. Ritter Unteraufseher. Er engagierte sich ab 1794 in der Maurerischen Lesegesellschaft. Eckenbrecher stand in den zehn Friedensjahren nach dem Basler Frieden 1796-1801 beim Observationskorps in Westfalen, avancierte 1797 zum Oberstleutnant, 1801 zum Kommandeur des 1. Artillerieregiments und 1804 als Oberst (1803) zum Kommandeur der Reitenden Artillerie unter dem Commandeur en Chef → Heinrich Christoph Ernst v. Hüser (1805/06). Im Vierten Koalitionskrieg machte Eckenbrecher die verlustreiche Schlacht bei Preußisch Eylau (7./.8.2.1807) zwischen der russischen Armee und der Grande Armée Napoleons mit, für die er den russischen Stanislaus-Orden verliehen erhielt. Nach seinem Abschied am 7.5.1809 im Range eines Generalmajors verbrachte er seine letzten Lebensjahre auf dem Rittergut Gutenpaaren im Havelland, das er am 15.6.1805 gekauft hatte. Das zweigeschossige Gutshaus, ein Fachwerkbau von Anfang des 18. Jahrhunderts, steht unter Denkmalschutz.
Edward August, Prinz von England, 1765 Earl of Ulster, Duke of York and Albany (Albanien) (25.3.1739 London-17.9.1767 Monte Carlo/Monaco), V Friedrich Ludwig Prinz von Wales, M Augusta von Sachsen-Gotha-Altenburg.
Bruder:
Georg III., 1760-1801 König von Großbritannien und Irland, Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg, 1814 König von Hannover
Die Berliner Loge L'Amitié nahm Prinz Edward August auf Vorschlag des schwedischen Gesandten Graf v. Bohlen und dessen Adjutanten Colonel St. John im Hause ihres Logensekretärs → Adolf Flesche, Privatsekretär Amalias Prinzessin von Preußen, am 27.7.1765 in den ersten drei Graden auf. Sie ernannte ihn am 2.8.1765 zum Protektor der Loge, die daraufhin mit seiner Erlaubnis ihren Namen änderte in La Loge Royale d’York de l’Amitié. Der Prinz war 1767 in England Past Grand Master.
Effenbart II, Hermann Gottfried (4.4.1723 Stettin-17.6.1784 Stettin), V Hermann Gottfried Effenbart I (1673 Helmstedt-25.12.1746 Stettin), 1708-1710 in Greifswald Gehilfe der Buchdruckerei des hinterpommerschen Gerichtsadvokaten Samuel Höpfner († 1697), dessen Tochter er heiratete, 1710-1746 Ratsbuchdrucker in Stettin, M Katharina Elisabeth geb. Höpfner, ∞ Johanna Friederica Spiegel,
Söhne:
August Herrmann Gottfried Effenbart († 1793), Justizkommissar, 1781/1784 und 1791-1793 Steward der Stettiner Loge Zu den drei Zirkeln
Hieronymus Georg Effenbart (1762?-1800),1781/1784-1800 Mitglied der Stettiner Loge Zu den drei Zirkeln, 1784-1800 in Stettin Besitzer der Buchdruckerei der Regierung und der Kriegs- und Domänenkammer sowie deren Privilegs, nach seinem Tod übernahm seine Witwe Ulrike Effenbart geb. Matthias († 1838) 1800-1805 die Geschäftsführung der Buchdruckerei
Hermann Gottfried Effenbart, in Stettin kgl. preußisch-pommerscher Regierungs- und Kriegs- und Domänenkammer-Buchdrucker, erhielt am 28.8.1755 (1765 für die Familie) das landesherrliche Privileg zum Druck der herrschaftlichen Sachen und Zeitungen. Er druckte neben den amtlichen Sachen wissenschaftliche Werke, dessen bedeutendstes die Ausführliche Beschreibung des Preußischen Vor- und Hinterpommerns (1779-1784) von Ludwig Wilhelm Brüggemann (1743-1817) war. Die Loge De la parfaite Union nahm Effenbart am 4.12.1764 auf und ernannte ihn zum Schatzmeister. Er war am 12.12.1764 Mitgründer der Loge Zu den drei Zirkeln (GNML3W), die ihn 1772 zum 2. interimistischen Aufseher und 1774, nunmehr im V. Grad, zum Almosenpfleger wählte. Er war mit dem Berliner Hofbuchdrucker → Georg Jakob Decker befreundet, dessen gleichnamiger Sohn → Georg Jakob Decker bei ihm konditionierte. Nach seinem Tod führten die Witwe, die beiden Söhne und die Tochter Beate Friederica Effenbart gemeinschaftlich die Buchdruckerei Hermann Gottfried Effenbart Familie weiter.
Egerland, Johann Friedrich (1729? Kammin/Vorpommern-Frühjahr 1790).
Johann Friedrich Egerland begann nach dem Jurastudium 1747-1749 in Halle 1751 seine berufliche Karriere als Advokat am Kammergericht in Berlin, wo am 1.5.1769 → Johann Christian Anton Theden den 40-jährigen Juristen seiner Loge Zur Eintracht vorschlug, die ihn am selben Tag als Lehrling aufnahm und im selben Jahr zum Gesellen (1.8.1769) und zum Meister (13.9.1769) beförderte. Er erhielt am 16.8.1770 den IV. Grad des Schottenmeisters der altschottischen Loge Friedrich zum goldenen Löwen. Die Johannisloge wählte ihn zum 2. Vorsteher (bis 18.2.1776). Friedrich II. ernannte Egerland 1775 zum 1. Bürgermeister und Justizdirektor im Magistrat der Haupt- und Residenzstadt Potsdam. Die Loge ehrte den Verstorbenen am 25.10.1792 in einer Trauerloge.
Ehrenreich, Johann Eberhard Ludwig (1723 Ludwigsburg/Herzogtum Württemberg-8.1.1803 Gumbinnen/Ostpreußen), V Johannes Matteus Ehrenreich, ∞ 1747 Maria Eleonore Zelius (* 1719).
Johann Ehrenreich studierte1747 in Stockholm Medizin, Chemie und Naturwissenschaften. Frederik I. König von Schweden ernannte den gewinnenden und beredten, unternehmenden und vielseitig gebildeten Sanguiniker zu seinem Leibarzt und verlieh ihm den Titel Hofrat (22.12.1766). Ehrenreich gründete 1759 in Marieberg auf der Stockholmer Insel Kungsholm eine Fayencefabrik, die bis 1766 in seinem Besitz war, wonach er sich im selben Jahr in Schwedisch-Pommern in die Stralsunder, in der Tribseer Straße gelegene Fayencemanufaktur des schwedischen Armeelieferanten, Bankiers und Kammerrats Joachim Ulrich Giese (1719 Stralsund-1780) einkaufte. Giese hatte 1754 die Insel Hiddensee erworben, deren Tonvorkommen er für seine Manufaktur (Konzession des Stralsunder Stadtrats vom 19.9.1755) ausbeutete. Ehrenreich brachte 40 Dreher, Maler und andere Handwerker sowie einen Pastor mit und nahm Kapitalien bei den Klöstern Stralsunds und bei den Landständen auf. Die Manufaktur erlebte eine neue Blüte und entwickelte sich zu einer der größten Keramikmanufakturen im Ostseeraum. Sie beschäftigte 1769 77, indes mangelhaft entlohnte Arbeiter, unter ihnen viele zehn- bis zwölfjährige Kinder ― die damals höchste Beschäftigtenzahl in Stralsund. Die Manufaktur produzierte hochwertige Fayencen mit Rokokomalereien, von denen die Museen in Stralsund, Greifswald, Lübeck, Stockholm, Kopenhagen Einzelstücke besitzen. Absatzschwierigkeiten, die aufwendige Produktion, zudem am 12.12.1770 die Explosion des Köpkenturms am Tribseer Tor mit den Werkstätten, die einen Großteil der Manufaktur zerstörte, führten zum Konkurs. Die Zahl der Beschäftigten ging auf 22 zurück, welche der Unternehmer zeitweise statt mit Geld mit Produkten der Manufaktur entlohnte. Ehrenreich hielt sich zum Zeitpunkt des Unglücks im polnischen Danzig auf, wo er mit einem Schutzmittel gegen die Pest experimentierte. Er amtierte dort, sicher ein langjähriger und erfahrener Freimaurer im Meistergrad, als Meister der Loge Zu den drei Sternen; vermutlich ist er bereits in Schweden Freimaurer geworden. Der fallierte Unternehmer ging nach Königsberg, wo er am 4.8.1775 Grundstücke auf dem vorderen Roßgarten 5 für die Anlage einer Fayencefabrik kaufte. Ehrenreich trat der Loge Zum Totenkopf und 1776 der im Vorjahr gegründeten zweiten Königsberger Zinnendorf-Loge Phönix bei, die ihn am 9.11.1776 als Nachfolger des Logengründers Premierleutnant → Alexander Georg v. Bronsart zum Logenmeister wählte (bis 9.1.1778). Ehrenreich nahm in Königsberg Anleihen auf, unter anderen 10 000 Rtl bei dem 25-jährigen Königsberger Kaufmann Kade und bei dem Akzisedirektor Stockmar, beide Freimaurer.
Wilhelm Gustav Kade (etwa 1759-etwa 1789) erwarb nach dem Konkurs des Königsberger Unternehmers → Friedrich Franz Saturgas dessen Stammhaus,das die Witwe Kade 1789 an Robert Motherby (1736 Hull-1801), Teilhaber von Joseph Green in der Firma Green, Motherby & Co. und befreundet mit Immanuel Kant, verkaufte. Kade war spätestens 1771 und vermutlich bis zu seinem Tod Mitglied der Loge Zu den drei Kronen, für deren Logenhaus er 1771 ein Darlehen gab.
Karl Christoph Wilhelm Stockmar (um 1740-nach 1812) aus Pfalz-Zweibrücken, 1774 Akzise-, Lizent- und Zolldirektor in Königsberg, 1786 Provinzialdirektor und Kriegs- und Domänenrat (1789) mit dem Titel Geh. Kriegsrat, a. 1774 Königsberg von der Loge Zum Totenkopf (GLL), 1775 Mitgründer der Schwesterloge Phönix, abgeordneter Logenmeister, deckte 1801/02 die Loge.
Friedrich II. gewährte Ehrenreich 1776 einen staatlichen Zuschuß von 6000 Rtl. Der Unternehmer gab zudem im August 1777 Aktien im Gesamtwert von 50 000 Rtl aus, von denen aber nur 175 gezeichnet wurden. Die Manufaktur produzierte Zier- und Gebrauchsstücke für den Massenbedarf, Fayencen, Steingut, irdene Waren. Das Fabrikzeichen waren ein H (für Hofrat) und E (für Ehrenreich). Die finanziellen Verpflichtungen überschritten letztlich die Leistungskraft des Unternehmens. Der Bankrott 1787/88 zog mehrere Gläubiger in den Ruin, unter ihnen den Hauptgläubiger, den 20-jährigen
Friedrich Wilhelm Ernst v. Buddenbrock, Leutnant im Dragonerregiment Nr. 8 v. Bardeleben, 1799 Mitglied der Loge Zum preußischen Adler in Insterburg, III. 4.9.1800, 1802/1803 1. Steward.
Ehrenreich schrieb das Grundstück zum Verkauf aus, das schließlich de Buvry pachtete.
Louis Jacques Erhard de Buvry, 1789 in Tilsit Provinzialakzisekontrolleur a. D., 1778-1792 in Königsberg Mitglied der Loge Phönix (GLL).
Ehrenreichs Sohn Daniel, ein früherer schwedischer Leutnant, verkaufte am 6.11.1789 das Grundstück an den Königsberger Kaufmann
Friedrich Johann Anton Dornheim, a. 1782 in Königsberg von der Loge Zum Totenkopf (GLL), II. 1783, III. 1783/84, 24.3.1784-29.3.1785 Zeremonienmeister, 1785/19.3.1788 2. Aufseher, 1790-1794 Festungshaft, 1790 von der Loge wegen unmaur. Handlungen ausgeschlossen, zahlte am 21.11.1794 die von ihm geschenkten 1000 fl zurück, um ihn zu unterstützen.
Ehrenreich zog nach dem Bankrott 1792 nach Gumbinnen, blieb aber bis zu seinem Tod Mitglied der Königsberger Loge. Er schrieb Über die jetzt so gangbare Viehpest und Mittel zur Tilgung (1778). (Riesebieter: Die deutschen Fayencen; Stöhr: Deutsche Fayencen)
Eisenberg, Friedrich Philipp (25.11.1757 Treptow a. d. Rega/Hinterpommern-6.3.1804 Berlin), V Johann Albrecht Christian Eisenberg, Maître d’hôtel im württembergischen Mömpelgard (Montbéliard, 1769 Residenz Friedrich Eugens von Württemberg, des Vaters von → Eugen Friedrich Heinrich Herzog von Württemberg-Stuttgart), um 1800 in Frankfurt (Oder), M Sophie Dorothee geb. Haßlingen (1734?-April 1802 Frankfurt/Oder), ∞ N. N. Bettführ,
Tochter:
Dorothee Henriette Eisenberg (* 30.11.1787) ∞ um 1807 Hans Heinrich Arnold v. Beeren († 1812), Gutsherr in Großbeeren (Geist von Beeren, in: Fontane: Wanderungen, IV. Teil Spreeland).
Friedrich Philipp Eisenberg studierte Jura 1775 in Straßburg und 1776 in Halle, begann seine berufliche Karriere 1779 als Referendar am Berliner Stadtgericht, war 1780/81 geheimer Sekretär des → Prinzen Eugen Friedrich Heinrich von Württemberg-Stuttgart, kehrte 1781 in den preußischen Staatsdienst als Referendar bei der neumärkischen Regierung in Küstrin zurück. Das erste bekannte maurerische Datum ist der 19.3.1781, als die Berliner Loge Zur Verschwiegenheit (GNML3W) ihn zum Gesellen beförderte. Sie erteilte ihm am 20.3.1783 den Meistergrad. Er hatte 1784, nunmehr im Schottengrad, neben → Abel Marot das Redneramt. Eisenberg legte im selben Jahr erfolgreich das große Examen ab und wurde als Assessor cum voto bei der neumärkischen Regierung in Küstrin angesetzt, wo er Mitglied der Loge Friedrich Wilhelm zum gekrönten Zepter und 1787/88 deren deputierter Meister wurde. Er befreundete sich in der Loge mit dem Akzisesekretär → Hans v. Held. Eisenberg wurde am 22.12.1786 nach Berlin als Assistenzrat an das Kammergericht (Instruktionssenat) versetzt und am 10.5.1787 zum Kammergerichtsrat der 1. Klasse befördert. Er trat in seine frühere Loge Zur Verschwiegenheit zurück, die ihn am 8.10.1788 zum deputierten Meister wählte (bis 25.1.1796). 1801 ernannte ihn die Große National-Mutterloge zum Mitglied mit Sitz und Stimme. Der juristisch und literarisch hoch gebildete Eisenberg schrieb für die von → Ernst Ferdinand Klein ab 1788 herausgegebenen Annalen der Gesetzgebung und Rechtsgelehrsamkeit in den Preußischen Staaten (bei → Friedrich Nicolai: Berlin/Stettin) und für das von → Johann Wilhelm Bernhard v. Hymmen ab 1790 herausgegebene Repertorium über die Beiträge der juristischen Literatur in den preußischen Staaten. Er übersetzte das Allgemeine Landrecht für die Preußischen Staaten ins Lateinische, bestimmt für die Verbreitung in den neuen polnischen Provinzen, für die Friedrich Wilhelm II. ihm 1797 ein (nicht vererbbares) Gratialgut in Südpreußen schenkte. Er war von Mai 1792 bis 1804 Mitglied des Berliner Montagsklubs und ab 1793 Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft in Königsberg. Friedrich Wilhelm II. bestallte Eisenberg am 29.10.1794 als Polizeidirektor und Stadtpräsident von Berlin, als der er die Direktion der Berliner Armenanstalten hatte, 1795 mit dem Titel Geh. Kriegsrat. König, Minister und Gouverneur → Wichard v. Möllendorff beanstandeten indes seine Amtsführung. Er wurde im August 1802 für sechs Wochen nach Tharandt beurlaubt, erkrankte Ende 1803. Die Amtsgeschäfte des Polizeidirektors führte zunächst der Stadtsyndikus Johann Georg Friedrich Köls (1759-1834), 1804 Berliner Bürgermeister, und 1804 Johann Stephan Gottfried Büsching (1761-1833), am 10.5.1804 Nachfolger Eisenbergs als Stadtpräsident von Berlin und 1813-1832 Oberbürgermeister. Eisenberg starb 1804 erst 47 Jahre alt an einer Brust- und Nervenkrankheit. Die Große National-Mutterloge zu den drei Weltkugeln gedachte 1804 ihres verstorbenen Ehrenmitglieds (1802) in einer Trauerloge.
Elitzsch, Johann Friedrich (21.9.1754 Halle/Saale-26.2.1823 Berlin nach einem Schlaganfall am 24.2. in der Loge), V Johann Gabriel Elitzsch.
Johann Friedrich Elitzsch, Diener des Magdeburger Regierungsrats Rudolf v. Bünau (1740-1798), wurde am 23.9.1778 von der Loge Zu den drei Kleeblättern (GLL) in Aschersleben als dienender Bruder aufgenommen und am 5.11.1779 zum Gesellen befördert. Die Loge erwartete von ihm, dem dienenden Bruder, besondere Qualitäten, Gehorsam gegen die Logenoberen, Unverdrossenheit in seinen Logenpflichten und Verschwiegenheit. Er galt als ein vertrauenswürdiger Mann, dem man besondere Aufgaben übertragen konnte, so die eines mit den Logeninterna vertrauten Kopisten. Sie bezahlte ihn ab dem 8.9.1778 für das, was er für die Loge schreiben würde, nach der Billigkeit, über das hinaus, was einem dienenden Bruder zukomme. Elitzsch bekam 1784 in Berlin vermutlich mit der Fürsprache seines Logenmeisters, des Oberbergrichters → Johann August Friedrich Kleemann, der seine berufliche Karriere in der Bergwerks- und Hüttenadministration begonnen hatte, eine Anstellung als geheimer Kopist der Oberbergkanzlei. Elitzsch eignete sich die nötigen Fachkenntnisse an und stieg noch im selben Jahr zum Geh. Bergkanzleisekretär und Registrator im Bergwerks- und Hüttendepartement auf. Die Ascherslebener Loge entließ ihn am 16.2.1784 zu der Berliner Schwesterloge Zum Pilgrim, die am 26.5.1784 ballotierte und ihn als Vollmitglied aufnahm. Sie beförderte den 32-Jährigen am 19.3.1787 zum Meister. Elitzsch war wie → Pierre Dieu einer der wenigen Freimaurer, die vom dienenden Bruder zum Vollmitglied aufstiegen. Er wurde 1787 als Geheimer Sekretär zur Königlichen Porzellanmanufaktur, der KPM (bis 1809), versetzt, avancierte zudem 1801 zum Kanzleidirektor und 1805 zum Geheimen Kanzleidirektor der Generalverwaltung für das Salz-, Berg- und Hüttenwesen. Die Loge Zum Pilgrim wählte ihn in wichtige Führungsämter, am 1.11.1787 und 1.11.1788 sowie am 25.2.1795 zum Schatzmeister (bis 1797), am 2.11.1789 zum Sekretär (bis 1794), am 26.2.1801 zum 2. Aufseher (bis 1805/06) und am 27.2.1809 erneut zum Sekretär (bis 1811/12). Er wurde Mitglied der höheren Erkenntnisstufen − am 17.5.1799 der Andreasloge Indissolubilis und am 1.12.1802 des Großen Ordens-Kapitels „Indissolubilis“, das ihn am 20.3.1810 zum Ritter vom Osten und am 24.4.1813 zum Unterschatzmeister beförderte und am 5.10.1814 Schatzmeister wählte. Die Große Loge ernannte ihn am 13.6.1801 (bis 1811/12) zu ihrem Repräsentanten bei der Provinzialloge von Pommern, der Uckermark und Neumark in Stettin. Er war ab 1804 Mitglied des Maurerischen Leseinstituts. Die Loge ehrte den Verstorbenen am 24.3.1823 in einer Allgemeinen Trauerloge. Er sei eines der ältesten, erfahrensten und eifrigsten Glieder unser Verbindung (gewesen), der mit rastloser Tätigkeit in den meisten Logenämtern und als Repräsentant mehrerer unsrer Tochterlogen, auch sonst vielfach zum Besten des Ordens gewirkt und sich große Verdienste um denselben erworben hat, dabei ausgezeichnet als Mensch wie in allen seinen Verhältnissen.
Ellisen, Georg David Johann (1817) v. (22.8.1756 Blankenburg/Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel-Oktober 1830 St. Petersburg), V Heinrich Georg Ellisen (1696?-1756?), Ratskämmerer in Blankenburg, M Katharina Augusta Christiana geb. Böttcher, ∞ 1. Eva Maria Bock, 2. Elisabeth Angely, 3. Amalie Karoline Barenka aus Riga,
Schwester:
Karoline Ellisen (1761-1811) ∞ Wilhelm Lerche (1761-1816), Pfarrer in Trautenstein am Harz,
ihr Sohn:
Theodor Heinrich Wilhelm v. Lerche (1836 russischer Erbadel) (1791 Trautenstein-1847 St. Petersburg) trat 1815 in den russischen Staatsdienst, 1824-1847 Direktor der Augenheilanstalt in St. Petersburg, Leibokulier des kaiserlichen Hofes, 1815?-1817 Mitglied der Loge Peter zur Wahrheit in St. Petersburg, 1815 Mitstifter des Engern Geschichtlichen Bundes, 1818 in Reval Mitglied der Loge Isis, Repräsentant bei der Großen Loge Asträa in St. Petersburg.
Georg David Johann Ellisen besuchte das Gymnasium in Schöningen und immatrikulierte sich am 13.9.1775 an der medizinischen Fakultät in Helmstedt. Das erste sichere Datum als Freimaurer ist der 1.3.1779, das Datum seiner Annahme durch die Berliner Loge Zum Widder (GLL), die ihn bereits am 11.11.1779 wieder strich ohne Zertifikat, also ohne den Ausweis seiner Aufnahme als Freimaurer. Er war 1781 Mitglied der irregulären Hildesheimer Loge (Ferdinand) Zum Tempel, die ihn vermutlich 1785 zum Gesellen und Meister beförderte. Ellisen praktizierte nach der Promotion zum Dr. med. als Arzt in Hoya an der Weser. Er erhielt 1786 auf Empfehlung des berühmten, von Katharina II. nobilitierten Arzt Johann Georg Ritter v. Zimmermann (1728-1795) eine Arztstelle in Kiev (noch 1791?). Er gründete dort 1788 die Loge Zu den drei Säulen, die er als Logenmeister führte. Noch im selben Jahr erhielt er eine Professur am Medizinisch-Chirurgischen Institut in St. Petersburg, wo er zudem 1795-1797 als Stadtarzt amtierte, 1797 mit dem Titel Hofrat und 1800 als Kollegienrat. Er wurde 1803 zum Mitglied des medizinischen Kollegiums, 1806 zum medizinischen Beirat des Innenministeriums (bis 1823) und zum Oberarzt im Obuchovskij-Krankenhaus sowie 1805 zum Staatsrat und 1817 zum Wirklichen Staatsrat (mit erblichem Adel) ernannt. Er veröffentlichte zahlreiche medizinische Schriften. Ellisen gründete (1807?) mit → Ignaz Aurel Feßler in St. Petersburg das Ordenskapitel Polarstern, das den Mathematiker und liberalen Reformer Michail Michajlovič Graf v. Speranskij (1772-1839), einen Vertrauten Kaiser Alexanders I., aufnahm. Er trat 1809 der Loge Alexander zum gekrönten Pelikan bei, gründete 1810 die Loge Peter zur Wahrheit, die er bis 1820 als Meister vom Stuhl leitete (zuletzt Ehrenmeister), war Mitglied der Andreasloge St. Georg, 1811-1814 des Ordenskapitels Phönix, stiftete den Engeren geschichtlichen Bund bei der Loge Peter zur Wahrheit, deren vorsitzender Meister er war, und 1817 den Verein der Vertrauten Brüder Freimaurer in St. Petersburg. Er war schließlich Ehrengroßmeister der Großloge Astraea, außerdem Ehrenmitglied mehrerer Logen, so der Loge Absalom zu den drei Nesseln in Hamburg, der ersten deutschen Loge, der Loge d’Hambourg. (Wistinghausen: Freimaurer und Aufklärung, III, 76, 176f.; zu Speranskij s. Erich Donnert, in: Freimaurerische Persönlichkeiten)
Elsner, Christoph Friedrich (14.1.1749 Königsberg/Pr.-19.4.1820 Königsberg), V Friedrich Oelsner, Bäckermeister, M Barbara Elisabeth geb. Berg, ∞ Barbara Preuß.
Christoph Friedrich Elsner besuchte das Collegium Fridericianum in Königsberg, studierte ab 1766 Mathematik und Medizin an der Albertina und promovierte 1774 zum Dr. med. Er hielt sich kurze Zeit in Berlin auf, ließ sich als Arzt im ostpreußischen Bartenstein nieder, einer Stadt von 2780 Einwohnern (1785) und der Garnison des Infanterieregiments Nr. 14, und wurde zum Physikus im Kreis Bartenstein berufen. Elsner erhielt 1785 eine ordentliche Professur an der medizinischen Fakultät der Universität Königsberg, wo ihn 1788 die Loge Zu den drei Kronen aufnahm. Sie übertrug ihm 1791 als Bibliothekar die Leitung der Logenbibliothek. Er trat 1800 aus Protest gegen das Edikt wegen der geheimen Verbindungen (1798) aus der Loge aus. Elsner wurde 1805 zum ersten ordentlichen Professor berufen, amtierte in den Wintersemestern 1791/92, 1795/96, 1799/1800, 1803/04, 1807/08 als Rektor und 1811/12 als Prorektor der Albertina, wurde zum Medizinalrat und 1809 zum Regierungsrat ernannt. Er verfaßte zahlreiche medizinische Abhandlungen, so Ein Paar Worte über die Pocken und über die Inoculation derselben gelegentlich niedergeschrieben (bei Gottl. Lebrecht Hartung: Königsberg 1787), Über die Verhältnisse zwischen Arzt, dem Kranken und dessen Angehörige (Königsberg 1794), Bericht über den Gesundheitszustand des Königsreichs Ostpreußen und Lithauen im Jahr 1801 (Königsberg 1802). Elsner war der Arzt Immanuel Kants in dessen letzten Lebensjahren. Er gehörte als Besucher der letzten Geburtstagsfeier Kants zu denen, die William Motherby am 22.4.1805 einlud und mit denen dieser die Gesellschaft der Freunde Kants gründete.
Ephraim, Veitel Benjamin (10.1.1742 Berlin-16.12.1811 Berlin), V Nathan Veitel Heine (Chaim) Ephraim (1703-1775), Münzunternehmer, Bankier, Hoffaktor, Hofjuwelier, 1750 Oberältester der Berliner Judenschaft, 12.1.1761 Designation der generalprivilegierten Juden, so iura Christianorum zu exerzieren das Recht haben, gründete 1762 die Gold- und Silbermanufaktur in Potsdam, war Münzjude Friedrichs II., Namensgeber der Ephraimiten, M Elkele geb. Fränkel (1703-1769), ∞ Amsterdam 1761 die 18-jährige Holländerin Jeannette Gutsche Philip (1743-1812),
Tochter:
Jeannette (Janny) Sophie Ephraim (1764-1843), die Jugendliebe Karl Friedrich Zelters, ∞ den Arzt und späteren hannoverschen Obermedizinalrat Johann Stieglitz
Brüder:
Veitel Ephraim (1729-1798?), Hofjuwelier
Joseph Veitel Ephraim (1731-1786), Bankier
Zacharias Ephraim (1736-1779), Bankier
Schwester:
Rosel Veitel Ephraim (1738-30.1.1803) ∞ 1 Aron Moses Meyer,
ihre Tochter:
Sara Meyer (1762-1828) ∞ → Jakob Isaak Benjamin Wulff
Nathan Veitel Heine Ephraim führte seinen Sohn Veitel Benjamin Ephraim nach der Handlungslehre 1757 in seine Münzgeschäfte im preußisch besetzten Leipzig ein, wo Friedrich II. am 5.2.1756 ihm die Leipziger Münze übertragen hatte. In Kopenhagen, wohin der Vater und Sohn nach der verlorenen Schlacht bei Kolin (18.6.1757) geflohen waren, setzte er dessen kaufmännische Ausbildung fort. Gegen Kriegsende übertrug er ihm die Leitung seines Handelshauses in Amsterdam, wo Benjamin Ephraim heiratete und vermutlich Freimaurer wurde. Als das junge Ehepaar im Sommer 1761 die Eltern in Berlin besuchte, hielt er eine vor dem Maurerischen Tribunal verheimlichte Rezeptionsloge. Das Tribunal untersuchte die illegitime Loge und wollte die Teilnehmer maurerisch bestrafen. Die Sache verlief jedoch im Sande, wohl wegen des Ansehens des Vaters beim König, vielleicht auch, weil die jungen Eheleute bald nach Amsterdam zurückkehrten, nachdem Veitel Benjamin Ephraim von seinem Schwiegervater für 600 Gulden die Silberschmelzhütte in Muiden/Nordholland (Verkauf 1773 für 4000 Gulden) gekauft hatte. Er korrespondierte mit Moses Mendelssohn und Gotthold Ephraim Lessing, die in dem Berliner Elternhaus Spandauer Straße 30 verkehrten und seine moralische und aufgeklärte Bildung prägten, erwarb in Holland Gemälde, den Grundstock seiner bedeutenden Gemäldesammlung, übersetzte aus dem Französischen und schrieb, angeregt von Oliver Goldsmiths Roman Der Landpfarrer von Wakefield, Worthy, ein Drama in fünf Aufzügen (gedruckt von Jobst Hermann Flörke in Danzig), das Karl Theophil Döbbelin am 16.5.1776 in seinem Theater in der Behrenstraße aufführte (mit zwei Wiederholungen). Friedrich II. bestallte Ephraim 1763 als Generalsyndikus der polnischen Judenschaft in Breslau. Zudem erteilte er ihm 1763/64 auf dessen Vorschlag hin die Konzession zum Bau einer Silberraffinerie in Berlin am Mühlendamm (1765/66 am Schiffbauerdamm). 1768 kehrte die Familie nach Berlin zurück. Sie wohnte vermutlich von Anfang an im väterlichen Haus Poststraße 16 am Molkenmarkt, dem Ephraim-Palais, das Veitel Heine Ephraim 1762 von dem Kriegszahlmeister Friedrich Gotthold Köppen, dem Vater → Karl Friedrich Köppens, gekauft und von dem Baumeister Friedrich Wilhelm Diterichs (1702-1782) im Rokokostil zu einem der schönsten Häuser Berlins hatte umbauen lassen. Benjamin Ephraim brachte hier seine Gemäldesammlung (Michelangelo Merisi da Caravaggio u. a.) unter. Seine Frau und seine Töchter unterhielten in Haus und Garten eine aufgeklärte jüdische Gesellschaft (Salon) jüdischer und christlicher Gäste, unter ihnen Karl Friedrich Zelter, Moses Mendelssohn, Daniel Chodowiecki, → Johann Abraham Peter Schulz, Johann Friedrich Reichardt, → Heinrich Wilhelm v. Stamford. Ephraim trat in Berlin weder der 1782 gegründeten, Juden wie Christen offenen Loge zur Toleranz. bei noch den Gesellschaften seines Freundes → Ignaz Aurelius Feßler, der Mittwochsgesellschaft oder der Gesellschaft der Freunde der Humanität. Er übernahm 1770 von seinem Vater die Brabanter Kantenklöppelei in der Heiligegeiststraße und 1774 die Kantenklöppelei und Blondenfabrikation des Potsdamer Waisenhauses, das 1785 durch Kabinettsorder das Monopol erhielt, dennoch 1795 die Fabrikation einstellte. Er errichtete in Berlin für die in der Fabrik arbeitenden Kinder eine Freischule. Friedrich II. gab ihm nach der Zweiten Polnischen Teilung weitere Staatsaufträge, so den Kauf von Getreide und Salz sowie die Einfuhr minderwertiger Dukaten in Polen, in die er trotz Bedenken einwilligte, was er später bereute. Nach der preußischen Intervention 1787 in Holland agierte er in Brabant diplomatisch erfolgreich für Preußen. Ephraim knüpfte durch → Hans Rudolf v. Bischoffwerder, in dessen Haus er ein und ausging, mit dem Thronfolger Friedrich Wilhelm (II.) finanzielle Beziehungen. Dieser beauftragte ihn am 27.7.1790 in Breslau mit der geheimen Mission, in Paris die Lage des französischen Handels zu erkunden und eine Allianz Preußens mit Frankreich vorzubereiten. Die Geheimmission scheiterte vor allem daran, daß der König sich mit Kaiser Leopold II. gegen das revolutionäre Frankreich verbündete, während Ephraim zur Friedenspartei stand und ein gutes Verhältnis Preußens zu Frankreich befürwortete. Ephraim wurde nach dem Beginn des Vierten Koalitionskrieges am 23.9.1806 als angeblicher französischer Spion verhaftet und in der Berliner Hausvogtei, dann in der Festung Küstrin inhaftiert. Er schrieb hier seine autobiografische Verteidigungsschrift Über meine Verhaftung und einige andere Vorfälle meines Lebens (Berlin 1807, 2., vermehrte Auflage Dessau 1808). Der Krieg sowie die Verhaftung ruinierten ihn. Seine Firma machte 1809 Konkurs. Ephraim starb zwei Jahre später. Er wurde in Berlin auf dem Alten jüdischen Friedhof in der Großen Hamburger Straße beigesetzt, auf dem auch sein Vater, Moses Mendelssohn und → Marcus Herz begraben sind. (Steiner: Drei preußische Könige)
Ernest, Johann Wilhelm v. (17.6.1741 Bern/Schweiz-26.1.1817 Berlin, Grab in Berlin auf dem Invalidenfriedhof), V Beat Ludwig v. Ernest (1694-1749), Landarzt in Milden/Kanton Waadt, souveräner Rat zu Bern, M Maria geb. Fels (1709-1793), ∞ Magdeburg 1789 Johanna Dorothea Charlotte Resewitz (26.6.1763-22.9.1833,
ihr Vater
Friedrich Gabriel Resewitz [1729 Berlin-1806 Buckau], M Charlotte geb. Godeffroy,
aufgeklärter Theologe, Rationalist, 1767 Prediger der St. Petri-Kirche in Kopenhagen, 1775-1805 Abt des Klosters Berge, 1775-1796 Leitung des Paedagogiums und des Lehrerseminars, Generalsuperintendent des Herzogtums Magdeburg, befreundet mit Friedrich Gottlieb Klopstock, bekannt mit Moses Mendelssohn, → Friedrich Nicolai, Rezensent der Neuen Deutschen Bibliothek.
Johann Wilhelm v. Ernest begann seine militärische Laufbahn 1760 in der britischen Armee, nahm an der Belagerung von Gibraltar teil, wechselte 1770 im Range eines Sekondeleutnants zur holländischen Schweizer Garde und 1774 zur österreichischen Armee, avancierte 1778 zum Kapitän, kämpfte im Bayerischen Erbfolgekrieg 1778/79 gegen Preußen. Er wurde 1785 als Major (1784) aus braunschweigischen Diensten entlassen. Friedrich II. übernahm Ernest am 17.12.1786 im selben Rang in das neue Leichte Infanterieregiment Nr. 3, das Schweizerregiment, das 1787 in Magdeburg in die Füsilierbataillone Nr. 18, 19 und 20 aufgelöst wurde. Er avancierte 1787 zum Chef des Füsilierbataillons Nr. 19, zog 1792-1794 in den Ersten Koalitionskrieg gegen das revolutionäre Frankreich, avancierte 1793 zum Oberstleutnant und erhielt 1794 den Orden Pour le mérite. Ernest befehligte 1798 als Brigadier im Range eines Obersten (1795) die Magdeburger Füsilierbrigade und 1803 im Range eines Generalmajors (1800) in Emmerich die westfälische Füsilierbrigade. Er nahm 1806 am Vierten Koalitionskrieg teil. Er erhielt 1813 seinen Abschied. Wann und wo Ernest Freimaurer wurde, ist nicht ermittelt. Die Loge Pax inimica malis in Emmerich führte ihn vom 24.6.1800 bis 1805 als Ehrenmitglied. Ernest schlug ihr am 3.8.1800 zwei Leutnants des Husarenregiments Nr. 8 v. Blücher zur Aufnahme vor:
Philipp Friedrich Ferdinand v. Arnim (6.10.1772 Brandenstein/Fürstentum Halberstadt-8.9.1835 Stolp/Hinterpommern), V Johann August v. Arnim, Landrat zu Genthin, Herr auf Brandenstein, M Wilhelmine Luise geb. v. Schierstedt, 1787 Standartenjunker im Husarenregiment Nr. 8, 1794 Orden Pour le mérite, 1800 Premierleutnant, a. 3..8.1800 Pax inimica malis, II. 20.11.1800, III. 1801, 1805 Stabsrittmeister, 1806 Schlacht bei Auerstedt, bei Lübeck in Gefangenschaft, 1830 Abschied als Generalmajor, Blücher 1804 in der Conduite: „Ein ausgezeichneter Feldsoldat, voller Bravour und Entschlossenheit, exerziert und manövriert vorzüglich und ist vom besten Charakter.“
August Karl Julius v. Manteuffel (18.1.1775 Groß oder Klein Wardin/Pommern-1812 bei Ostrowo/Beresina), V Friedrich Heinrich v. Manteuffel (1743-1825), Kapitän, Erbherr auf Hohenwardin, M Auguste Luise Friederike geb. v. Billerbeck (1752-1806), 1800 Leutnant im Husarenregiment Nr. 8 v. Blücher in Borchen, a. 3.8.1800 Pax inimica malis, II. 20.11.1800, III. 1801, Orden Pour le mérite, 1807 nach einem Unfall Abschied als Rittmeister, 1812 Militärdienst in die Grande Armée Napoleons, im Winter 1812 bei dem Übergang über die Beresina bei Ostrowo verwundet, gefangen genommen und getötet.
Ernst II. Ludwig Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg (30.1.1745 Gotha-20.4.1804 Gotha), V Friedrich III. Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg (1699-1772), M Luise Dorothea geb. von Sachsen-Meiningen (1710-1767), ∞ 1769 Maria Charlotte Amalie von Sachsen-Meiningen (1751-1827).
Ernst, ein liberaler, aufgeklärter, künstlerisch und wissenschaftlich gebildeter Mann, trat 1772 die Herrschaft des Herzogtums an. Er erteilte 1783, vermittelt durch Goethe, dem Maler →Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, dem Goethe-Tischbein, ein Stipendium für dessen zweiten Rom-Aufenthalt. 1786 beauftragte er den österreichischen Astronomen und Geodäten Franz Xaver Zach (1754-1832), auf dem Seeberg bei Gotha ein Observatorium zu errichten, das dieser 1787-1806 zu einem europäischen Zentrum der Astronomie entwickelte. Die Royal Society in London ernannte Ernst II. 1787 zu ihrem Mitglied. Als die Seylersche Schauspielgesellschaft nach dem Theaterbrand in Weimar nach Gotha kam, gründete Konrad Ekhof (1720-1778) am 25.6.1774 die Loge Kosmopolit, die den Herzog aufnahm und zum Logenmeister wählte; die Berliner Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland erteilte ihr am 23.9.1774 ein Patent mit dem Namen Zum Rautenkranz. Johann Wilhelm Kellner v. Zinnendorf, der das Mitglied einer regierenden Familie, einen Mann von hoher Geburt und erhabenem Stand, für die Führung der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland gewinnen wollte, bot Herzog Ernst II. die Großmeisterschaft an, der zustimmte, wenn auch unter Vorbehalt. Die Große Landes-Loge bediene sich, meinte er später, bloß meines Profan-Ansehens, um desto glänzender durch denselben zu scheinen; ich mißgönne ihr denselben keineswegs, sonst so würde ich ja nicht mich haben bewegen lassen, die Würde eines Landes-Großmeisters anzunehmen. Die Große Loge wählte Herzog Ernst II. am 21.6.1775 zum Landesgroßmeister und v. Zinnendorf zum Deputierten, also zu seinem Stellvertreter. Ernst II. führte die Große Landesloge anderthalb Jahre, aber aus der Ferne. Er nahm an keiner ihrer Sitzungen in Berlin teil, beschwerte sich aber, daß die Große Loge ohne sein Wissen Beschlüsse fasse. So konnte keine gedeihliche Zusammenarbeit entstehen. Als er es ablehnte, zwei Schreiben (ein Antwortschreiben an Kaiser Joseph II., eine Verordnung über die Provinziallogen) zu vollziehen, fuhren Zinnendorf und → Karl Alexander Freiherr v. d. Goltz im August 1776 nach Gotha, um den Herzog zu sprechen und alle Mißhelligkeiten auszuräumen, trafen ihn aber nicht an, weil er zu dem Konvent der Strikten Observanz nach Wiesbaden gereist war, ohne die Große Loge über die Reise zu informieren. Er reiste vor Konventschluß ohne Abschied wieder ab, als er begriff, daß der markgräflich badensche Hofrat Gottlieb Franz Freiherr v. Gugomos (1742?-1816), der den Konvent einberufen hatte und behauptete, Abgesandter der unbekannten Obern mit deren Befehl zu sein, den Maurern Heil und Erleuchtung mitzuteilen, ein dummer, elender Betrüger war. Zinnendorf und Goltz kehrten noch vor der Rückkehr des Herzogs unverrichteter Dinge nach Berlin zurück. Der Ton der gegenseitigen Vorwürfe verschärfte sich. Ernst II. beklagte sich bei v. Zinnendorf über den gebieterischen, despotischen und mich dünkt, ganz unmaurerischen Ton. Er wäre keineswegs länger gesonnen ..., einen Schattenkönig vorzustellen. Er legte den ihm so wenig Ehre bringenden Hammer nieder, teilte seinen Rücktritt am 14.1.1777 in einem Rundschreiben allen mit der Großen Landesloge verbundenen Logen mit. Er sei, schrieb er, nicht länger gesonnen, despotischen Grundsätzen und Willkührlichen und Herrschsüchtigen Absichten durch das Ansehen welches mir mein Rang in der Profanen Welt gibt, einiges Gewicht zu geben, und riet den Logen in Gotha (Zum Rautenkranz), Altenburg (Zu den drei Reißbrettern) und Leipzig (Balduin), Konstitutionen und Akten nach Berlin zurückzuschicken. Der Rücktritt des Landesgroßmeisters und sein Aufruf zum Aufruhr stürzten die Große Landesloge der Freimaurer von Deutschland in ihre bisher schwerste Krise. Ernst II. blieb Freimaurer, interessierte sich aber auch für andere Systeme. 1793 nahm ihn sein Hofrat Johann Joachim Christoph Bode (1731-1793), ein aufgeklärter Übersetzer und Verleger, als Novize in den Illuminatenorden auf mit dem Ordensnamen Quintus Severus (auch Timoleon). Er übernahm in dem Orden führende Ämter, so die eines Inspektors von Abessinien (Obersachsen) und eines Coadjutors des Nationaloberen. Als Kurbayern 1784 den Illuminatenorden verbot, gewährte er dem Ordensgründer Adam Weishaupt (1748-1830), Professor für Kirchenrecht in Ingolstadt, in Gotha Asyl. (Köhler, Klinger, Greiling: Ernst II.)
Eschke, Ernst Adolf (17.12.1766 Meißen [oder Merzdorf/Sachsen?]-17.6.1811 Berlin, Grab auf dem Sophienkirchhof, Grabplatte nicht erhalten), luth., V Gottfried Ernst Eschke, ∞ Leipzig 1787 Juliane Karoline Tugendreich Heinicke (1763-1845),
deren Vater
Samuel Heinicke [10.4.1727 Nautschütz-30.4.1790 Leipzig], gründete 1760 in Leipzig das Kurfürstl. Institut für Stumme und andere mit Sprachgebrechen behaftete Personen, Direktor, vertrat Lautiermethode, entwickelte Methode der Gehörlosenpädagogik, ∞ 1. Dresden 1754 Johanna Maria Elisabeth Kracht [† 1775], 2. Hamburg 1778 Anna Katharina Elisabeth Kludt verw. Morin [1757-1840],
Tochter aus 2. Ehe:
Amalie Regina Heinicke ∞ Karl Gottlob Reich [1782-1852], Direktor des Taubstummeninstituts in Leipzig, ihre T Elisabeth Reich ∞ Gotthelf August Eichler [1821-1896], Direktor des Taubstummeninstituts in Leipzig)
Tochter:
Edolfine Wilhelmine Juliane Eschke ∞ Ludwig Graßhoff (1770-1861)
Ernst Adolf Eschke besuchte die sächsische Landesschule Sankt Afra in Meißen, studierte 1782-1785 Jura und Philologie an der Universität Wittenberg und ab 1785 in Leipzig. Dort lernte er, nachdem er auf das Problem der Gehörlosen gestoßen war, Samuel Heinicke kennen und hospitierte in dessen 1778 gegründetem Taubstummeninstitut. Auch nahm er Verbindung auf mit dem philanthropischen Abbé Charles-Michel de l'Epée (1712-1789), der in Paris die Institution Nationale des Sourds-Muets de Paris, die erste Schule für Taube, gegründet hatte. Heinicke riet ihm, nach Berlin zu gehen. Das preußische Oberschulkollegium erteilte Eschke am 2.12.1788 die Approbation, in Berlin in dem Haus Ecke Friedrich- und Leipziger Straße drei taubstumme Kinder zu unterrichten und gewährte ihm ein Jahresgehalt von 150 Rtl. Er verlegte die private Schule 1792 nach Schönhausen bei Berlin (heute Niederschönhausen, Ortsteil von Berlin-Pankow), kehrte 1797 nach Berlin zurück, wo er Schule und Internat in der Linienstraße Nr. 110 (später Nr. 83-85) etablierte. Friedrich Wilhelm III. kaufte 1798 das Grundstück, überließ es aber Eschke zur kostenlosen Nutzung als Kgl. Taubstummeninstitut zu Berlin. Er erhielt, nunmehr Professor und Direktor einer staatlichen Schule, ein Jahresgehalt von 600 Rtl und 1808 den Titel Oberschulrat. Die Loge Zur Beständigkeit (GLL) nahm den 36-jährigen Eschke am 20.7.1802 auf, beförderte ihn am 29.4.1803 zum Gesellen und am 30.1.1804 zum Meister. Sie wählte ihn am 12.10.1804 zum Redner (bis 1809). Er wurde im selben Jahr Mitglied des Maurerischen Leseinstituts. Er blieb bis zu seinem Tod Mitglied der Loge. Eschke stellte 1805 den Berliner Gymnasialprofessor Ludwig Graßhoff (* 1770 Oschersleben) als 1. Lehrer und 1806 den nach einer Scharlacherkrankung völlig ertaubten Karl Habermaß (6.10.1783 Berlin-1806), seinen früheren Schüler, als zweiten Lehrer für Pantomime und Mathematik ein. Grashoff lehrte ab 1809 an der Berliner Universität und übernahm nach dem Tod seines Schwiegervaters 1811 die Direktion des Taubstummeninstituts. Die Schule unterrichtete nach dem ersten Lehrplan von 1810, dem Plan der Studien, Gebärdensprache als Muttersprache, Pantomime, Sprechen, Lesen, Schreiben, Rechnen, Zeichenkunst, Musik, Geographie, Naturkunde, Religion, Gewerbekenntnis und Verfassung des Vaterlandes. 1811 hatte die Schule 34 Schüler, die Kinder armer Eltern mit Freistellen, die meisten Kinder indes auf Kosten der Eltern. Das Schulkollegium bestand 1812 aus fünf Lehrkräften, dem Direktor Graßhoff, der Witwe Eschke als Ökonomin und Erzieherin, Habermaß als 1. Lehrer sowie einem Zeichenlehrer und einem Lehramtskandidaten. Eschke schrieb Über Stumme. Eine Beihülfe zur Seelenlehre und Sprachkunde (bei Ludwig Pauli & Co.: Berlin 1791), Galvanische Versuche (Berlin 1803), Das Taubstummen-Institut zu Berlin (bei → Friedrich Maurer, Berlin 1806, 2. Aufl. 1811), außerdem etwa 120 Aufsätze, u. a. 1795/1796 Kleine Beobachtungen über Taubstumme in der von → Johann Erich Biester herausgegebenen Berlinischen Monatsschrift. In Berlin trägt die Ernst-Adolf-Eschke-Schule. Sonderpädagogisches Förderzentrum "Hören und Kommunikation" seinen Namen.
Etzel, Franz August v. (O'Etzel, 25.6.1846 preußischer Adelsstand) (19.7.1784 Freie Reichsstadt Bremen-25.12.1850 Berlin), Vorfahren waren die irischen Adligen O'Ethel, die über Holland nach Deutschland einwanderten, V Franz August O'Etzel († 1808), Tabakfabrikant in Bremen, von Friedrich II. zum Direktor der Tabakfabriken in Schwedt ernannt, konnte aber das Amt wegen dessen Todes nicht antreten, statt dessen von Friedrich Wilhelm II. zum Packhofinspektor und Warenästimateur in Potsdam ernannt, M Gesche geb. Borgmann († 1792), ∞ Tornow 20.9.1807 Elise Adelaide (Adelheid) Itzig (23.6.1789-13.8.1866, V Elias Daniel Itzig [1755-1818, 1808 Hitzig], Englischlederfabrikant, Stadtrat von Potsdam, M Marianne geb. Leffmann [1758-1827, V Naphatali Herz Abraham Leffmann, Bankier, † 1775], Bruder Julius Eduard Hitzig [1780-1849], bis zum Übertritt zum Luthertum 1799 Isaak Elias Itzig, Schriftsteller, Verleger, Jurist, Schwestern: Henriette Marianne Hitzig [1781-1845] ∞ Potsdam 1811 Nathan Mendelssohn, V Moses Mendelsssohn [s. Artikel Pistor, Karl Friedrich Heinrich], Caroline Hitzig ∞ den Physiker Paul Erman [1764-1851]),
Sohn
Friedrich August v. Etzel (16.10.1808 Berlin-25.12.1888 Berlin), Generalstabsoffizier, 1837-1840 im Topographischen Büro des Generalstabs, 1848/49 Telegraphendirektor, 1870 General der Infanterie, 1774-1777 Mitglied des Deutschen Reichstags, a. 23.10.1835 Berlin von der Loge Zur Eintracht, 22.4.1868-1870/71 zugeordneter Meister, 2.3.1771 Mitglied des Bundesdirektoriums, Johannis 1873-Juni 1876 National-Großmeister.
Tochter
Marie Luise Franziska Adelaide O'Etzel (30.8.1810 Berlin-1877) ∞ Heinrich Wilhelm Dove (1803 Liegnitz-1879 Berlin), Begründer der Meteorologie und der Wettervorhersage in Preußen, 1829 Prof. in Königsberg, 1845 Prof. für Physik in Berlin, 1848 Direktor des Preußischen Meteorologischen Instituts, 1836 Ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Berlin.
Franz August O'Etzel wollte die Ingenieur-Akademie in Potsdam (s. Artikel Lebauld de Nans, Claude-François-Joseph) besuchen, wurde aber als Bürgerlicher abgewiesen. Er absolvierte eine Apothekerausbildung, befaßte sich nebenbei mit Technik und Geographie, bereiste 1803 die Bergwerke im Harz und ging zum Studium nach Paris, wo er 1803 als Freimaurer aufgenommen wurde. Er war ein Schüler des Chemikers Claude-Louis Berthollet (1748-1822), bei dem er wohnte und in dessen Diskussions- und Forschungsgruppe er den Mathematiker, Physiker und Astronomen Pierre-Simon Laplace (1749-1827) und Alexander v. Humboldt kennenlernte. O'Etzel begleitete Humboldt 1806 nach Italien, wo sie einen Ausbruch des Vesuvs, auf dem O'Etzel Barometermessungen vornahm, miterlebten. Er durchwanderte Oberitalien, machte in Genua die Bekanntschaft Jérôme Bonapartes (1784-1860), des jüngeren Bruder Napoleon Bonapartes, der ihm auf einem französischen Kriegsschiff die Reise nach Toulon ermöglichte, von wo er über Paris, Holland, Hamburg im Frühjahr 1806 nach Berlin zurückkehrte. Etzel promovierte 1806 in Wittenberg zum Dr. phil., wonach er als Assistent eine Anstellung im Farbenlaboratorium der Kgl. Porzellanmanufaktur erhielt, sie aber bald durch die französische Besetzung Berlins verlor. Er legte nun mit ausgezeichnetem Ergebnis die Staatsprüfung der praktischen Pharmazie ab und kaufte die Apotheke Zum gekrönten schwarzen Adler in der Poststraße. Er war 1808 mit den Freunden Karl Friedrich Friesen (1784-16.3.1814), Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) und August v. Vietinghoff (1783-1847) Mitglied einer Fechtbodengesellschaft zur Waffenübung, in deren Mittelpunkt die Freiheit und der Dienst des Vaterlandes standen. Vorsteher waren Friesen, Nathan Mendelssohn und ein Postrat Pistor (Ulfkotte, in: Motschmann: Handbuch der Berliner Vereine, 624, nennt O'Etzel nicht, räumt aber ein, daß weitere Mitglieder der frühen Fechtgesellschaft nicht ermittelt werden konnten). Auch gründete er eine Schwimmanstalt. O'Etzel verkaufte im April 1809 die Apotheke an Konrad Heinrich Sostmann (1782-1859), einen Schüler von → Valentin Rose, und schloß sich wie Friesen und v. Vietinghoff dem Schillschen Freikorps an, kehrte aber an der gesperrten Elbe nach Berlin zurück. Er trat am 19.11.1810 als Avantageur (Offiziersanwärter) in das am 15.5.1809 in Berlin an Stelle des aufgelösten 2. Brandenburgischen (Schillschen) Husarenregiments aufgestellte brandenburgische Ulanenregiment ein, in dem er am 6.2.1812 zum Sekondeleutnant avancierte. O'Etzel kämpfte in zahlreichen Gefechten und Schlachten der Befreiungskriege, erhielt für seine Tapferkeit im Gefecht bei La-Chaussier das Eiserne Kreuz, wurde vom 10.2.1814 bis 4.5.1815 dem Hauptquartier der Armee Blüchers zugeteilt, nahm an den Schlachten bei Ligny und Waterloo sowie an der Eroberung von Paris teil, wo Karl v. Müffling (1775-1851), Oberstleutnant in Blüchers Generalstab, seine Ortskenntnis auffiel, wonach er 1815 zum Platzmajor der eroberten Pariser Stadtteile ernannt wurde. Nach Friedensschluß arbeitete O’Etrzel in Koblenz im Militär-Topographischen Büro zur Aufnahme der Rheinprovinz unter dessen Chef v. Müffling; das durch den Wiener Kongreß an Preußen gefallene Koblenz war Hauptsitz der preußischen Militär- und Zivilverwaltung im Rheinland unter dem Kommandierenden General → August Wilhelm Anton Neidhardt v. Gneisenau, der auch ihn zu seiner Tafelrunde einlud. O'Etzel gehörte 1817 in Koblenz zum Gründerkreis der Loge Friedrich zur Vaterlandsliebe (11.9.1817 Konstitutionspatent GNML3W), deren Meister vom Stuhl er 1819/20 war. Als v. Müffling 1820 zum Chef des Generalstabs der preußischen Armee ernannt wurde, folgte er ihm nach Berlin, wo er an der Allgemeinen Kriegsschule den Lehrstuhl für Terrainlehre und Militärgeographie hatte. Er schrieb eine Terrainlehre (bei Friedrich August Herbig: Berlin 1819) und zeichnete und edierte Karten (Atlas von hydographischen Netzen, 16 Bl., Berlin 1823; Gewässerkarte von Deutschland, Berlin 1824). O’Etzel war am 20.4.1828 in Berlin einer der Mitgründer der Gesellschaft für Erdkunde. Er wurde 1832 zum Mitglied der Immediatkommission für die Errichtung der Telegraphen berufen mit dem Auftrag, eine Telegraphenlinie von Berlin nach Koblenz zu bauen, während der Zeit er ein Codesystem und die Verfahrensanweisungen zum Betrieb der Telegraphen ausarbeitete. Er erhielt nach der Fertigstellung der Linie 1833 die Direktion der Telegraphen. Der König verlieh ihm 1846 den preußischen Adelsstand v. Etzel und beförderte ihn 1847 zum Generalmajor. Er erkrankte schwer und wurde am 9.5.1848 pensioniert. Etzel trat am 20.6.1821 in Berlin der Loge Zur Eintracht (GNML3W) bei, die er ab 1825 als vorsitzender Meister führte. Er war ab 1822 Mitglied der Großen National-Mutterloge zu den drei Weltkugeln. Das Bundesdirektorium berief ihn 1836 zum Mitglied und wählte ihn 1838 zum National-Großmeister. Er schrieb nach eigenen Forschungen im Archiv der Großloge und auf der Grundlage der Forschungen seines Amtsvorgängers → Louis Auguste de Guionneau die quellengestützte Geschichte der Großen National-Mutter-Loge der Preußischen Staaten genant zu den drei Weltkugeln nebst der Beschreibung der Säcularfeier, die 1840 in Berlin Gedruckt für Logen und Brüder erschien. Sie ist wiederholt weitergeführt, aber im Wesentlichen mit unverändertem Text letztmals 1903 in 6. Ausgabe erschienen. Sein Buch ist, abgesehen von den entsprechenden Kapiteln in Ferdinand Runkels Geschichte der Freimaurerei (Berlin 1932), die einzige von Freimaurern geschriebene, quellenfundierte Geschichte des Logenbundes der Großen National-Mutterloge geblieben.
Eugen Friedrich Heinrich Herzog von Württemberg-Stuttgart (21.11.1758 Schwedt-20.6.1822 Meiningen), luth., V Friedrich Eugen Herzog von Württemberg (1732-1797), M Friederike Dorothea Sophia von Brandenburg-Schwedt (1736-1798, V → Friedrich Wilhelm Markgraf von Brandenburg-Schwedt), ∞ Meiningen 1787 Louise zu Stolberg-Gedern verw. Herzogin von Sachsen-Meiningen (1764-1834, V Christian Karl Prinz zu Stolberg-Gedern, 1. Ehe mit Karl Wilhelm August Herzog von Sachsen-Meiningen), B → Friedrich I. König von Württemberg, Schwester Sophie Dorothee Auguste Luise von Württemberg-Stuttgart (1776-1828, als Ehefrau des russischen Kaisers Paul I. Marija Fedorovna).
Der von Goethes Schwager Johann Georg Schlosser (1739-1799), Geheimer Sekretär Friedrich Eugens Herzog von Württemberg, erzogene Prinz Eugen von Württemberg schlug wie sein Bruder Friedrich in Preußen eine militärische Laufbahn ein. Friedrich II. ernannte ihn 1778 zum Oberstleutnant und Kommandeur des II. Bataillons des Infanterieregiments Nr. 36 v. Kleist in Brandenburg an der Havel. Er nahm in der Armee des Königs am Bayerischen Erbfolgekrieg (1778/79) teil, in dem ihn im österreichisch-schlesischen Troppau eine Feldloge als Freimaurer aufnahm. Nach der Rückkehr in die Brandenburger Garnison gründeten der nunmehr 21-jährige Eugen und weitere auswärtige Freimaurer die Loge Friedrich zur Tugend. Obwohl er als Lehrling nicht das aktive Wahl- und Stiftungsrecht besaß, glichen die Zugehörigkeit zu einem regierenden Herzoghaus und der hohe militärische Rang diesen Mangel mehr als aus. Er forderte am 27.8.1779 die in Brandenburg lebenden Freimaurer, unter ihnen fünf Offiziere seines Regiments einschließlich des Regimentsfeldschers, schriftlich auf, ihn darin zu unterstützen, bei dem Generalgroßmeister → Prinz Ferdinand von Braunschweig und der Berliner Mutterloge zu den drei Weltkugeln die Gründung einer Loge in die Wege zu leiten. Am 23.10.1779 fertigte → Friedrich
August Prinz von Braunschweig-Lüneburg, Großmeister aller vereinigten Logen in den königlich preußischen Staaten, das Stiftungspatent aus.
Die am 10.11.1779 installierte Loge nahm zuvor Eugens 29-jährigen Diener als dienenden Bruder auf.
Friedrich Baerle (Perle) (* etwa 1750 Feldbach?/Württemberg), a. 5.11.1779 als dienender Bruder, II. 31.3.1780, III. 8.7.1780
Prinz Eugen, ein Schwärmer, wurde 1781 Bruder des Brandenburger Zirkels Helenus der Bruderschaft der Gold- und Rosenkreuzer, dessen Zirkeldirektor der Brandenburger Domsyndikus Engelmann war.
Julius Bernhard Engelmann (1736? Ottersberg/Pfalz-18.4.1803 Berlin), ref., Domsyndikus auf Dom-Brandenburg, 1801 emeritiert, a. 11.11.1779 Brandenburg (Havel) von der Loge Friedrich zur Tugend, 25.3.1780 Sekretär, 12.3.1781 deputierter Meister (im IV. Grad), 13.10.1789-Ende 1801 Meister vom Stuhl, 1781-1787 Direktor des Brandenburger Gold- und Rosenkreuzerzirkels Helenus mit dem Ordensnamen Mandrabulus Helenus Negrini, 1784 für die Aufnahme in den Illuminatenorden vorgeschlagen.
Die Brandenburger Johannisloge kam lange Zeit nicht recht auf ähnlich wie alle Logen in einer Garnison, zumal Eugen 1782 als Oberst und Chef des Husarenregiments Nr. 4 in das niederschlesische Oels versetzt wurde. Er wurde Mitglied der Schlesischen Nationalloge Christian zum Firmament, der Führung der schlesischen Strikte Observanz-Logen, sowie Visitator perpetuus der Mutterloge Zur goldenen Himmelskugel in Glogau für die schlesischen Tochterlogen. Der schlesische Rosenkreuzer Karl Rudolf v. Lestwitz nahm ihn in Glogau in seinen Zirkel Philocrates mit dem Ordensnamen Victrinus Egregius Enverus Kriserde (Trifer de Dimibuch) auf.
Karl Rudolf v. Lestwitz (29.9.1745-9.8.1803), luth., Erbherr der Stadt Groß-Tschirnau und einiger Dörfer in Ober-Tschirnau, Ritter des Johanniterordens, 1773 Vizedirektor des Landschaftsdirektoriums für den niederschlesischen Kreis Glogau und Sagan, 1779 Landesältester des Kreises Guhrau, a. 2.12.1767 von der Loge Zur gekrönten Schlange in Görlitz (VII. Provinz, Präfektur Apfelstädt), 20.8.1772 in Nistitz Carolus eques ab aequitate (Von der Billigkeit), leitete ab 25.6.1779 in Glogau die Johannisgrade (der Lehrlinge und Gesellen) der Loge Cherub vor Eden, 1780-27.12.1792 Hauskomtur der Mutterloge Zur goldenen Himmelskugel, 1791 Mitglied der Schlesischen Nationalloge Christian zum Firmament, 13.5.1779 in Glogau im IV. Grad Oberzirkeldirektor des Zirkels Philocrates des Gold- und Rosenkreuzerordens, Ordensname Philocrates de Zuludros, bis 21.12.1782 VIII. Grad des Meisters, der das große Werk, den Lapis philosophorum, den Stein des Weisen, bereitete, 21.12.1784 2. Hauptdirektor, Ordensname Vultus.
Lestwitz beförderte Eugen am 21.12.1782 auf den III. Grad des Theoreticus und am 21.12.1783 auf den IV. Grad des Philosophus. Er charakterisierte Eugen als äußerst strenge in seinen Sitten, gottesfürchtig, dem O[rden] höchst ergeben, fleißig und tätig, exponiert sich aber zu sehr Gefahren. Prinz Eugen erhielt vermutlich im Dezember 1784 in Oels einen eigenen Zirkel, Victrinus, dem allerdings nur vier Brüder angehörten. Er besetzte, als er am 14.6.1784 als Visitator perpetuus die Loge Friedrich zum goldenen Zepter (1776 gegründet) visitierte, die Logenführung neu und ernannte → Gottlob Friedrich Hillmer, der durch seine Protektion eine Professorenstelle am Breslauer Magdalenaeum erhalten hatte, zum Meister vom Stuhl. Durch den Pietisten Eugen, der bis März 1785 an fast allen Logen teilnahm und ab Johannis 1788 die Loge führte, und durch Hillmer machte sich in ihr „eine aufdringliche Frömmelei“ breit (Festschrift). Eugen avancierte 1786 zum Generalmajor und 1793 zum Generalleutnant. Er erbte nach dem Tod seines Onkels Karl Christian Erdmann Herzog von Württemberg-Oels 1793 Carlsruhe in Oberschlesien, das er statt Oels zu seiner ständigen Residenz mit Theater (1793/94) und Hofkapelle (1794/95) machte. Er ernannte zu deren Leiter den Schauspieler und Komponisten
Adolf (Josef) Herbst (um 1768 Ritzebüttel [heute zu Cuxhaven]-14.5.1798), 1790 in Schwerin engagiert, bis 1798 Leiter des Kleinen Hoftheaters von Eugen Friedrich Heinrich Herzog von Württemberg-Oels in Carlsruhe, a. 1793 Breslau von der Loge Friedrich zum goldenen Zepter.
Auch Eugens Sekretär
Heinrich Ernst Lutezi († 1803/04), 1791 Kämmerer in Glatz, 1786-1797 Mitglied der Breslauer Loge Zur Glocke,
und sein Stallmeister
Johann Friedrich Leberecht Hammer (* 1747), 1777-1804 Mitglied der Breslauer Loge Zur Glocke,
waren Freimaurer. Eugen nahm 1794 am Feldzug in Polen, der Niederschlagung des nationalpolnischen Aufstandes unter Tadeusz
Kościuszko durch Rußland und Preußen, teil. Im Dezember 1794 wurde er wegen Krankheit vom Felddienst und als Chef des Husarenregiments entbunden, das er indes im Januar 1797 zurückerhielt. Friedrich Wilhelm III. beförderte ihn 1801 zum General von der Kavallerie, als der er als Befehlshaber der westpreußischen Ersatzarmee am Vierten Koalitionskrieg teilnahm, in dem ihn Jean-Baptise Bernadotte (1763-1844, Maréchal d’Empire, 1818-1844 als Karl XIV. Johann König von Schweden) am 18.10.1806 bei Halle schlug. Eugen zog sich nach Carlsruhe zurück, wohin er den von ihm verehrten Komponisten Karl Maria v. Weber einlud (den er indes zu Beginn der Befreiungskriege entlassen mußte). Seine letzten Monate verbrachte er in Meiningen, wo er 1822 starb.
Eunicke, Johann Friedrich (6.3.1764 Sachsenhausen/Mark Brandenburg-12.9.1844 Berlin, Gräber von Friedrich, Therese und Johanna Eunicke auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof), V Johann Georg Eunicke, Kantor, ∞ 1. Schwedt 1788 die 16-jährige Johanne Henriette Rosine Schüler (13.2.1772 Döbeln/Sachsen-4.3.1749 Köslin/Pommern, V Schauspieler), 1775-1779 Musikausbildung u. a. durch Georg Anton Benda, den Sohn von → Friedrich Ludwig Benda, 1781 Kinderrollen im Ballett des Nationaltheaters Berlin, Unterricht durch Johann Jakob Engel (1741-1802), Theaterdichter am Nationaltheater in Berlin, 1785 Engagement durch → Heinrich Friedrich Markgraf von Brandenburg-Schwedt als Soubrette am Hoftheater in Schwedt, 1796-1806 Schauspielerin am Nationaltheater in Berlin, spielte u. a. die Johanna in Friedrich Schillers Jungfrau von Orleans, Ehe 1797 geschieden, ∞ 2. 1797 Therese Schwachhofer (24.11.1774 Mainz-16.3.1849 Berlin, V Ignaz Schwachhofer, Violinist in Mainz), 1796-1830 Schauspielerin und Opernsängerin (Sopran) am Nationaltheater in Berlin,
Tochter
Johanna Eunicke (1798 Berlin-1756), Sopranistin an der kgl. Oper in Berlin, ∞ Berlin 1826 den Maler Franz Krüger, Pferde-Krüger (1797-1851).
Friedrich Eunicke erhielt den ersten Musikunterricht durch seinen Vater. Die Familie war zu arm, ihn Theologie studieren zu lassen. Er bekam die Stelle eines Präfekten im Berlin(-Köllnischen) Currende-Chor. 1786 engagierte ihn → Heinrich Friedrich Markgraf von Brandenburg-Schwedt wegen seiner Tenorstimme als markgräflichen Kammersänger am Hoftheater Schwedt. Nach dem Tod des Markgrafen 1788 und der Entlassung des Ensembles nahm Eunicke Engagements an in Mannheim (1788), Mainz (1789), Bonn (1792), Amsterdam (1793 an der deutschen Oper) und Frankfurt am Main (1795) und schließlich 1796 als 1. Tenor (kgl. Kammersänger) und Schauspieler am Nationaltheater Berlin, wo er bis zu seiner Pensionierung 1823 auftrat. Am 31.1.1799 nahm → Antoine Thomas Palmié ihn in Berlin in seine Loge Zum Widder (GLL) auf. Seine Paten waren seine Kollegen am Nationaltheater → Franz Joseph Mattausch und → Bernhard Anselm Weber. Die Loge beförderte ihn am 23.1.1800 zum Gesellen und am 3.2.1801 zum Meister. Sie wählte ihn am 13.4.1802 zum Zeremonienmeister (bis 1804) und 1804 zum 2. Aufseher (bis 1820). Eunicke wurde 1809 Mitglied der von Karl Friedrich Zelter (1758-1822) gegründeten Berliner Liedertafel, des ersten deutschen Männerchors, für die er Lieder komponierte.
Eysenhardt, Friedrich Wilhelm (25.6.1745 Berlin-21.11.1815 Berlin), V (Friedrich Gottlieb Eysenhardt, Tuch- und Seidenhändler, Gildeältester)?, ∞ 1769 Katharina Elisabeth Jordan († 21.11.1815), elf Kinder,
Tochter:
Caroline Luise Elisabeth Eysenhardt (* 2.6.1769) ∞ 25.6.1792 → Georg Jakob Decker Sohn
Sohn:
Christian Friedrich Eysenhardt (4.6.1770 Berlin-18.1.1829), Kaufmann in Berlin, a. auf Vorschlag des Berliner Kaufmanns und Schatzmeisters Wilhelm Gerloff (1770-1815) 9.1.1800 Berlin von der Loge Zum Widder (GLL), Paten sein Proponent, → Antoine Thomas Palmié, → Jean Michel Palmié, II. 28.1.1801, III. 7.1.1802, 1803/1804 Mitglied des Maurerischen Leseinstituts, letztmals 1812 genannt.
Friedrich Wilhelm Eysenhardt vertrieb nach der Handlungslehre ab 1766 auf eigene Rechnung Tressen und Leinwand. Er besaß die Kattun-, Zitz- und Ellenwarenhandlung Eysenhardt & Sohn (1807) am Mühlendamm und war Gildeältester der Tuch- und Seidenhändler in Berlin. Die Berliner Loge Royale York de l'Amitié nahm Eysenhardt am 26.1.1774 auf und beförderte ihn am 15.4.1774 zum Gesellen und am 10.9.1774 zum Meister. Er legte 1778 auf eigenen Wunsch seine Mitgliedschaft nieder, trat aber 1782 erneut der Loge bei. Er gehörte nach der Logenreform und der Aufteilung der Royale York in vier Berliner Filialen ab 1798 der Tochterloge Zur siegenden Wahrheit an. Die Große Loge ernannte ihn 1813 zu ihrem Logenrepräsentanten. Eyssnhardt war Mitglied der 1800 gegründeten Philomatischen Gesellschaft in der Mohrenstraße, einer Gesellschaft von Freunden des Wissens zum Austausch wissenschaftlicher und künstlerischer Kenntnisse; erster Direktor (1800-1811) war → Heinrich Martin Klaproth.
Eytelwein, Johann Albert (31.12.1764 Frankfurt a. M.-18.8.1848 Berlin), V Christian Philipp Eytelwein, Kaufmann in Frankfurt a. M., M Anna Elisabeth Katharina geb. Hung (1745-1778, V Albert Hung [1716-1767], Kürschner, Rauchhändler in Frankfurt a. M., M Anna Katharina Klingling), ∞ Berlin 1790 Dorothea Charlotte Luise Pflaum (1767-1828, V Johann Christian Friedrich Pflaum, Küster, Leichenträger in Berlin).
Der 15-jährige Johann Albert Eytelwein trat 1779 als Bombardier in das 1. Artillerieregiment in Berlin ein. Er besuchte die Artillerieakademie (Direktor Georg Friedrich v. Tempelhoff [1757-1807], Mathematiker, Militärhistoriker, Musikschriftsteller, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der Akademie der Künste), studierte Wasserbau und legte 1786 die Prüfung als Feldmesser ab. Eytelwein erhielt 1787 als Leutnant seinen Abschied, legte das Architekturexamen vor dem Oberbaudepartement ab und wurde 1790 zum Deichinspektor des Oderbruchs in Küstrin angesetzt (1794 Oberdeichinspektor). Die Berliner Loge Zum goldenen Schiff (GLL) ballotierte am 26.6.1790 über die Aufnahme des 27 1/2-Jährigen, den sie am 12.2.1791 aufnahm; er gehörte ihr vermutlich bis zu seinem Tod an. Die Loge beförderte ihn, als er 1793-1796 die von → David Gilly gegründete Private Lehranstalt für Freunde der Baukunst in Berlin besuchte, am 8.4.1794 zum Gesellen und am 15.4.1794 zum Meister. Eytelwein wurde 1794 als Geh. Oberhofbaurat an das Oberbaudepartement in Berlin versetzt, wo er die Regulierung von Oder, Warthe, Weichsel, Memel leitete und maßgeblich an den Hafenbauten in Memel, Pillau und Swinemünde beteiligt war. Er gründete mit → Friedrich Becherer, → David Gilly und Heinrich August Riedel (1748-1810) 1799 in Berlin die Bauakademie, an der er Mechanik und Hydraulik lehrte und die er 1799-1802 als einer der rotierenden Rektoren leitete. Eytelwein trat in Berlin weiteren Sozietäten bei, am 3.3.1799 (bis 1802) der Gesellschaft der Freunde der Humanität, 1800? (bis 1810) der Philomatischen Gesellschaft und 1823 der Zwanglosen (Gesetzlose Gesellschaft Nr. 1). Die Akademie der Wissenschaften wählte ihn am 27.1.1803 zum Außerordentlichen und am 4.8.1808 zum Ordentlichen Mitglied. Nach seiner Promotion 1811 zum Dr. phil. lehrte er 1809-1815 an der Universität Berlin höhere Analysis und Mechanik. Friedrich Wilhelm III. ernannte ihn 1809 zum Direktor der kgl. Oberbaudeputation, 1810 zum Vortragenden Rat im Ministerium des Handels, der Gewerbe und des gesamten Bauwesens, 1816 zum Oberlandesbaudirektor (Leitung der Regulierung von Oder, Warthe und Weichsel),1818 (bis 1825) zum Mitdirektor des Ministeriums (in Bausachen, er leitete die technische Oberbaudeputation) und 1825 (bis 1830) zugleich zum Direktor der Bauakademie. Er trat 1831 schwerkrank in den Ruhestand. Eytelwein machte sich verdient um die Bestimmung des definitiven Gewichts und Maßes in Preußen. Er schrieb Vergleichung der in den königlich preußischen Staaten eingeführten Maße und Gewichte (1798) sowie mehrere Handbücher (der Mechanik fester Körper und der Hydraulik, 1801; der Statik fester Körper, 1808; der Perspektive, 1810; der Hydrostatik, 1825), mit Gilly Anleitung der Wasserbaukunst (1822-1828). Er war 1797-1806 einer der Herausgeber der Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten die Baukunst betreffend, der ersten deutschen Bauingenieurzeitschrift.