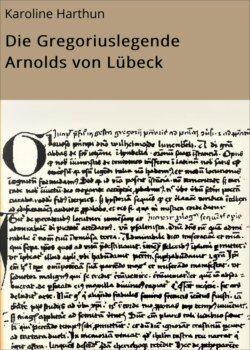Читать книгу Die Gregoriuslegende Arnolds von Lübeck - Karoline Harthun - Страница 3
I. Einleitung
ОглавлениеDie vorliegende Arbeit wurde am 22. September 1995 an der FU Berlin als Magisterarbeit im Fach Mittellateinische Philologie eingereicht. Betreut wurde sie von Prof. Dr. Fritz Wagner. Für die digitale Veröffentlichung habe ich sie weder aktualisiert noch der neuen Rechtschreibung angepaßt.
Die Untersuchung setzt sich zum Ziel, die mittellateinische Bearbeitung der mittelhochdeutschen Gregoriuslegende durch Arnold von Lübeck in ihrer Systematik zu erforschen. Mit Hilfe von sechs Untersuchungskriterien, die die stilistischen, narrativen und inhaltlich-wertenden Eingriffen Arnolds in die Gregoriuslegende Hartmanns von Aue beschreiben, sollen die Charakteristika seiner eigenständigen Interpretation analysiert werden. Diese sollen aber auch den Schlüssel liefern zu einem besseren Verständnis der Erzählstruktur der Legende. Voraussetzung dafür ist die bereits in der Sekundärliteratur geäußerte Annahme, daß es sich bei Hartmanns Text um eine literarische Mischform1 handelt, die sich narrativer Konventionen aus Roman und Legende bedient, und daß Arnold von Lübeck in seiner Bearbeitung die romanhaften Züge zugunsten einer traditionsgebundeneren legendenhaften Erzählweise unterdrückt.2
Ob Arnolds Methode als repräsentativ für die mittellateinische Legende gelten kann, soll überprüft werden, wenn sich die Arbeit zwei weiteren Texten zuwendet, um darin legendenspezifische Erzählstrategien nachzuweisen. Diese beiden Texte sind die Bernhardsvita Wilhelms von St. Thierry und die Julianlegende Jakobs von Voragine, die hier stellvertretend für die gesamte hochmittelalterliche Hagiographie behandelt werden. Dabei interessieren sowohl die narrativen Strategien der Oberflächenstruktur als auch die der Tiefenstruktur. Zu diesem Zweck wird ein linguistisches Modell William Labovs herangezogen, welches den Zusammenhang zwischen der narrativen Intention eines Textes in seiner Tiefenstruktur und ihrer konkreten sprachlichen Realisation an der Oberfläche des Textes klärt.
Im folgenden widmet sich die Arbeit dem historischen Rahmen der lateinischen Gregoriuslegende. Auf Arnolds Standort in der Tradition der Übersetzungstheorie wird an dieser Stelle nicht eingegangen. Dafür soll in allgemeineren Ausführungen das Verhältnis von volkssprachlicher und mittellateinischer sowie weltlicher und geistlicher Literatur im Deutschland des hohen Mittelalters zur Sprache kommen. Die hierzu angestellten Überlegungen, vor dem Hintergrund der Bearbeitungsmethode Arnolds von Lübeck betrachtet, dienen als Hinweis auf die Funktion der Gesta Gregorii Peccatoris und auf die Motivation von Auftraggeber und Bearbeiter, mit der sie einen volkssprachlichen Text ins Lateinische übertragen haben. Inwieweit sich Funktion und Intention der Gesta Gregorii Peccatoris in anderen mittellateinischen Texten wiederfinden lassen, die aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt wurden, soll hier nur angedeutet werden.