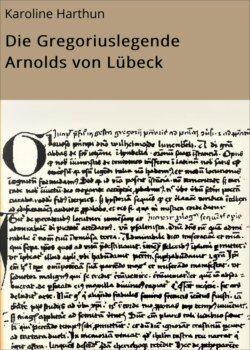Читать книгу Die Gregoriuslegende Arnolds von Lübeck - Karoline Harthun - Страница 5
III. Forschungsbericht
ОглавлениеDie Forschung über die Gesta Gregorii Peccatoris stand immer im Schatten des Interesses an ihrer deutschen Vorlage, die der Literaturgeschichtsschreibung als so viel bedeutender galt. So richten sich die meisten Fragen zu den Gesta Gregorii Peccatoris an ihr Verhältnis zum Ausgangstext. Als eigenständiges literarisches Werk wurden sie bisher nur peripher wahrgenommen.28
Nachdem die Gesta Gregorii Peccatoris im Jahre 1877 wiederentdeckt worden waren,29 stießen sie auf reges Interesse und provozierten mehrere Dissertationen. Nach dem Ersten Weltkrieg erlahmte die Beschäftigung und wurde erst wieder in den siebziger Jahren aufgenommen. In den späten achtziger Jahren erlebte das Werk Arnolds von Lübeck eine noch immer anhaltende Renaissance. In den vergangenen zehn Jahren wurde über die Gesta Gregorii Peccatoris annähernd so viel publiziert wurde wie in den hundert Jahren zuvor.
Die Editio princeps legte Gustav von Buchwald vor. Er gab ihr den Titel „Gregorius Peccator“. Mehrere Rezensenten kritisierten die Edition und boten Textverbesserungen an.30 Generell konzentrieren sich die meisten der frühen wissenschaftlichen Arbeiten über die Gesta Gregorii Peccatoris auf deren Sprache.
Hermann Seegers verglich als erster Arnolds Übersetzung mit Hartmanns Gregorius. Sein Augenmerk galt dabei vor allem der Entstehung der Übersetzung, indem er zu klären versuchte, welche Handschrift Arnold benutzt haben könnte. Er stellte bereits die Nähe der Handschrift P der Gesta Gregorii Peccatoris zur Handschrift A des Gregorius fest und neigte irrigerweise dazu, diese für die Vorlage zu halten.31 Das Fehlen des Prologs in der Handschrift A versuchte er damit zu erklären, daß Arnold der eigentliche Autor des Gregorius-Prologs sei und Hartmann den Prolog erst aus Arnolds Übersetzung übernommen habe.
Die Dissertation Johannes Meys ist der Chronik Arnolds von Lübeck gewidmet. Doch geht Mey in einem Exkurs auch auf die Gesta Gregorii Peccatoris ein. Darin registriert er, nun auf gesicherterer Textgrundlage stehend als seine Vorgänger, strukturelle und inhaltliche Unterschiede zu Hartmann. Er betont vor allem, daß Arnold die Erzählung stark christlich eingefärbt habe.32
Ernst Schuppes Dissertation befaßt sich erneut mit Problemen der Textkritik. Auf der Grundlage einer ausführlichen metrischen und rhythmischen Analyse des Werks äußert er zahlreiche Korrekturvorschläge zu Buchwalds Ausgabe. Methodisch folgt er seinem Lehrer Eduard Sievers. Dabei fügt er in den nur aus einer Handschrift bekannten Text so viele ihm metrisch notwendig scheinende Wörter ein, daß er sich damit radikal gegen die Autorität der Überlieferung stellt.
Nach Schuppes Dissertation bricht die Gesta Gregorii Peccatoris-Forschung aus unerklärlichen Gründen ab. Abgesehen von einer Magisterarbeit von Hedda-Maria Fraunhofer aus dem Jahre 1970 über die lateinischen Übersetzungen aus dem Mittelhochdeutschen,33 legt Peter Ganz 1974 den ersten neueren Aufsatz über das Werk vor. Schon vorher war Hans-Joachim Behr am Rande auf die Gesta Gregorii Peccatoris eingegangen, doch hatte er sie lediglich dahingehend untersucht, welche Rolle der fürstliche Auftraggeber für die Entstehung des Werkes spielte.
Zwei wichtige Dissertationen zu den Gesta Gregorii Peccatoris sind in den achtziger Jahren erschienen, die kritische Edition von Johannes Schilling und der gleichzeitig entstandene literaturwissenschaftliche Vergleich der Prologe Arnolds und Hartmanns von Reiner Zäck.
Schilling liefert die verbindliche kritische Edition, die schon deswegen von unschätzbarem Wert ist, weil er als letzter die verschwundene Handschrift auswerten konnte. Er gibt wertvolle Informationen zu Autor, Auftraggeber, Forschungslage, Textaufbau, Interpretation, Sprache und Stil. Die Gesta Gregorii Peccatoris werden nunmehr als eigenständige literarische Leistung gewürdigt.
III.1 Zäcks Interpretation der Prologe
Reiner Zäck vergleicht die Prologe Hartmanns und Arnolds nach inhaltlich-moralischen Kriterien. Die bei Hartmann und Arnold abweichende Exegese des Samaritergleichnisses nimmt Zäck als Ausgangspunkt für eine Diskussion des jeweiligen Schuldverständnisses der beiden Texte auf der Folie der zeitgenössischen Theologie.
Freilich hat bisher niemand eine schlüssige theologische Interpretation von Gregorius’ Schuld in Hartmanns Erzählung vorgelegt.34 Sie verbietet sich schon deshalb, weil Gregorius’ Heirat mit seiner Mutter im theologischen Sinne nicht einmal unzweifelhaft als persönliche Schuld aufgefaßt werden kann.35 Umso problematischer ist nach meiner Auffassung der Ansatz, nur die Prologe des Gregorius und der Gesta Gregorii Peccatoris auf ihre theologische Fundierung hin zu untersuchen und daraus eine für den gesamten Text gültige und einheitliche Schulddefinition und Interpretationsvorgabe ableiten zu wollen. Eine solche antizipatorische Funktion kann einem Prolog nicht bedingungslos unterstellt werden.36 Hennig Brinkmann hat gezeigt, daß der Prolog in mittelalterlicher Literatur als literarische Textsorte isolierter wahrgenommen wurde als in der Neuzeit.37 Eine Interpretation, die ihm Prolog angedeutet wird, muß nicht zwangsläufig die gesamte Erzählung über tragen. Gerade ein Fidus interpres38wie Arnold von Lübeck hat zwar die Möglichkeit, im Prolog seinen Schuldbegriff festzuschreiben, im weiteren Verlauf wird er ihn aber nicht immer deutlich machen können, wenn er an seiner Übersetzertreue festhalten will.39
Zäcks Analyse des Hartmannschen Prologs40 ergibt, daß Hartmann seinen Schuldbegriff sehr wohl theologisch fundiert habe, jedoch viel freizügiger als sein Nachfolger Arnold. Einerseits stehe er im Einklang mit umstrittenen Figuren wie Abaelard,41 andererseits habe er die verbreitetere Lehrmeinung der Kirche gemäß seinen eigenen Anschauungen neu akzentuiert. Dies setzt meines Erachtens eine Kenntnis von Literatur voraus, wie man sie selbst einem belesenen Laien wie Hartmann nicht unterstellen kann. Dietmar Ponert gibt zu bedenken, daß die Lektüre theologischer Texte eine äußerst elitäre Angelegenheit war, die man auch bei einem nur durchschnittlich gebildeten Kleriker nicht unbedingt voraussetzen könne. Nach Ponert verschaffte sich der Laie die grundlegende theologische Bildung vor allem über exegetische Literatur zur Bibel und über die Homilienrezeption.42
Hätte Hartmann die Bußtheologie Abaelards oder des Petrus Lombardus rezipiert, so argumentierte schon Dittmann,43 dann hätte er genauer auf deren zentrales Thema eingehen müssen, nämlich auf das Gewicht der einzelnen Bußakte und im besonderen auf die Rolle der priesterlichen Absolution als Konsequenz aus der Contritio.44 Indem er aber auf die Differenzierung dieser Problematik verzichtet und Gregorius seine Buße völlig allein, ohne die Unterstützung der Kirche vollzieht, schließt Hartmann an eine Bußpraxis an, die in der Realität immer angewandt und schon 813 auf der Synode von Châlon diskutiert wurde.45 Hartmanns populäre Darstellung der Buße läßt lediglich eine Distanz zur scholastischen Lehre vermuten; sie rechtfertigt aber nicht die Annahme, daß er im Gregorius oppositionelle Strömungen innerhalb der Theologie verarbeitet habe, zumal diese Strömungen auch auf ein bereits virulentes volkstümliches Bußverständnis zurückgriffen.46
Bejahen kann man Zäcks Ziel, „die starre Orientierung auf ein präsumptiv homogenes Bild mittelalterlicher Religiosität aufzubrechen“.47 Zweifellos hat Hartmann ein anderes religiöses und moralisches Verständnis als Arnold, das sich in seinem individuellen Schuldbegriff und in der Art seines Interesses am Gregorius-Stoff ausdrückt.
III. Forschungsbericht – Fortsetzung
Die neueste Veröffentlichung zu den Gesta Gregorii Peccatoris ist Hartmut Freytags Aufsatz von 1992, der sich mit einer signifikanten stilistischen Eigenart Arnolds beschäftigt, nämlich die zahlreichen Antonomasien seiner Vorlage systematisch zu tilgen oder aufzulösen.48
III.2 Bewertung der Forschungslage
Wie schon die Titel der wissenschaftlichen Publikationen zu Arnold von Lübeck zeigen, wurde dieser Autor bis in die Gegenwart fast ausschließlich im Kontext des Hartmannschen Werks diskutiert. Stand zu Beginn der Arnold-Forschung die Herstellung des kritischen Textes im Vordergrund, so zog man diesen später im wesentlichen dafür heran, ihn auf der Folie der Hartmannschen Sprache und Interpretation wahrzunehmen. Zur philologischen Analyse, die vor allem die Verwandschaft zwischen den Gesta Gregorii Peccatoris und den Gregorius-Handschriften klären sollte, traten die spekulativen Vermutungen Meys oder Zäcks über Arnolds inhaltliche Auffassung der Gregoriuslegende.
Beide Positionen stehen in der Forschung unverbunden nebeneinander, erscheinen doch ihre Zielsetzungen und Methoden so unterschiedlich. Eine Einzeluntersuchung wie die Hartmut Freytags weist den rechten Weg, den die Arnold-Forschung einschlagen sollte, indem sie eine Verknüpfung der bisher gewonnenen Erkenntnisse anstrebt und sich so einer anspruchsvolleren Interpretationsebene nähert. An einer ausgewogenen Gesamtdarstellung der Gesta Gregorii Peccatoris mangelt es bis heute.
Ebenso wurde bisher nur ansatzweise versucht, die Gesta Gregorii Peccatoris in den Kontext der deutsch-lateinischen Übersetzungsliteratur des hohen und späten Mittelalters einzuordnen. Anstrengungen in diese Richtung haben Behr und Kunze unternommen. Behr wird von einem weniger literaturwissenschaftlichen als vielmehr soziologischen Interesse geleitet, während Kunze einen profunden, aber leider nur katalogartigen Einstieg in das Thema der deutsch-lateinischen Übersetzungsliteratur bietet. Auch Berschin und Fischer kommen kaum über eine kurze Erwähnung des Textes hinaus.
Eine Systematik der deutsch-lateinischen Übersetzungstexte konnte bisher niemand aufstellen, weil die Quellenlage nicht hinreichend geklärt ist. Kunzes Untersuchung zeigt am deutlichsten, wie wenig eingrenzbar die Zahl der Textzeugen immer noch ist, fügt er doch den vordem bekannten ganze drei neue Funde hinzu.49 Eine monographische Darstellung der nachweisbaren lateinischen Übersetzungen und anderen Adaptationen volkssprachlicher, insbesondere mittelhochdeutscher Literatur bleibt ein Desiderat. Ponert erhebt mit dem Titel seiner Dissertation den Anspruch, die grundlegenden Beziehungen zwischen beiden Literatursprachen aufzudecken, doch steckt er den Rahmen so weit, daß er über einen literaturhistorischen Überblick hinaus eine kohärente Theorie nicht aufzustellen vermag, zumal er hauptsächlich Einflüsse lateinischer Literatur auf deutsche Texte gelten läßt, kaum jedoch umgekehrte Wirkungen.50