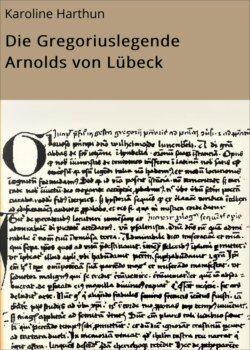Читать книгу Die Gregoriuslegende Arnolds von Lübeck - Karoline Harthun - Страница 6
IV. Der Gregorius-Stoff
ОглавлениеIV.1 Authentizität der Legende
Die Gestalt der Gregoriuslegende geht auf keine historische Persönlichkeit zurück. Obwohl der Name Gregorius für einen Papst geläufig ist, kann die Geschichte mit keinem Papst in Verbindung gebracht werden. Verschiedene Erzählmotive51 lassen keinen Zweifel daran, daß man es mit einer stark von literarischen und kulturellen Traditionen geprägten Fiktion zu tun hat: Gregorius ist das Kind eines Geschwisterinzests52 (Mot. A 164.1, Mot. A 1331.2, Mot. A 1337.0.7, Mot. A 2006, Mot. G 37, Mot. M 365.3, Mot. Q 520.3, Mot. T 415, Mot. T 471.1)53 und wird daraufhin verstoßen (Mot. S 312.1). Er wird in einem Weidenkorb ausgesetzt wie Moses (2 Mos 2, 1 - 10; Mot. N 211.1.2)54 und von Fischern gefunden (Mot. R 131.4). Er schlägt seinen Stiefbruder wie Judas (Mot. S 73.1.0.1);55 er heiratet seine Mutter wie Ödipus (Mot. A 164.1.1, AaTh 931).56 Er tut siebzehn Jahre Buße wie Alexius. Nach Ohly entspricht diese Zeitspanne dem Strafmaß für Inzest im römischen Recht.57 Der Schlüssel zu seinen Ketten wird im Magen eines Fisches gefunden wie der Ring des Polykrates (Mot. N 211.1.2, AaTh 736 A) und der des Hl. Arnulf,58 aber auch der Schlüssel zu den Ketten des Hl. Metro, der sich ebenfalls an einen Stein gefesselt hat, um zu büßen (Mot. Q 525.1).59Auf einem Felsen schmachten auch Judas60 und der Hl. Martinian.61 Gregorius’ Befreiung ähnelt der des Hl. Genebaudus, der sieben Jahre in einer Zelle eingeschlossen war, weil er als Bischof zwei Kinder gezeugt hatte. Die Tür zu seinem Kerker wird von einem Engel geöffnet, den Gott sendet.62 Schließlich begegnet Gregorius seiner Mutter erst wieder, als er Papst geworden ist (Mot. H 151.3), und vergibt ihr die Schuld des Inzests (Mot. T 412.1). Als Heiliger wirkt er Wunder, die an die Wunderheilungen der Apostel erinnern.
Gregorius ist nicht nur keine historische Figur,63 auch als Heiliger wurde er kaum nachweislich verehrt, weder vor der Niederschrift der Vie de Saint Grégoire oder des Gregorius Hartmanns von Aue noch danach. Keine Kirche ist ihm geweiht, und seine Erzählung wurde nur einmal in die Liturgie aufgenommen, in ein Lübecker Plenar des späten 15. Jahrhunderts.64 Wenige Exempel- oder Legendensammlungen erwähnen ihn, außer den prominenten Kompilationen der Legenda aurea und der Gesta Romanorum überliefern nur eine deutsche dominikanische Exempelsammlung aus der Mitte des 13. Jahrhunderts und die Sammlung Der heiligen leben von 1471 den Stoff.65
IV.2 Gliederung bei Arnold und Hartmann
Arnold unterteilt seine Erzählung in Bücher und Kapitel. Dies tut keine der erhaltenen Handschriften von Hartmanns Gregorius. Gleichwohl kann Arnold die Einteilung seiner Vorlage, der verlorenen Handschrift N entnommen haben. Seine Komposition weist gegenüber der Hartmanns jedenfalls keine entscheidenden Veränderungen auf. Schilling liefert einen tabellarischen Stellenvergleich.66 Die zwei Prologe und drei Epiloge Arnolds verstärken den Eindruck einer planvollen und abgeschlossenen Konzeption. Der Übersetzungstext schwillt nicht an; der Umfang des Übersetzungstextes entspricht in etwa dem der Vorlage.67 Auch qualitativ orientiert sich Arnold an Hartmanns Vorgaben. Chronologische Umstellungen der Erzählung werden nicht vorgenommen, der Erzählfluß wird lediglich bei Arnold häufiger für abstrakte Erörterungen unterbrochen.
Das erste von vier Büchern erzählt die Vorgeschichte, also den Inzest der Eltern des Gregorius, den Tod des Vaters, Gregorius’ heimliche Geburt und seine Verstoßung. Das zweite Buch berichtet seine Kindheit, seinen Auszug in die Welt und die Hochzeit mit der Mutter. Das dritte beschäftigt sich ganz mit der Schuld, die darin aufgedeckt wird. Das letzte Buch thematisiert Gregorius’ Buße und Erlösung. Diese klare und sinnvolle Gliederung weist das Thema von Schuld und Sühne deutlich als den Kern der Erzählung aus.
IV.3 Hartmanns Erzählhaltung
Um Arnolds von Lübeck Eingriffe in die Erzählung der Gregoriuslegende zu erkennen, muß man sich zunächst die Erzählhaltung seiner Vorlage verdeutlichen. Hierbei kann man auf die reiche germanistische Hartmann-Forschung zurückgreifen, die weitaus dezidiertere Ergebnisse erbracht hat als die Beschäftigung mit dem mittellateinischen Text. Sie bezieht ihre Ergebnisse teils aus vergleichenden Stilanalysen der einzelnen Werke Hartmanns, teils aus einer Gegenüberstellung der Vie de Saint Grégoire mit dem Gregorius. Den mittelhochdeutschen Text gegen den altfranzösischen absetzend, erkennt zum Beispiel Hans Schottmann Hartmanns Anliegen darin, „die Motive der Vorlage schärfer zu fassen und zu verbinden, durch Streichungen auszugleichen, durch Umstellungen und Erweiterungen dem Erzählten neue Akzente zu geben“.68 Freilich könnte man ähnliches auch von Arnolds Umgang mit der narrativen Struktur seiner Vorlage formulieren. Daher muß der Versuch unternommen werden, die Erzählhaltung des Gregorius absolut zu umreißen. Diesem Wagnis kommt man am ehesten bei, wenn man die Rolle und den Charakter des Erzählers umreißt.
IV.3.1 Der Erzähler im Gregorius
Norbert Heinze hat eine statistische Untersuchung aller wichtigen Werke Hartmanns vorgelegt, die sich hauptsächlich mit den Gliederungspraktiken beschäftigt, aber auch einige Worte über den Erzähler verliert. Diese Untersuchung ist insofern nützlich, als sie auch die Unterschiede zwischen den Erzählhaltungen der einzelnen Werke andeutet und dadurch indirekt zur Diskussion der Gattungsmerkmale beiträgt, also auch zu der Frage, wie legendentypisch die Erzählstruktur des Gregorius ist.
Das in diesem Zusammenhang wichtigste Ergebnis Heinzes betrifft das Hervortreten des Erzählers. Heinze behauptet für den Gregorius ein so deutliches Hervortreten des Erzählers, wie wir es in den beiden Artusromanen, vor allem im späten Iwein, nicht finden. Tatsächlich tritt der Erzähler im Gregorius nicht unbedingt deutlicher, sondern anders konturiert auf als dort. Er scheint in direkterem Kontakt mit dem Adressaten zu stehen, er bezieht eine subjektiv-perspektivische Erzählhaltung. Von der Funktion des Autors kann die des Erzählers hier weniger eindeutig als im Artusroman getrennt werden, weil die Suggestion eines Vortrags erzeugt wird. Der Erzähler spricht häufiger in der Ersten Person, er redet die Leser oft direkt in der Zweiten Person an, er kommentiert das Geschehen, ohne sich hinter anderen Personen der Erzählung zu verstecken, und stellt dabei gelegentlich einen scheinbar autobiographischen Bezug her.69 Als eigenständige Figur im Sinne Stanzels70 ist er auch dadurch leichter einzugrenzen, daß er seine Kompetenz selbst beschränkt, indem er darauf verzichtet, die Perspektiven erzählimmanenter Personen zu wählen oder deren Gedanken und Reden konjunktivisch wiederzugeben.71 Es herrscht direkte Rede vor.72 Der Autor strukturiert die Erzählung deutlich - die ursprünglichen Abschnittsgrenzen des Gregorius sind durch die Handschriften gut belegt -,73 indem er neue Abschnitte überwiegend mit eindeutigen Partikeln wie „dô“ oder „nû“ beginnt und sie mit einversigen Schlußsätzen beendet, die oft Erzählerkommentar sind.74
Die gesamte Erzählsituation75 ist im Gregorius also unvermittelter als in Hartmanns Artusromanen.76 Sie scheint mehr als der Erec, obwohl dieser vor dem Gregorius entstand, die orale Tradition von Literatur zu atmen. Das Hervortreten des Erzählers als eines alternativen Konzepts zum Autor oder seinem Stellvertreter, der den Text für ihn vorträgt, ist im allgemeinen ein Merkmal der Verschriftlichung weltlicher Literatur.77 Im Falle des Gregorius simuliert die unvermittelte Präsenz des Erzählers, der „Ich“ sagt, den Vortragenden der älteren Rezeptionssituation. Von einem Hervortreten des Erzählers als einer rein literarischen Vermittlerfigur kann deshalb nicht die Rede sein.
Die für das übrige Hartmannsche Werk eher untypische Erzählweise liegt sicherlich zum einen in der Struktur der französischen Vorlage begründet, die man als weniger literarisiert bezeichnen kann als die Werke Chrétiens de Troyes. Zum anderen muß Hartmann aber auch daran gelegen gewesen sein, die Besonderheit des halbsakralen Stoffes, der sowohl rein hagiographische als auch arturische Züge aufweist,78 dadurch zu unterstreichen, daß er eine narrative Mischform zwischen Legende und Roman wählte. Auch wenn sein Gregorius im Umfang, in der metrischen Form79 und in der komplexen Problematik über die normale Anlage von Legenden80 hinausgeht, darf man doch nicht aus den Augen verlieren, daß er in der Erzählhaltung der Legende nicht völlig untreu wird.81Arndt, der andere Aspekte des Erzählens bei Hartmann untersucht als Heinze, stellt zum Beispiel fest, daß der Anteil sentenziöser Bemerkungen im Gregorius dreimal so hoch ist wie im Erec.82 Er vermutet in diesem Phänomen nur eine stilistische Weiterentwicklung Hartmanns, doch es ist naheliegender, die Ursache dafür im Einfluß legendenhaften Erzählens auf Hartmanns Gregorius zu suchen.
IV.4 Die Sünderheiligenlegende
Gregorius gehört zum Typus des Sünderheiligen, der im zwölften Jahrhundert so beliebt wird.83 Er ergänzt als dritte typologische Stufe die hagiographische Geschichte, nachdem in der Frühzeit des Christentums das Martyrium als das kennzeichnende Merkmal der Heiligkeit angesehen wurde,84 später die Nachfolge Christi der Confessores.85 Während letztere den Keim ihrer Heiligkeit oft schon in frühester Kindheit erkennen lassen, verstrickt sich der Sünderheilige zunächst in eine persönliche Schuld, die er dann abtragen muß. Seine Heiligkeit kann sich erst daran beweisen, wie groß seine Buße und wie groß auch die göttliche Gnade ist, die ihn schließlich von seiner Schuld erlöst.
Ein Beispiel für den Typus des Bekenners ist der Hl. Alexius,86 der bereits der ersten Gefahr, die ihn von der Imitatio Christi abbringen könnte, nämlich seiner bevorstehenden Hochzeit, ausweicht und sich in seinem Leben unter der Treppe wie ein Büßer gebärdet, ohne überhaupt Schuld auf sich geladen zu haben. Dieser Typus von Heiligkeit bleibt bis in die Gegenwart bestimmend. Dennoch sind Sünderheilige seit dem Hochmittelalter keine Seltenheit. Gerade das Inzestmotiv ist in der Hagiographie weit verbreitet. Berühmtestes Beispiel neben Gregorius ist Judas Ischarioth.87 Zwar sind seine Verbrechen, vor allem der Verrat des Messias, so groß, daß er keine Heiligkeit erlangen kann und als Sünder stirbt, doch abgesehen davon fallen deutliche Parallelen zum Gregorius-Stoff ins Auge. Auch er wird als Säugling in einem Korb auf dem Wasser ausgesetzt, wächst bei Fischern auf, auch er schlägt seinen Stiefbruder im Zorn, wobei er ihn allerdings tötet, und heiratet seine Mutter. In späteren Versionen verbüßt er seine Schuld sogar auf einem Felsen im Meer.88 Freilich ist er selbst kein Kind des Inzests, dafür lädt er, anders als Gregorius, noch die Schuld des Vatermords auf sich.
Über die inhaltlichen Gemeinsamkeiten hinaus bestehen überlieferungsgeschichtliche Parallelen. Sowohl Gregorius als auch Judas sind keine historisch glaubwürdigen Personen. Die Judas-Legende nimmt sich zwar die biblische Person Judas Ischarioth zum Vorbild, doch in den sanktionierten und apokryphen Teilen der Bibel findet sich kaum ein Hinweis auf dessen Lebensgeschichte. Irenäus, Epiphanius und Theodoret erwähnen ein gnostisches Evangelium Judae Ischariotis, das nicht erhalten ist.89 Das im Arabischen überlieferte Evangelium infantiae Jesu Christi läßt Judas auftreten, als er noch kein Jünger Christi ist, sagt jedoch kein Wort über seine oben genannten Sünden.90
Selbst wenn die Wurzeln der Judas-Legende in der Spätantike liegen, wird sie erst im zwölften Jahrhundert virulent. Der älteste Text entstammt einem Pariser Codex (Lat. 14489) aus dem ausgehenden zwölften Jahrhundert. Spätestens nachdem die Erzählung von Jakob von Voragine in die Legenda aurea aufgenommen wird, erfährt sie große Verbreitung. Über fünfzig Handschriften geben mindestens ein Dutzend verschiedener mittellateinischer Fassungen wieder; der Umfang der volkssprachlichen Überlieferung ist genauso groß.
Judas und Gregorius sind nicht die einzigen heilsgeschichtlichen Gestalten, die mit der Schuld des Inzests beladen sind. Die ursprünglich byzantinische, dann bulgarische Legende vom Hl. Paulus von Caesarea läßt ihren Protagonisten, ein Kind eines Bruder-Schwester-Inzests, seine Mutter heiraten.91 Diese Grundstruktur findet sich in vielen volkssprachlichen Legenden und Balladen wieder.92 Ein Vatermörder ist der Hl. Alban, dessen Legende uns auch deshalb interessiert, weil sie in einer Fassung aus dem Deutschen ins Lateinische rückübersetzt wurde.93 Auch dieser Stoff kommt erst im zwölften Jahrhundert auf.94 Die Sünderheiligenlegende scheint mithin auf moraltheologische oder allgemeine religionstheoretische Probleme des Hochmittelalters zu antworten. Man kann sie auch als Ausdruck des neuen Religionsverständnisses interpretieren, das sich im zwölften und 13. Jahrhundert von Frankreich aus in Westeuropa durchsetzt.95 In ihrer Reaktion auf innerkirchliche Krisen, naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die Konfrontation mit der arabischen Kultur - der geistesgeschichtliche Hintergrund sei hier nur angedeutet - setzen sich ja sowohl die Mystik als auch die Scholastik mit Fragen auseinander, die das Verhältnis des einzelnen Gläubigen zu Gott oder der einzelnen Seele zur gesamten Schöpfung diskutieren.
IV.4.1 Die identifikatorische Eignung der Sünderheiligenlegende
Eine neue Identifikation des Gläubigen mit der Mittlerfigur Maria, eine intime Nähe und personale Beziehung zu ihr und zu Christus, wie sie zum Beispiel von Bernhard von Clairvaux idealisiert wurden, die Imitation der apostolischen Lebensweise durch die Bettelorden und Wanderprediger schienen den Ausweg aus der Entfremdung von den eigentlichen Glaubensinhalten zu zeigen. Dieser Entwicklung wurde auch in der Literatur Rechnung getragen.96 Die didaktische Literatur wächst um ein Vielfaches; pragmatische Formen wie die Hymnik oder das geistliche Spiel expandieren; andere Formen werden aktualisiert und attraktiver gestaltet, indem man ihnen unterhaltsame, oftmals aus der volkssprachlichen Literatur übernommene Erzählmotive und -techniken beigibt; es entstehen Mischformen zwischen beiden Literatursphären - entweder dadurch, daß die volkssprachliche Literatur im Vergleich zu ihren Anfängen stärker christlich eingefärbt wird, wie es im höfischen Roman und im klassischen Minnesang der Fall ist, oder auch dadurch, daß sich die lateinische Literatur stärker auf volksprachliche und antike Vorbilder bezieht, zum Beispiel in den Carmina Burana97 oder der mittellateinischen Epik. Textautoritäten wie die Bibel oder bewährte Fachliteratur werden systematisch in die Volkssprachen übersetzt; schließlich werden auch in den Volkssprachen Themen schriftlich erörtert, für die vordem die lateinische Sprache reserviert war.98
Die Sünderheiligenlegende ist insofern Teil dieser Entwicklung, als sie neben Maria und Jesus neue Identifikationsfiguren99 für den Rezipienten kreiert, die glaubwürdiger sind als die Bekennerheiligen. Denn jeder Gläubige ist zunächst mit seiner eigenen Sündhaftigkeit belastet, die es zu bewältigen gilt. Das Vorbild des Sünderheiligen gibt ihm Hoffnung und eine Handlungsanweisung: daß es sich immer lohne, Buße zu tun, ganz gleich, wie groß die Schuld sei, weil die göttliche Gnade jede Schuld übersteige. Die Lektüre einer solchen Legende baut ein Vertrauensverhältnis auf, das anschaulich die Stellung des Individuums in der Schöpfung bestimmt, sich theoretischer Spekulation verweigert und insofern zugleich volkstümlich ist und im Einklang mit den didaktischen Interessen der Kirche und der zeitgenössischen Philosophie etwa Hugos von St. Viktor steht.100
IV.4.2 Die Modernität der Sünderheiligenlegende
Man muß sich folglich vergegenwärtigen, daß das literarische Subgenre der Sünderheiligenlegende nach dem Gesagten thematisch eine Neuerung, eine moderne Erscheinung des späten zwölften und frühen 13. Jahrhundert darstellt. In formaler Hinsicht verschließt sie sich neuen Wegen kaum weniger, denn die erwähnte Überlieferungslage der Judas-Legende verdeutlicht, daß die volkssprachliche Rezeption dieses Legendentypus der lateinischen von Beginn an ebenbürtig ist, sie später teilweise überflügelt.101 Es ist zum Beispiel fraglich, ob Hartmanns französische Vorlage, die Vie de Saint Grégoire ihrerseits eine lateinische Vorlage besessen haben muß.
Das Bewußtsein für die Neuartigkeit des literarischen Materials spielt für die Frage einer Übersetzung ins Lateinische insofern eine Rolle, als man ihretwegen geneigt ist, hinter dem Akt der Übersetzung eine ausgesprochen konservative Geisteshaltung zu vermuten. Einen literarischen Text, der zur Erbauung des individuellen Gläubigen und als Hilfe zur Bewältigung seiner eigenen Lebenssituation geschrieben wurde, vom Deutschen ins Lateinische zu übersetzen, mag noch sinnvoll erscheinen, weil er auf diese Weise einem großen Kreise von Predigern in ganz Europa zugänglich gemacht wurde, die ihn dann in ihren Predigten und Gesprächen mit Laien auswerten konnten. Überraschen muß jedoch der Anspruch der literarischen Form, den schon die Vorlage aufweist und der in der Übersetzung noch wächst. Er entzieht den Text zumindest teilweise seiner ursprünglichen Funktion und führt ein Moment ein, das durch die allgemein beobachtete literarische und kulturelle Entwicklung einer neuen Volkstümlichkeit nicht erklärt werden kann und vielleicht sogar im bewußten Widerspruch zu ihr steht, sich anti-modern verhält. Während die Autoren der Carmina Burana,102 die sich ja auch mit volkssprachlichen Vorbildern auseinandersetzen, sich so stark auf diese zubewegen, daß sie sogar deutsche und französische Phrasen aufnehmen, bewirkt die Auseinandersetzung bei Arnold von Lübeck eine entgegengesetzte Tendenz. Dies muß im Auge behalten werden, wenn man sich über die mögliche Motivation und Intention des Textes Gedanken macht.