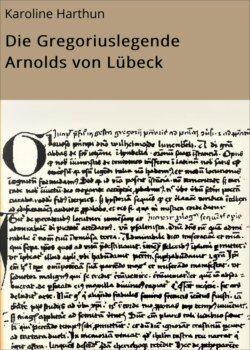Читать книгу Die Gregoriuslegende Arnolds von Lübeck - Karoline Harthun - Страница 7
V. Der Vergleich
ОглавлениеV.1 Die Art des Vergleichs
Der Vergleich eines Urtextes und seiner Übersetzung setzt eine möglichst vollständige Analyse beider voraus. Je nach Interessenschwerpunkt kann man jedoch die zu analysierenden Kriterien unterschiedlich auswählen und gewichten. Wie der Forschungsbericht zum Werk Arnolds von Lübeck gezeigt hat, gab es bisher Untersuchungen mit sprachwissenschaftlichem und interpretatorischem Schwerpunkt. Die ältere, erste Gruppe interessierte sich vornehmlich dafür, wie der Übersetzer das Formalisierungsgefälle zwischen der völlig verschriftlichten Zielsprache Latein und der noch immer dialektal geprägten, grammatisch freieren und semantisch ärmeren, mithin auch ambivalenteren Ausgangssprache Deutsch bewältigt hat.
Die zweite Gruppe der Interpreten richtete ihr Augenmerk auf die unterschiedliche soziale Herkunft der beiden Autoren. Zwar war auch Hartmann als Ritter überdurchschnittlich gebildet,103 doch ist seine Sichtweise, wie noch zu erläutern sein wird, zweifellos viel weltlicher als die des Abtes Arnold. Die übereinstimmende Meinung der bisherigen Publikationen geht dahin, daß Arnold Hartmanns säkularisierte Auffassung eines ursprünglich rein religiösen Themas entweder in Nuancen oder aber radikal „rechristianisiert“ hat.
Die vorliegende Arbeit nun hat sich zum Ziel gesetzt, einen dritten Interpretationsansatz ins Gespräch zu bringen, um die beiden bisher benutzten in einen Zusammenhang zu setzen, der im Falle des Gregorius noch nicht explizit gesucht wurde. Indem man die Texte sowohl unter ausgewählten sprachlichen Kriterien als auch unter inhaltlichen untersucht, läßt sich die Dichotomie zwischen Philologie und Literaturwissenschaft überwinden. Ausgehend von der grammatischen und rhetorischen Beschaffenheit eines Textes, kann man, über ein allgemein historisches Interesse an sprachlichen Ausdrucksformen hinaus, die idiosynkratische Vorgehensweise eines Autors konstruieren, nach der er mit dem Duktus des Textes auch seine Interpretation bestimmt. Eine Übersetzung eignet sich für eine Analyse im Sinne einer narrativen Theorie hervorragend, weil sich im Vergleich zum Original die Eingriffe des Übersetzers in den Text eindeutig abzeichnen.104 Und diese Eingriffe manifestieren sich in erster Linie in der Struktur der Erzählung, sind doch die erzählerischen Mittel das wichtigste Handwerkszeug eines Autors.
Freilich ist das Feld der Narrativik weiter und weniger systematisiert als beispielsweise das der Rhetorik, nicht zuletzt weil es in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Literatur ein vergleichsweise junges Territorium ist. Hier verläßliche Untersuchungskriterien aufzustellen, ist keine leichte Aufgabe. An einem festen Kanon der analytischen Methodik muß es schon deswegen mangeln, weil offenbar jeder Text seine ureigene Vorgehensweise in der Analyse erfordert. Der Kern der Problematik liegt in der nach wie vor offenen Genrediskussion der Mediävistik. In der Neueren Literaturwissenschaft wird niemand versuchen, die Struktur eines Roman mit den Mitteln einer Gedichtanalyse beschreiben zu wollen. Mögen die interpretatorischen Grenzen auf dem Gebiet mittelalterlicher Lyrik noch einigermaßen deutlich abgesteckt sein, so verschwimmen sie schon in der Unterscheidung zwischen Epos und Roman. Noch vager müssen sie bei einem Werk wie dem Gregorius verlaufen, dessen Genre kaum bestimmt werden kann und das seine Ausdrucksformen aus so gegensätzlichen Erzählgattungen wie der Legende, der Novelle und dem Roman bezieht.105
Aus diesem Grunde will sich die vorliegende Studie auf ein empirisches Vorgehen konzentrieren, bei dem induktiv Untersuchungskriterien entwickelt werden, um die eigentümlichen Differenzen zwischen der Erzählstruktur der beiden thematisierten Fassungen der Gregoriuslegende zu beschreiben.106
V.2 Die Kategorien des Vergleichs
V.2.1 Rhetorische Änderungen (A)
Rhetorische Vergleiche zwischen den beiden Gregorius-Fassungen lassen sich nur bedingt anstellen, da jede Übersetzung mit rhetorischen Veränderungen einhergeht. Sie sollen hier deshalb nur dann aufgeführt werden, wenn Arnold entweder auffällige rhetorische Eigenleistungen erbringt oder aber auf prominente Stilfiguren Hartmanns verzichtet, ohne auch nur annähernd lateinische Entsprechungen zu bilden. In antiker Terminologie gehört dazu der Vorgang des Incrementums, der Steigerung von Stilfiguren.107
V.2.2 Die „topischen“ Zugaben (B)
V.2.2.1 Exkurs: Der Toposbegriff
Unter der Kategorie der „topischen“ Zugaben soll eine ganze Gruppe von textuellen Eingriffen Arnolds verstanden werden, die sowohl sprachlicher als auch inhaltlicher als auch struktureller Natur sein können. Der Begriff des Topos in der Literaturwissenschaft ist indifferent genug, um keinen dieser Aspekte auszuschließen.108 Die Interpretation dieses Terminus und seine Verwendung schwanken in dem Maße, in dem Curtius’ Maßstäbe setzendes Kompendium zur Topik seit seinem Erscheinen im Jahre 1948 die heftigsten und unterschiedlichsten Reaktionen hervorgerufen hat. Die gewaltige Kontroverse innerhalb der Toposforschung hat dazu geführt, „daß (...) jeder Autor, der den Begriff Topos verwendet – der nun einmal von Curtius in die literaturwissenschaftliche Terminologie eingeführt wurde –, diesen definieren muß.“109
Denn während sich vor allem in den ersten Nachkriegsjahren viele Forscher Curtius vorbehaltlos anschlossen, übte die Literaturwissenschaft der sechziger und siebziger Jahre deutliche Kritik an seinem Toposbegriff: „Der Curtiussche Topos in seiner ersten Fassung 1938 (und in den folgenden Jahren) wie in seiner modifizierten Form von 1948 ff. ist ein Proteus, dessen Identität nicht Wahrheit ist, sondern das falsche Ergebnis ahistorischer Gleichsetzungen von verschiedenen Termini der rhetorischen Topik. So ist es möglich, daß der Curtiussche Topos schließlich fast jeden Inhalt annehmen kann und sich nur noch mit dem Sammelbegriff eines ‘konstanten’ oder ‘traditionellen’ Textelementes fassen läßt.“110 So hart diese Worte klingen, so ist es doch richtig, daß sich Curtius vom antiken Verständnis eines Topos im Sinne von Aristoteles gelöst hat, nach dem der Topos „eine Methode, eine Technik oder Norm, ein Instrument zur Auffindung einer Sache, niemals aber die Sache selbst“111 sein kann beziehungsweise immer ein Stilmittel ist, aber kein Motiv. Ein entliehenes Motiv müßte man danach streng logisch als Gemeinplatz bezeichnen, nicht als Topos.
Die streng funktionale Deutung des Aristotelischen Toposbegriffs bei Mertner ist nicht unumstritten. Freyr R. Varwig machte deutlich, daß Aristoteles einer metaphorischen und auf den Redeinhalt bezogenen Verwendung rhetorischer Begriffe grundsätzlich auswich.112 Otto Pöggeler fragte im Gegensatz zu Mertner nach der Platonischen Vorstellung vom Topos und sieht in ihm primär eine Symbolisierung philosophischen Gedankenguts.113 Den Autoritäten Platons und Aristoteles’ muß man die Ciceros und Quintilians gegenüberstellen, insbesondere im Hinblick auf ihre gewichtigere mittelalterliche Rezeption. Beide öffnen den Toposbegriff seiner inhaltlichen Dimension; denn: „licet definire locum esse argumenti sedem“.114 Diese Formulierung läßt offen, ob sie die Struktur oder den Inhalt des Sedes argumenti oder beide meint.115 Entscheidend, wie auch schon bei Aristoteles selbst, ist die Funktion des Locus innerhalb der Rede als eines Elementes, das zur Überzeugung und Gewinnung des Hörers eingeflochten wird.
Der von Jehn abschätzig gebrauchte Ausdruck „Sammelbegriff eines ‘konstanten’ oder ‘traditionellen’ Textelementes“ ist zwar vage, trifft aber die Eigenart von Curtius’ Terminus. Für eine moderne, nicht aristotelische Topos-Definition reicht er freilich nicht aus. Diese ist aber vonnöten, will man nicht einfach Curtius’ theoretisch unsicheren, aber in der literaturwissenschaftlichen Praxis fruchtbaren komparatistischen Ansatz aus rein logischen Überlegungen zu einer zu eingeschränkten Stilkritik degradieren. Zu eingeschränkt deshalb, weil das von Curtius Topos genannte Phänomen in der literarischen Realität der nachantiken, insbesondere der nicht wissenschaftlichen Literatur - Aristoteles’ Äußerungen über die Topik sind ja von den Gattungen der Gerichtsrede und des philosophischen Beweises inspiriert - damit in seiner Bedeutung nicht erkannt würde.
Wie vielfältig die topische Verwendung eines narrativen Elementes in der Literatur des Mittelalters auftreten kann, hat zuletzt Peter von Moos am Beispiel des Exempels vorgeführt.116 Er betrachtet das Exempel nicht mehr losgelöst von seinem Erzählkontext und berücksichtigt besonders historische Texte, die nicht zum Vortrag gedacht waren. Dadurch wird der metaphorische Gebrauch des Exempels deutlich, das formal dem Exempel in Oratio und Sermo entlehnt ist. Für andere Textelemente liegen derart umfangreiche Untersuchungen nicht vor.
Die Einsicht, daß ein Topos seine volle Gültigkeit erst durch seinen Erzählkontext erlangt und kein „funktionsloses Requisit“117 ist, verdankt die neuere Literaturwissenschaft der Topostheorie Bornscheuers. Von Moos’ Schüler führt den Begriff der Kombinatorik in die Diskussion ein. Nach seiner Auffassung spiegelt der Topos zwar ein allgemein anerkanntes Wissen wider, doch was ihn von einem Gemeinplatz im Sinne Mertners abhebt, ist seine kombinatorische Struktur, das heißt die ihm eigene Potenz, innerhalb begrenzt variabler Kontexte dieses Wissen anschaulich und durchaus originell zu vermitteln.118 Die Allgemeingültigkeit und die Verwendbarkeit als Conditio sine qua non topischen Materials differenziert Bornscheuer zu einem Vier-Punkte-Katalog: „Den Umriß eines Topos beziehungsweise einer Topik bestimmen vier verschiedenartige Hauptmomente: die kollektiv-habituelle Vorprägung (Habitualität), die polyvalente Interpretierbarkeit (Potentialität), die problemabhängige, situativ wirksame Argumentationskraft (Intentionalität) sowie die sich gruppenspezifisch konkretisierende Merkform (Symbolizität).“119In der Beherrschung aller vier Voraussetzungen, ohne die ein Topos nicht dechiffrierbar ist, liegt ein guter Teil der Virtuosität und Originalität eines Autors. Denn die Bedeutung eines Topos kann der Rezipient nicht frei wählen. Wird diesem die intendierte Bedeutung nicht bewußt, hat der Autor versagt. Die Basis narrativer Kunstfertigkeit ist jedoch nicht ein autonomes Genie, sondern „eine jeweils epochencharakteristische Tiefenstruktur“.120
Die Topos-Definition Bornscheuers versucht, dem qualitätsvollen Material in Curtius’ Enzyklopädie gerecht zu werden, es aber auf eine theoretisch sicherere Grundlage zu stellen. Es ist wichtig, die Offenheit von Curtius’ Methode bewußtzumachen, ohne ihre Offenheit logisch einschränken oder auffüllen zu wollen. In diesem Sinne formuliert August Obermayer: „Ähnlich sehe ich (...) den Topos als ein Vorstellungsmodell, als eine Weise des Denkens und Formens von Sein und Welt, die sich zu einer feststehenden sprachlichen Form kristallisieren kann, jedoch nicht notwendigerweise muß, und literarisch wirksam wird. In den Topoi sind also ‘Seinsverhältnisse gedacht und geformt’. Auch ist ein Topos ‘mehr als ein Begriff, er fordert die Anwendung von Begriffen in bestimmter Absicht’. Es wird damit (...) weder zu Aristoteles zurückgekehrt, wo der Topos einen Platz im Beweisverfahren hatte, noch wird - wie bei Curtius - über dem vermeintlichen Klischeecharakter jede philosophische Bindung geleugnet.“121
Diese Definition des Topos als Vorstellungsmodell ist zwar wenig prägnant, erfordert weitere Erläuterungen und am besten eine Verifikation ihrer Anwendbarkeit - die hier versucht werden soll -, sie wird aber am ehesten der Hydra narrativer Topik Herr. Entscheidend ist dabei der Hinweis auf die Motivation literarischer Topik. Während bei Curtius oft der Eindruck entsteht, daß eine topische Auffassung und Bearbeitung von Literatur für den mittelalterlichen Autor geradezu zwingend gewesen sei, hatte dieser doch in Wirklichkeit einen freizügigen Spielraum. Dies wird zum Beispiel daran deutlich, daß ein Dichter wie Baudri von Bourgueil einen konventionellen Anklang an affektierte Bescheidenheit durch seine individuelle Position dichterischen Selbstbewußtseins kontrastieren kann.122
Die topische Analyse der Gesta Gregorii Peccatoris wird mithin unter der Voraussetzung vorgenommen, daß die Verwendung von Topoi durch die didaktischen und ästhetischen Absichten des mittelalterlichen Autors motiviert und von diesen abhängig ist. Nur unter dieser Voraussetzung kann sie zu einem besseren Verständnis von Arnolds Interpretation der Gregoriuslegende leiten. Dabei versteht sich, daß diese Absichten keinesfalls allein personal gebunden sein können, sondern vor allem in Abhängigkeit zu Arnolds Position innerhalb einer bestimmten literarischen Tradition, nämlich der der Legende, stehen. „Der traditionelle Legendentypus, so wie Arnolds von Lübeck ‘Gregorius’-Übersetzung ihn vertritt, bedingt eine gewisse Stilisierung; tropologische Gehalte werden eher normativ dargestellt als durch persönliche Ausführungen mit subjektiver Erfahrung verknüpft.“123Normativ dargestellte Gehalte werden von Arnold aus dem Fundus ihm bekannter Erzähltopik124 geschöpft, den er zumeist als gegeben kennzeichnet.125
V.2.2 Die „topischen“ Zugaben (B) - Fortsetzung
Aufbauend auf Obermayer soll für die Analyse der Gesta Gregorii Peccatoris folgende Topos-Definition gelten: Die von Arnold verwandten Topoi, die von der Vorlage unabhängig sind, sind inhaltlich definierte Bausteine seines Vorstellungsmodells von Erzählung, die in der Regel keiner besonderen sprachlichen Form verpflichtet sind. Sie drücken seine moralische und ästhetische Interpretation des Gregorius-Stoffes aus, aber sie kennzeichnen auch eine bestimmte Haltung gegenüber dessen literarischer Gestaltung, Gattungszugehörigkeit und der Form und Funktion von Literatur im allgemeinen, indem an ihnen deutlich wird, daß Arnold manche Erzählmuster anderen vorzieht. Die Erzählmuster sind dabei in bestimmter Weise konnotiert und gehören jeweils einer eingrenzbaren Tradition an. Arnold setzt Topoi da ein, wo sie nach seiner Auffassung hingehören,126 das heißt, wo er ein bekanntes Erzählmuster als gültig akzeptiert oder gar Hartmann korrigieren möchte, der nach seinem Ermessen davon abgewichen ist. Da er seine auf diese Weise „wiedergefundenen“ Topoi - man bezeichnet die Topik ja als Ars inveniendi - nicht regelwidrig in ungebräuchliche Kontexte einfügt, ist sein Vorgehen an sich konservativ;127 denn sobald Argumentationen topisch geworden sind, wollen sie „weder bestehende Werte hinterfragen noch neue Werte etablieren, (...) vielmehr den durch einen gesellschaftlichen Konsens abgesteckten Rahmen verbindlicher Werthaltung[en] artikulieren“.128
Arnolds „verbindliche Werthaltung“ dient als Regulans sowohl der sprachlichen als auch der inhaltlichen Gestalt der Topoi. Darüberhinaus bestimmt sie die Wahl der literarischen Gattung. Je nachdem, ob die narrative Struktur der Gesta Gregorii Peccatoris mehr dem Roman oder mehr der Legende zuneigt, transportiert sie unterschiedliche Wertesysteme, die keineswegs nur moralisch definiert sind, sondern ebenso ästhetisch.129 Narrative Struktur und somit die Gattungszugehörigkeit eines Textes werden wiederum durch Topik verfestigt und für den Leser kenntlich gemacht. Von besonderer Bedeutung für die rezeptive Einordnung eines Textes sind dabei Ort und Zahl der auftretenden Topoi. Sie sind zum Teil mit der Wahl der Gattung bereits festgelegt, zum Beispiel die Frage nach der Abstammung des Protagonisten: „(...) ihm [dem Autor] kam es zu, über die Herkunft des Heiligen etwas zu sagen. Der Topos hieß nun ‘Herkunft’, nicht aber ‘adlige Herkunft’ oder ‘geringe Herkunft’. Der Topos (...) erinnert den Autor daran, daß er an dieser Stelle suchen muß, daß er die Frage der Herkunft nicht übergehen kann.“130
Jedesmal, wenn der Autor einem solchen Erzählauftrag nachgibt, der nach der Tradition in der Gattung topisch impliziert ist, bestätigt er damit aufs Neue seine traditionsgebundene Auffassung von Erzählung. Hierin liegt die jenseits des Moralischen angesiedelte ästhetische Urteilsdimension des Topos. Unter der Kategorie B werden vorwiegend Topoi zusammengefaßt, die ästhetisch auffällig sind und zumindest auf den ersten Blick keine moralische Implikation enthalten. Topoi, die eindeutig moralische Argumentationshilfen sind, fallen unter die nächste Kategorie.
V.2.3 Moralisch-anagogische Deutungen (C)
Arnolds Topik läßt sich als Schlüssel zu seiner Erzählperspektive und Intention gebrauchen, jedoch nur mittelbar, da sie als Element einer Erzählsymbolik131 mangels historischer poetologischer Anweisungen und vergleichbarer moderner Untersuchungen vorläufig nicht eindeutig dechiffrierbar ist.
Anders verhält es sich, wenn Arnold das Erzählgeschehen ganz offensichtlich kommentiert. Für gewöhnlich tut er dies nach dem Schema der Exegese, wie sie in der Predigt angewandt wird.132 Er begreift dann ein Ereignis der Erzählung als Exempel für einen weiteren Zusammenhang, auf den er den Rezipienten hinweisen möchte und den er moralisch zu werten sich bemüßigt fühlt. Anagogisch sind seine Deutungen bisweilen zu verstehen, weil die Thematik des Sünderheiligen ja einen starken Bezug zur Theologie des Jüngsten Gerichts hat und nur von ihrer anagogischen Auflösung her für den gläubigen Christen bedeutsam und überhaupt akzeptabel ist. Das glückliche Ende des Gregorius, dem seine Schuld schon auf Erden vergeben wird, nimmt anschaulich die Auferstehung des sündigen Fleisches vorweg.
Arnold leitet seine Deutungen, an der Predigtpraxis geschult, oftmals mit Floskeln („hoc signat“, II, 1, 6; „sunt enim plures“, Prolog, 14; „sic etiam iste“, Prolog, 48) oder durch die Nennung von Autoritäten („ut Salemon predixerat“, I, 12, 18) ein.
V.2.4 Biblische und theologische Anklänge (D)
Wenn Arnold biblische Allusionen einfügt oder auf theologische Grundsätze anspielt, hat dies natürlich teilweise die gleiche Funktion wie die in V.2.3 beschriebene Textexegese. Dieses Verfahren scheint aber nicht immer bewußt von ihm angewandt zu werden, sondern man hat den Eindruck, daß hier ab und an ein Automatismus greift, der dem literarisch eher unerfahrenen Kleriker eignet. Arnold assoziiert sein gelehrtes Wissen bei der Bearbeitung des Gregorius, und indem er es nicht für sich behält, hebt er den Text auf einen anderen Bildungsstand. Damit verändert er natürlich seine poetische Qualität, die bewußte Einfachheit der Hartmannschen Fassung, und wendet sich an ein neues, gelehrteres Publikum. Diese Umfunktionalisierung ist allerdings nur in Ansätzen spürbar. Insgesamt, dies muß man klar anmerken, färbt Arnold die Erzählung weit weniger theologisch ein, als es denkbar wäre. Den Grad der theologischen Bildung des Abtes hat Zäck anhand des Prologs genauestens untersucht.
V.2.5 Erklärende Zusätze (E)
Unter der Kategorie der erklärenden Zusätze kann man alle Hinzufügungen verstehen, die Arnold an solchen Stellen vornimmt, an denen ihm Hartmanns Erzählung unklar erscheint. Im allgemeinen erklärt er Vorgänge oder Vokabeln, die aus Hartmanns ritterlicher Erzählperspektive selbstverständlich sind, vor dem Hintergrund von Arnolds Klerikerkultur aber fremd wirken und für ein Publikum, das den Umgang mit höfischer Literatur nicht gewohnt ist, tatsächlich der Erklärung bedürfen mögen. Hierher gehören auch schwer übersetzbare mittelhochdeutsche Ausdrücke, die Arnold paraphrasiert, und bestimmte typisch deutsche Stilfiguren, die in wortgetreuer Übersetzung unlateinisch klängen und deren Denkform der traditionellen mittellateinischen Literatur nicht vertraut genug wären.
V.2.6 Inhaltliche Unterschiede (F) und Auslassungen (G)
Nur selten wandelt Arnold den Ablauf der Erzählung wirklich ab. Nichtsdestoweniger müssen solche Unterschiede bemerkt werden, auch wenn hier nicht entschieden werden kann, inwieweit für die inhaltlichen Differenzen möglicherweise Arnolds Quellhandschrift verantwortlich gemacht werden muß oder auch eine Kontamination in der Überlieferung des Gregorius-Stoffes, die jedoch nach allen Anzeichen – die Vie de Saint Grégoire ist inhaltlich weit von den Gesta Gregorii Peccatoris entfernt, eine ältere lateinische Fassung existiert nicht – eher unwahrscheinlich ist.
Dagegen scheinen die Textauslassungen aussagekräftiger zu sein, zeichnet sich doch ab, daß Arnold oftmals schwierige Stellen oder Bestandteile der höfischen Kultur nicht nach dem Schema von V.2.5 erklärt hat, sondern sie schlicht übergeht, weil sie ihm wohl nebensächlich oder gar störend vorkommen.