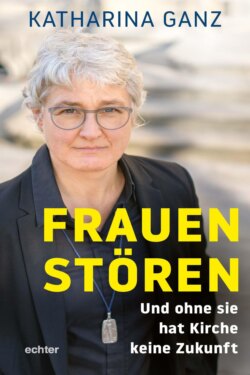Читать книгу Frauen stören - Katharina Ganz - Страница 7
Einleitung
ОглавлениеFrauen stören. Damit ist weit mehr gemeint als lästig werden mit Petitionen zu den Anliegen der Würde und Gleichberechtigung von Frauen in der römischkatholischen Kirche. Frauen stören produktiv das System einer Institution, die zutiefst klerikal und männerbündisch geprägt ist. Sie stören durch ihre Anwesenheit, durch einen anderen Blick, durch Fragen und Herangehensweisen, die sich unterscheiden und einseitige Perspektiven ergänzen. Dabei geht es nicht um besser oder schlechter, sondern eben um die Vielfalt, die entsteht, wenn Frauen und andere sich gleichberechtigt einmischen, einbringen und mitentscheiden.
Andrea Qualbrink, promovierte Pastoraltheologin und Referentin für Strategie und Entwicklung im Bistum Essen, hat den Titel meines Buches erstmalig geprägt.10 Als Beraterin für systemische Organisationsentwicklung konstatiert sie: „Führungskräfte stören ihr Unternehmen. Frauen in Führung stören viele Unternehmen mitunter noch viel mehr – auch die Kirche. Und Störungen tun Unternehmen und auch der Kirche gut. Was unverschämt klingen mag, ist eine schlichte systemtheoretische Beobachtung“.11 Allerdings lassen sich Organisationen nicht gerne stören, sondern folgen am liebsten bewährten Mustern. Damit riskieren sie Stillstand, verpassen wichtige Entwicklungen und laufen Gefahr, sich ins gesellschaftliche Abseits zu manövrieren und irrelevant zu werden. Eine „gute Führungskraft“ zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihrer Organisation Impulse gibt, sozusagen „produktive Störungen“ auslöst, indem sie „von der Zukunft und von sich verändernden äußeren Bedingungen her denkt und entsprechende Strategien anstößt“12.
In der Kirche geht es darum, die bleibende Gültigkeit des Lebens und der Lehre Jesu Christi in die jeweilige Zeit, in individuelle und gemeinschaftliche Lebenssituationen und Kulturen hinein zu buchstabieren. Biblische Grundbotschaft, Tradition und Glaubenslehre müssen sich in den Kontexten verschiedener Epochen, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, globaler Herausforderungen und persönlicher Lebenslagen bewähren (vgl. Gaudium et spes, GS 1).13 Dazu gilt es, sich auf ihre Kernbotschaft, Sinnhaftigkeit und Überzeugungskraft zu besinnen, weiterzuentwickeln und immer neu auszulegen. Getragen sind meine Ausführungen von der Überzeugung, dass die eigene Lebens- und Glaubenserfahrung eine wichtige Quelle der Gotteserkenntnis ist.
Trotz allem, was mich an meiner Kirche ärgert, frustriert, beschämt und an ihr zweifeln lässt, bin ich überzeugt, dass die einzigartige frohe Botschaft Jesu Christi nicht an Berechtigung und Kraft verloren hat. Das Christentum kann auch in unserer Zeit einen großartigen Beitrag leisten, um die Gottesfrage offenzuhalten und das Zusammenleben mit anderen Geschöpfen menschlicher, gerechter und achtsamer zu gestalten. Allerdings müssen wir – also die Kirche als Ganzes – bei uns selbst anfangen. Nur wenn die Strukturen unserer Kirche, die Verteilung von Macht, der Umgang mit den eigenen Mitgliedern und Ressourcen dem Geist Jesu Christi entsprechen, werden wir im 21. Jahrhundert noch etwas zu sagen haben, was neugierig macht, aufhorchen lässt und einen echten Mehrwert bedeutet für das individuelle und soziale Leben.14
Das wird aber nur gelingen, wenn sich die Kirche ihren eigenen Abgründen, ihrem Versagen und ihrer Schuld in aller Scham, Offenheit, Wahrheit und Ernsthaftigkeit stellt. Erst seit Februar 2021 und damit ein Jahr nach dem offiziellen Start des von der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) und dem Zentralkomitee der Deutschen Katholiken (ZdK) getragenen Synodalen Weges werden Betroffene aus dem Betroffenenbeirat strukturell in die Beratungen eingebunden und gehört. Das wurde höchste Zeit. In Online-Statements kamen Johannes Norpoth (Gelsenkirchen), Kai Moritz (Würzburg) und Johanna Beck (Stuttgart) beim Syodalen Weg am 4. Februar 2021 zu Wort. Sie beziehen ihre Autorität aus ihrer eigenen leidvollen Erfahrung von Missbrauch in der katholischen Kirche. Wie andere Traumaopfer bezeichnen sie sich als Überlebende, die dennoch nicht der Kirche den Rücken gekehrt haben, sondern sich aktiv einsetzen, Missbrauch entgegenzuwirken und Gewalt begünstigende Strukturen zu überwinden.
In stilistischer Parallelität zum Johannesprolog formulierte Johanna Beck, was der Ausgangspunkt der Beratungen zu notwendigen Reformen ist: „Am Anfang war die Missbrauchskrise. Die Missbrauchskrise war in der Kirche. Und die Kirche war in der Krise. Dieses war der Anfang des Synodalen Weges.“15 Die drei Sprecher*innen des Betroffenbeirates der DBK setzten Maßstäbe und betonten die Notwendigkeit des Willens zur individuellen und institutionellen Umkehr: Dazu gehört „alles daran zu setzen, dass diese ‚unfassbare Pervertierung des Evangeliums‘ beendet wird, und eine ‚radikale Reform der missbrauchsbegünstigenden Machtstrukturen‘ (Johanna Beck) zu erwirken. Das kann nicht dem persönlichen Ermessen und guten Willen Verantwortlicher überlassen bleiben; dazu braucht es belastbare Kontrolle und wirksame Begrenzung kirchlicher Macht – und heute und morgen den Mut zu handeln.“16 Die Kirche müsse sich ihrer Schuldgeschichte stellen. Das gehe nur mit „Haltung und Konsequenz, mit klarem Profil und Berechenbarkeit“ (Kai Moritz).17 Johannes Norporth verdeutlichte, dass der Synodale Weg „keine Therapie- oder Selbsthilfegruppe“ ist, sondern ein strukturierter Prozess, der „Zukunftsfragen unserer Kirche“ bearbeitet. Mit Blick auf die männlich verfasste Kirchenhierarchie schloss Norpoth bewusst mit dem Originalzitat von Adolph Kolping „Schön reden tut’s nicht, die Tat ziert den Mann!“
Der Synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland ist eine Chance, als Getaufte, Gefirmte, Gesandte und Geweihte einen gemeinsamen Weg zu gehen, der sich neu an der froh machenden Botschaft Jesu Christi ausrichtet und diese in unserer Zeit und Welt verortet. Mir macht Hoffnung, dass sich viele Teilnehmenden in den Foren und Versammlungen mit großem Freimut äußern und deutlich ihre Meinung vertreten. Auch die Stimme von Ordensleuten hat ein besonderes Gewicht, da sie rechtlich autonom und selten von den jeweiligen Ortsbischöfen abhängig sind. Zur Mitarbeit bereit war ich, als bekannt wurde, dass in den vier Foren keine Themen von vorneherein ausgeschlossen worden sind. Das war während des 2011 bis 2015 dauernden Gesprächsprozess anders, als der priesterliche Zölibat und die Frauenfrage tabuisiert waren. Meine Hoffnung ist, dass dieser Synodale Weg Antworten findet, wie das Evangelium Jesu Christi in der Kirche und Welt dieser Zeit in Deutschland inkarniert und inkulturiert werden kann. In meiner Sorge stimme ich dem Bochumer Pastoraltheologen Matthias Sellmann zu: „Es wäre aber naiv, die kulturelle Implosion zu unterschätzen, die eine Ergebnislosigkeit seiner Beratungen zur Folge hätte – kirchenintern wie -extern.“18
Ob der Prozess tatsächlich eine Erneuerung der katholischen Kirche in Deutschland bewirken kann, hängt wesentlich davon ab, ob es gelingt, offen und vorurteilsfrei, auf den Geist Gottes und aufeinander hörend in eine konstruktive Auseinandersetzung einzutreten.19 Das Hören und Zuhören sollte prozesshaft geschehen und ist von allen Beteiligten gefordert. Beim eucharistischen Hochgebet für besondere Anliegen heißt es: „Festige das Band der Einheit zwischen den Gläubigen und ihren Hirten.“ Dabei vermisse ich, dass diese Epiklese, die Bitte um die Geistsendung, ab und zu auch andersherum gebetet wird: „Festige das Band der Einheit zwischen den Hirten und ihren Gläubigen“.
Denn es gilt auch das Hören auf den sensus fidei fidelium, den Glaubenssinn der Gläubigen, also des Volkes Gottes, das in seiner Gesamtheit nicht irren kann.20 Wenn das Hören neue Einsichten ermöglichen soll, was Gott und Jesus Christus uns heute sagen wollen, muss es wechselseitig geschehen, darf nicht ein einseitiges Sprechen von oben nach unten bleiben oder kritiklose Unterwerfung fordern gegenüber der kirchlichen Hierarchie und gehorsame Befolgung der geltenden römisch-katholischen Lehre. In der gemeinsamen Verantwortung für die Bewahrung und zeitgemäße Weitergabe des christlichen Glaubens ist einerseits theologisch fundiert zu argumentieren und sich andererseits – antwortend auf die Zeichen der Zeit – über Ziele, Wege und Maßnahmen zu verständigen, die dem Geist Jesu Christi entsprechen. Nur so ist eine glaubwürdige Verkündigung des Evangeliums möglich. Angesichts der weltweit offenkundig gewordenen Missstände, die die Aufdeckung der Missbrauchsskandale sowie deren Vertuschung zum Schutz der Institution vor der Wahrnehmung der Interessen der Betroffenen zutage gefördert haben, ist dieser Weg in die Zukunft nicht ohne umfassende Strukturreformen sowie eine Weiterentwicklung der kirchlichen Lehre zu erreichen.
Dieses Buch soll Anstöße zu einigen Themen geben, die beim Synodalen Weg diskutiert werden. Methodisch gehe ich von biografischen Lebensstationen aus, die ich essayhaft erzähle, theologisch und spirituell reflektiere und mit Positionen aus meiner Gemeinschaft und eigenen Überzeugungen als feministisch-pastoraltheologisch denkende Franziskanerin verknüpfe.
Im ersten Teil verknüpfe ich Erlebnisse aus den beiden Mitgliederversammlungen der Generaloberinnen (UISG) 2016 und 2019 in Rom mit Fragestellungen, die innerkirchlich unter den Nägeln brennen und mit denen sich der Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland befasst. Im zweiten Teil blende ich zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Würzburgerin und Gründerin der Kongregation der Dienerinnen der hl. Kindheit Jesu, Antonia Werr (1813–68), an kirchlichen Strukturen gelitten und sich an Themen abgearbeitet hat, die uns heute immer noch beschäftigen. Im dritten Teil positioniere ich mich zu Aspekten, die insbesondere im Forum „Frauen in Diensten und Ämtern“ beim Synodalen Weg eine Rolle spielen sowie zu einigen Themen anderer Syndodalforen und veröffentliche Statements, die unsere Kongregation bei den wichtigsten beschlussfassenden Kapiteln für den Geltungsbereich unserer Konvente in Deutschland, in den USA und Südafrika verabschiedet hat.