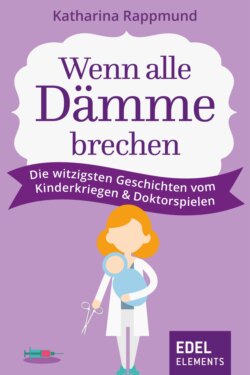Читать книгу Wenn alle Dämme brechen - Katharina Rappmund - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
FLIEGENDE CHEFSACHEN
ОглавлениеDer Chefarzt ist so etwas wie ein König. Ein Alleinherrscher, ein Potentat. Paradoxerweise wird er eingesetzt durch die mehr oder weniger demokratische Wahl eines Krankenhausgremiums, bestehend aus Aufsichtsräten und Verwaltungsdirektoren. Was ihn zu diesem Posten qualifiziert, ist in erster Linie eine Facharztausbildung, gepaart mit reichlich Erfahrung, einer medizinisch/strukturell/ökonomischen Vision und – an Universitäten unverzichtbar – der Habilitation. Wer keinen Professorentitel vorzuweisen hat, findet in den nicht universitären Kliniken sein Auskommen.
Heutzutage gehen auch die sogenannten »Soft Skills« wie Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie eine gewisse Führungsstärke in die Beurteilung eines Chefarztkandidaten mit ein. Als ich parallel zum Studium mit meinen Famulaturen im Krankenhaus begann, war das allerdings noch anders. Die einzigen Kriterien für eine Eignung zum Chefarzt schienen eine laute Stimme und eine gewisse Selbstherrlichkeit zu sein.
Professor Gerhard Singer galt im Landkreis als Koryphäe. Wer von den betuchten Ladies, die mit Sonnenbrille und Seidentuch im Haar gerne Sportcabrio fuhren, eine Unterleibsoperation benötigte, wandte sich an ihn. Seine Privatklinik war in einer wunderschönen alten Gründerzeitvilla untergebracht. Sie verfügte über einen lauschigen Garten für die rekonvaleszenten Damen und einen eigenen Steg, an dem seine Segeljacht und zwei kleine Ruderboote fest vertäut auf dem angrenzenden See schaukelten. Bei Föhn hatte man vom OP aus einen Panoramablick auf die Alpen. Es war einfach traumhaft.
In diesem gediegenen Ambiente sammelte ich meine ersten ausschließlich gynäkologischen Erfahrungen. Ich war in einer niedersächsischen Kleinstadt zur Schule gegangen und noch ein rechtes Landei. Vor der hektischen Unübersichtlichkeit der Universitätsklinik scheute ich zurück und schätzte mich glücklich, meine zweite Famulatur bei Professor Singer machen zu dürfen. Einige Bekannte meiner Mutter waren Patientinnen bei ihm und lobten ihn in den höchsten Tönen. Entsprechend aufgeregt radelte ich am ersten Tag in die Klinik.
Der Professor war, wie sich herausstellte, ein schlanker Herr Anfang fünfzig, der mit seinem stahlgrauen, leicht gewellten Haar und der randlosen Brille einen guten Werbeträger für Bankanlagen oder Versicherungen abgegeben hätte. Seine Augen strahlten blau, während er mich jovial lächelnd mit festem Handschlag begrüßte.
»Willkommen in meinem Schlösschen«, sagte er und wippte energetisch in seinen weißen, italienischen Lederslippern vor und zurück. Mir war auf Anhieb klar, warum die Frauen in Scharen in seine Klinik strömten. Diesem Charisma, das aus einer Mischung von gutem Aussehen, einer gewissen Arroganz und einer konzentrierten Zugewandtheit bestand, konnte keine widerstehen. Es war aufregend und einnehmend gleichermaßen. Ich schob die Schultern zurück und nahm mir vor, mein Bestes zu geben. Mich nicht dumm anzustellen. Ihn nicht zu enttäuschen.
Für Professor Singer arbeitete eine Assistenzärztin, ungefähr acht Jahre älter als ich. In der ganzen Zeit, die ich dort verbrachte, redete sie beständig über ihre Hämorrhoiden. Zuerst, dass sie damit Probleme habe. Einige Tage später berichtete sie ausführlich über ihren Besuch beim Proktologen, und später fehlte sie zwei Tage, weil sie sich die Hämorrhoiden hatte wegoperieren lassen. Danach hielt sie uns mit täglichen Beschreibungen ihrer Befindlichkeit auf dem Laufenden: ob sie sich bereits wieder setzen könne oder wie schmerzhaft ihr Stuhlgang doch sei. Ich lernte also wirklich viel über ihren Hintern. Doch manchmal fragte ich mich, warum sie das auch ihm erzählte. Ob das über die rein medizinische Fachsimpelei nicht doch ein wenig hinausging. Ob es vielleicht eine gewisse, subtile Anmache ihrerseits war. Oder ob er vertrauter mit ihrem Hintern war, als ich auf den ersten Blick annahm. Sie waren jedenfalls ein eingespieltes Team, wie sich vor allem im OP herausstellte.
Eines Tages assistierten wir beide Professor Singer bei einer vaginalen Gebärmutteroperation. Professor Singer saß auf einem Hocker zwischen den beinahe zum Spagat gespreizten Beinen der narkotisierten Patientin. Die Assistentin und ich quetschten uns auch noch jeweils rechts und links dazwischen, und hielten, mit dem Rücken an der Oberschenkelinnenseite der Frau lehnend, mit zwei Haken ihren Intimbereich weit auf. Es war also entsprechend eng, und wir beide verdrehten uns ganz anständig den Rücken. Das Undankbare an dieser Art der Operation ist, dass die assistierenden Ärzte überhaupt nichts sehen und daher kaum etwas lernen. Beugte ich mich, wie ich meiner Neugier entsprechend nicht umhinkonnte, ein wenig vor, um Einblick ins Geschehen zu bekommen, versperrte ich mit meinem Kopf die Sicht des Operateurs und kassierte einen mächtigen Anpfiff.
»Nimm deinen Holzkopf da weg!«, schnaubte Professor Singer sofort.
Er war ein wirklich heißblütiger Operateur. Jeden seiner Handgriffe begleitete er mit einem Ausruf wie »Ha!«, »Ja!«, oder »Jawoll!«. Wenn etwas nicht auf Anhieb klappte, dann warf er mit Flüchen um sich. Oder er ranzte einen von uns ungnädig an. Seine Assistentin kannte das offenbar und grinste unsichtbar hinter ihrem Mundschutz.
Der Herr Professor führte eine Konisation durch. Dabei wird ein Stück des Gebärmutterhalses abgeschnitten, weil es gefährlich veränderte Zellen aufweist. Häufig wird auf diese Weise ein beginnender Gebärmutterhalskrebs schon im Anfang ausgemerzt. Professor Singer hatte unter Fluchen den Konus entfernt und hielt das an der Kugelzange hängende Teil seiner Assistentin hin.
»Hier. Für die Pathologie.«
Sie gab es weiter an die OP-Schwester, die ihr eine nierenförmige Schale aus Edelstahl hinhielt, um das Fleischstückchen abzulegen. Doch leider war die daran hängende Zange zu schwer. Gemäß den Gesetzen der Gravitation rutschte das lange Instrument aus der Nierenschale und fiel zu Boden. Dabei riss es zwangsläufig den abgeschnittenen Gebärmutterhals der Patientin mit sich zu Boden. Es klirrte.
Professor Singer erstarrte.
»Was war das?« Seine Stimme klang drohend und überraschend leise.
»Ach, nichts weiter«, stammelte die OP-Schwester. Sie hatte offenbar ein vollkommen anderes Standing als Schwester Elfriede. »Ich heb den Konus nur eben wieder auf ...«
»Sie haben den Gebärmutterhals meiner Patientin fallen lassen?«, schrie Professor Singer sie an. Sein Kopf war plötzlich tomatenrot, und ich konnte seine Schläfenadern heftig hervorquellen sehen.
»Ist doch nicht so schlimm. Ich hab’s gleich«, sagte die Schwester summend, als beruhige sie ein Kleinkind, während sie sich bückte.
»Nicht so schlimm?«
Professor Singer trampelte auf der Stelle, während seine Hände an die Instrumente gebunden waren. »Ich geb Ihnen gleich Ihr ›Nicht so schlimm‹, Sie dumme Kuh!«
Und mit einem wilden Schlenkern des rechten Unterschenkels schleuderte er seinen OP-Clog durch den Raum. Er flog in einem beeindruckend hohen Bogen direkt in Richtung OP-Schwester und landete auf ihrem üppigen Hinterteil, bevor sie sich wieder aufrichten konnte. Sie sagte nicht einmal »Aua«. Sie streckte den Rücken durch, wechselte die Handschuhe und reichte Professor Singer das Nahtmaterial.
»Ich glaub’s einfach nicht!«, schimpfte der weiter vor sich hin, während sich seine Gesichtsfarbe langsam wieder normalisierte.
Er sprach mir aus der Seele.
Ich war wirklich erschrocken.
Wie konnte dieser eloquente, charmante und offenbar hoch gebildete Arzt sich so plötzlich in ein kleines Rumpelstilzchen verwandeln? Und warum schien es ihm überhaupt nicht peinlich zu sein? Er führte sich auf wie ein vierjähriger Trotzkopf, und alle taten so, als sei nichts geschehen. Das war doch nicht normal, oder?
Professor Singer war kein Einzelfall. An den weiteren Stationen meiner medizinischen Ausbildung geriet ich immer wieder einmal an einen dieser Choleriker. Sie schienen eine feste Riege in der Chefarztlandschaft zu bilden. Aber auch Oberärzte waren nicht gefeit vor solchen Aussetzern. Besonders anfällig für diese unangenehmen Umgangsformen schienen kleinwüchsige Chirurgen mit Napoleon-Komplex zu sein. Meist schwang in den Legenden über ihre Wutausbrüche eine gewisse Bewunderung mit. Wenn sie nicht im OP mit Schuhen schmissen, warfen sie eben mit Instrumenten oder beschimpften wahlweise ihre Assistenten, Sekretärinnen oder Krankenschwestern. Professor Singer war das erste Exemplar dieser Spezies, dem ich begegnete, und er hat sich deshalb besonders tief in mein Gedächtnis gegraben. Vor allem auch deshalb, weil er es gar nicht nötig gehabt hätte. Er war in seiner Privatklinik wirklich der uneingeschränkte Alleinherrscher. Alle unterstanden ihm, seine Assistenzärztin, dann die OP-Pfleger und -Schwestern und dann ich. An letzter Stelle stand die Reinigungsfrau, die immer bei Einbruch der Dunkelheit ankam, wenn Professor Singer in seinen Jaguar stieg. Er hätte gar nicht regelmäßig solch einen Aufruhr veranstalten müssen, denn es gab niemanden in seinem Reich, der an seiner Autorität gezweifelt hätte. Dass er uns dennoch beschimpfte, vielleicht aus Spaß, wegen erhöhten Blutdrucks oder weil er sich selbst nicht im Griff hatte, nahm ich ihm ziemlich übel.
In größeren Kliniken sieht es natürlich nicht anders aus.
Dort gibt es Chefärzte verschiedener Abteilungen, die sich in den unterschiedlichsten Gremien über den Weg laufen und womöglich um geschäftsführende Aufgaben konkurrieren. Es gibt habilitierte Oberärzte, die mindestens genauso schlau sind wie ihr Chef, und es gibt eine stattliche Anzahl junger, vor Testosteron strotzender Assistenzärzte, von denen der eine oder andere gerne auch mal eine kleine Revolte anzettelt – der Überstundenausgleich hat sich dafür stets bewährt. In diesen Zusammenhängen dient ein wöchentlicher Wutausbruch des Chefarztes der Aufrechterhaltung steiler Hierarchien, die schnelle Entscheidungsfindungen erst ermöglichen. Und damit der Stabilität des ganzen Systems. Ganz nach dem Prinzip L’état, c’est moi behält sich der Chefarzt (oder im Notfall auch sein oberärztlicher Vertreter) stets die letzte Entscheidung vor.
Das betrifft aber nicht nur die medizinischen Alternativen.
Professor Junghans, Vorgesetzter des bärigen Oberarztes Dresen, hatte eine Vorliebe ganz besonderer Art. Diese wirkte sich vor allem auf seine Einstellungspraxis aus. Es oblag einzig und allein ihm, aus dem Heer der sich bewerbenden Universitätsabsolventen und Jungmediziner die geeigneten Kandidaten für seine Abteilung auszuwählen. Da er sich offensichtlich von den vielfältigen Qualifikationen und den zahlreichen Bewerbungen überfordert fühlte, schien er sich die Sache dadurch zu erleichtern, dass er den infrage kommenden Personenkreis mit Hilfe der Bewerbungsfotos einschränkte. Der rothaarige Professor mit dem kleinen Kugelbauch schien eine Vorliebe für langbeinige, dunkelhaarige Damen zu haben. Das Ergebnis war dann eine langhaarige Brünette, die zusammen mit mir als neue Assistenzärztin anfing. Wir hätten Schwestern sein können, so ähnlich sahen wir uns. Als wir der Abteilung vorgestellt wurden, trafen wir dort auf Yvonne, eine weitere Brünette mit Hochfrisur, sowie auf Katja (der ich später beim Notkaiserschnitt half), die ihr braunes Haar offen unter einem Haarreif trug. Ganz offensichtlich waren Haarfarbe (braun) und Frisur (lang) die ausschlaggebenden Einstellungskriterien für die weiblichen Ärzte dieser Abteilung. Auf die Männer traf das natürlich nicht zu. Sie waren lang und dünn oder kurz und stämmig, hatten schiefe Zähne, Halbglatze oder Schmalzlocke und mussten sich nicht jeden Morgen die Haare in Form föhnen.
Katja und Yvonne trugen beide auffällig häufig, um nicht zu sagen täglich, Perlen-Ohrstecker. Das sah sehr gediegen und elegant aus, und ich fragte mich, ob das eine weitere Vorliebe meines neuen Chefs war. Ob er jeder seiner Assistentinnen womöglich anlässlich ihrer ersten selbstständig durchgeführten Operation ein Paar dieser Perlenstecker schenkte. Ob er sich einmal positiv über Perlen ausgelassen hatte oder ob sie beide einfach nur zufällig solch einen Spießergeschmack hatten. Denn ich trug damals am liebsten lang baumelnde Gehänge oder, als krankenhauskompatible Kurzversion, zwei unterschiedlich farbige Glassteine in den Ohren.
Im ganzen Krankenhaus war die gynäkologische Damenriege als die »Perlen-Fraktion« bekannt. Und ich wollte unbedingt dazugehören. Doch das war nicht nur durch Hakenhalten und Aktenschleppen getan. Vier Wochen später kaufte ich also von meinem ersten, schmalen Studentengehalt ein paar Ohrringe mit winzigen Süßwasserperlen.
Es gab nur eine einzige wirkliche Blondine in unserer Abteilung. Sie war eine tüchtige Operateurin mit weizenblondem Schwedenhaar und hatte Professor Junghans anlässlich einer Gastrotation durch ihr chirurgisches Geschick überzeugt. Doch sie lag regelmäßig im Clinch mit ihm. Entweder er zweifelte an einer ihrer Entscheidungen, oder sie widersprach ihm bei einer unserer Morgen-Besprechungen. Vielleicht waren sie auch deshalb die Einzigen, die ihre Meinungsverschiedenheiten öffentlich austrugen, weil wir aus der Riege der Brünetten insgeheim damit rechneten, den Chefarzt auf subtilere Art und Weise beeinflussen zu können. Keine von uns wagte es jemals, ihn öffentlich anzugehen. Wir versuchten dagegen, ihn mit unserem brünetten Charme von einer Therapie zu überzeugen. Ihn mit dem Zurückwerfen unserer Mahagoni-Mähne gnädig zu stimmen und uns vor Abmahnungen zu bewahren. Oder aufgrund unserer neuen, adretten, perlmuttfarben schimmernden Ohrstecker (das Einzige, was abgesehen von den Augen unter Haube und Maske zu sehen ist) mit in den OP genommen zu werden.
Im Nachhinein betrachtet, war das Ganze unglaublich peinlich.
Aber ist man erst mal in den Mühlen eines Systems und seinen Sachzwängen (und seien es braune Haare und Perlenohrringe) gefangen, kommt man da nicht so leicht wieder raus. Ich war deshalb froh, als meine Anstellung dort endete und ich mich zu neuen Ufern aufmachte. Die Perlenohrringe habe ich bis heute. Ich trage sie aber nur noch selten.
Als blutige Anfängerin ist man nicht nur abhängig von seinem Chefarzt. Die direkte Zusammenarbeit ist von der Gunst der vorgesetzten Assistenzärzte bestimmt. Denn sie sind diejenigen, die einen entweder informieren und mitnehmen oder einfach stehen lassen. Also heißt es, sich gut mit ihnen zu stellen. Assistenzärzte sind einem enormen Druck ausgesetzt. Sie müssen stets die akuten Fälle versorgen und entscheiden, ob sie das allein hinkriegen oder doch lieber den Oberarzt holen. Täuschen sie sich, könnte sich das negativ auf ihre Beziehung zum ausbildenden Oberarzt auswirken. Und der ist zumeist derjenige, der die Operationen einteilt und verwaltet. Will man seinen OP-Katalog zügig voll kriegen, also die für die Ausbildung notwendigen Operationen durchführen, dann sollte man sich Oberärzte nicht zum Feind machen.
Ich hatte nicht vor, bei meiner ersten OP vor dem Oberarzt dazustehen wie ein Volltrottel. Deshalb wollte ich schon im praktischen Jahr neben dem Blutabnehmen unbedingt auch das Nähen von Wunden lernen. Ich wusste aus Büchern und von meinen Einsätzen als Hakenhalterin, dass es verschiedene Arten des Wundverschlusses gibt. Die Einzelknopfnähte, bei der die gebogene Nadel einmal in die Haut rein und auf der anderen Seite der Wunde wieder ausgestochen wird. Dann wird verknotet und der Faden abgeschnitten. Und danach kommt der nächste Stich. Da diese Nahttechnik, ähnlich wie auch die wohlklingende Donati-Naht oder die prosaische Matratzen-Naht, hässliche Pünktchen-Narben hinterlassen kann, gibt es für kosmetisch sensible Bereiche auch die intracutane Naht. Dabei wird der Faden von Einstich zu Einstich versteckt durch die Haut gezogen und erst zum Schluss verknotet. Es fordert so viel Feinmotorik, als nähe man einen schmalen Saum. Doch einen Assistenten mit Zeit und Geduld zu finden, der einem diese vielfältigen Verschlusstechniken beibringt, ist gar nicht so einfach.
In meinem chirurgischen praktischen Jahr, nach meiner Famulatur bei Professor Singer und vor meinem Job bei Professor Junghans, hatte ich Nachtdienstpraktikum mit einem Gast-Arzt. In dieser Klinik wurde nicht kollegial gefragt, sondern per Dienstplan festgelegt, welcher Student wann Nachtdienst machen sollte. Ich hatte mir meinen Assistenten also nicht aussuchen können. Wäre es nach mir gegangen, ich hätte den schlanken, dunkelhaarigen, dauergebräunten Chirurgen genommen, der den Humor von Stefan Raab mit dem Aussehen von Antonio Banderas und dem Charme von Jude Law verband. Doch der war mir nicht vergönnt. Kein einziges Mal durfte ich mit ihm Nachtschicht schieben. Stattdessen traf ich also auf den Gastarzt. Er hatte große Aknenarben im Gesicht und irgendeinen schwerfälligen ausländischen Akzent, der mich an die Russenmafiosi der Vorabendserien erinnerte. Ich brauche wohl nicht zu betonen, dass er nicht gerade der Liebling des Chefarztes war, und auch ich fürchtete mich ein wenig vor ihm. Als an diesem Abend eine Privatpatientin verunglückte, musste er mit dem Chefarzt operieren. Dieser schien ihn bei der Operation auf die Probe stellen zu wollen. Er ließ dem Gastarzt freie Hand bei seiner Patientin, doch allen war klar, dass er ihm bei dem kleinsten Missgeschick die OP entziehen würde. Was das für seine Beurteilung bedeuten konnte, darüber wagte ich nicht zu spekulieren.
Die Spannung war in der Luft zu spüren. Die OP-Leuchten schienen intensiver zu brennen als sonst, die Hitze nahm beständig zu, und selbst die geschwätzige OP-Schwester hielt den Mund. Ich arbeitete hoch konzentriert, hielt die Haken zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle, gab ungefragt Strom und wies nonverbal auf noch blutende Stellen hin. Wir arbeiteten zusammen, als wären wir ein seit Jahren eingespieltes Team. Ich ahnte jede Bewegung des Gastarztes voraus, reagierte auf die kleinste Geste und kam ihm mit Tupfer und Licht zu Hilfe. Der Chefarzt machte nur einige wenige herrische Bemerkungen, doch im Großen und Ganzen verlief der Eingriff ohne Zwischenfälle. Das ganze Team atmete erleichtert auf, als der Chef als Erster den Saal verließ.
Natürlich bedankte sich der Gastarzt nicht bei mir. Ich war nur Praktikantin. Aber als später in der Nacht ein Mann mit einer großen Schnittwunde an der Hand in die Notaufnahme kam, rief er mich gleich dazu. Er zeigte mir geduldig die verschiedenen chirurgischen Knoten und ließ mich Stich für Stich die ganze Wunde nähen. Die Krankenschwester, die danebenstand und die Augen verdrehte, weil er eine Anfängerin ranließ, ignorierte er großzügig.
Nicht immer sind es nur die medizinischen Talente, die gefragt sind und mit denen sich kollegiale Beziehungen festigen lassen.
Als ich Assistenzärztin war, stieß eines Tages plötzlich eine neue Ärztin, Agatha, zu uns. Sie war etwas älter als ich und kam aus einem der ehemaligen Sowjetstaaten Litauen, Estland oder Lettland. Genau weiß ich das nicht mehr. Aber an eines erinnere ich mich noch sehr gut: Sie war bereits in ihrer Heimat fertige Ärztin, doch ihr Abschluss wurde bei uns nicht anerkannt. Um die Anerkennung zu bekommen, musste sie in Deutschland noch einige Zeit in einer Klinik arbeiten. Sie hatte deshalb einen merkwürdigen Vertrag, arbeitete Vollzeit, bekam aber nur so viel Gehalt wie ein Arzt im Praktikum. Es war erbärmlich, wie das Krankenhaus ihre Situation ausnutzte.
Agatha war klein und zierlich. Sie wirkte seit ihrem ersten Tag irgendwie fehl am Platze. Wie verkleidet stand sie neben uns auf dem Flur herum und lächelte. Hätte sie nicht diesen tiefschwarzen, strubbeligen Teufelsschopf auf dem Kopf gehabt, man hätte sie für ein feines Elfenwesen halten können und sich nicht gewundert, hätte sie ihren weißen Kittel ausgebreitet und wäre davongeflogen. Sie wurde meistens übersehen. Vom Chefarzt sowieso, aber auch von uns Kollegen. Wir wussten zunächst nicht viel mit ihr anzufangen. Wir konnten nicht einschätzen, was sie wusste. Was sie so draufhatte und was nicht. Bestimmt, so dachten wir, hatte sie dort im Osten andere Medikamente verwendet. Womöglich andere OP-Techniken erlernt. Und was den Umgang mit den Patientinnen anging, da waren wir auch eher skeptisch. Denn obwohl Agatha, wie sie sagte, Deutsch in der Schule gelernt hatte, gab es einige Kommunikationsprobleme. Die von ihr erstellten Krankengeschichten wiesen Lücken auf, und es kostete uns immer Extra-Zeit, sie nochmals mit den Patientinnen durchzugehen, um nichts zu übersehen. Auch war sie im Umgang mit dem Ultraschall recht unbedarft, was wahrscheinlich auf eine schlechte Ausstattung ihrer Heimatkliniken mit hoch auflösenden Geräten zurückzuführen war. Wie auch immer, stets holte sie einen von uns dazu, wenn sie ihre Ultraschall-Untersuchungen durchführte, was uns natürlich von unserer Routine-Arbeit abhielt. Die Arztbriefe und Abendvisiten erledigten sich ja schließlich nicht von allein. Irgendwie hatten wir alle den Eindruck, dass wir viel Zeit in Agatha investieren mussten und nur wenig zurückbekamen. Nicht jeder war davon angetan. Nicht jeder verfügte über dieses ärztliche Solidaritätsgefühl, eine Kollegin wochen-, ja monatelang durch Überstunden zu unterstützen, bis sie einigermaßen selbstständig arbeiten konnte. Wir seufzten viel und straften sie mit genervten Blicken, aber natürlich ließen wir sie nicht hängen. Sie tat uns leid.
Das änderte sich, als es wieder November wurde und der Dienstplan für die Weihnachtsfeiertage erstellt werden musste. Wie immer gab es ein großes Geziehe und Gezerre, wer denn an Heiligabend den Dienst bestreiten würde, wer den Hintergrunddienst übernahm und wer dafür im Gegenzug an Silvester dran war.
»Ich hatte letztes Jahr an Weihnachten Dienst. Dieses Jahr hab ich meinem Mann versprochen, dass ich eine Weihnachtsgans brate«, sagte die eine.
»Ich musste letztes Silvester in der Hintergrundbereitschaft wegen voreiliger Zwillinge und einer geplatzten Eileiterschwangerschaft zweimal von meiner Party weg. Mit Sprudel anstoßen ist doch öde!«, beklagte sich ein anderer.
Immer mehr wütende Schwiegereltern oder enttäuschte Kinderaugen wurden ins Feld geführt. Jeder legte sich ein noch schlagenderes Argument zurecht als der Nebenmann, um seinen Standpunkt überzeugend rüberzubringen. Wir saßen im Konferenzraum um den Dienstplan herum, senkten die Köpfe wie bei einem Pokerspiel und sahen uns nicht in die Augen. Plötzlich hörten wir Agathas helle Stimme, die mit einem Satz mit dem ihr eigenen, ungewöhnlichen Akzent unser aller Leben veränderte.
»Ich übernehme den Weihnachtsdienst freiwillig«, sagte sie.
»Ehrlich?«, fragte ich bewundernd. Und auch ein wenig misstrauisch. Warum wollte sich Agatha auf diese unglaubliche Art bei uns einschleimen? Anscheinend hatte sie es bitter nötig. Dafür tat sie mir natürlich sofort wieder leid. Mein Kollege mit den drei Kindern, der letztes Jahr weder Weihnachten noch Silvester Dienst gehabt hatte und eigentlich dran wäre, klopfte ihr freundschaftlich auf die Schulter.
»Super!«, sagte er nur und trug sich schnell am zweiten Weihnachtsfeiertag in den Dienstplan ein. Damit war die Sache für ihn erledigt. Er wollte offensichtlich kein Wort mehr darüber verlieren und erhob sich schon mal, um den Raum zu verlassen.
»Das macht dir auch wirklich nichts aus?«, fragte die andere Kollegin ungläubig. Der dreifache Vater sah sie an, als würde er ihr am liebsten eine Sauerstoffmaske überstülpen, um sie zum Schweigen zu bringen. Was, wenn Agatha uns allen nur ein schlechtes Gewissen machen wollte?
»Ich kann das von jetzt an jedes Weihnachten tun.«
Es war, als lege sie absichtlich noch einen drauf. Als erhöhe sie gezielt den Einsatz. Dabei zeigte sie ihr typisches, geduldiges Lächeln. Wir waren platt. Keiner wusste so recht, was er von diesem Angebot halten sollte. Ob wir es wirklich annehmen durften oder ob das nur eine weitere gnadenlose Ausbeutung von Agatha wäre, die nicht einmal der dreifache Vater über sich brachte.
»Das sehen wir dann im nächsten Jahr«, sagte er beschämt.
»Nein. Ist schon okay. Ich bin Jüdin, wisst ihr. Wir feiern Weihnachten gar nicht. Wir feiern Chanukka.«
»Du bist Jüdin?«
»Sie ist Jüdin!«
»Ist ja toll!«
»Was ist Chanukka?«
Wir quasselten alle aufgeregt durcheinander. Agatha lächelte weiter und erklärte uns alles ganz genau. Erst jetzt erfuhren wir, dass auch sie verheiratet war und zwei Kinder hatte. Dass Chanukka ein achttägiges religiöses Lichterfest der Juden ist, an dem die Kinder Geschenke bekommen und Agatha gerne Kartoffelpfannkuchen machte. Eine Welle von Erleichterung und Dankbarkeit erfasste uns alle.
»Selten überschneiden sich die Chanukka-Tage mit Weihnachten. Aber bestimmt nicht in den nächsten Jahren, soviel ich weiß«, sagte Agatha.
»Du kannst die ganzen acht Tage dienstfrei haben, wir wechseln uns dann eben öfters ab«, sagte einer, und wir alle nickten.
Wir waren froh, dass wir dieses Geschenk nicht als Almosen annehmen mussten. Wir wollten nicht allzu sehr beschämt werden von diesem fremdartigen, freundlichen Wesen. Deshalb machten wir sie postwendend zu einer von uns. Wir fragten sie um Rat, nahmen sie mit zum Essen und deckten sie, wenn nötig, auch mal vor dem Chefarzt. Wir fanden heraus, dass sie über einen feinen, ironischen Witz verfügte und hervorragend EKGs lesen konnte. Eine Fähigkeit, die den meisten Gynäkologen abgeht. Und als der Tag kam, an dem sie ihre Anerkennung erhielt, machten wir uns stark dafür, dass sie fest angestellt wurde. Eine Hand wäscht die andere, so heißt es doch. Und wir wollten Agatha auf keinen Fall mehr verlieren.