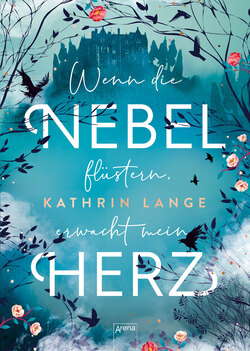Читать книгу Wenn die Nebel flüstern, erwacht mein Herz - Kathrin Lange - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDas zweite Mal über den Zaun zu kommen, war mühsamer als zuvor, weil ihr Knie von dem Zusammenprall mit dem Idioten noch ein bisschen schmerzte. Aber sie hatte schon Schlimmeres ausgehalten, darum gelang es ihr auch diesmal, auf die andere Seite zu klettern. Der Weg dahinter allerdings zog sich jetzt wie Kaugummi. Nässe drang durch Jessas Stiefel und machte ihre Socken rau und klebrig. Die Haare hingen ihr in wirren, feuchten Strähnen ins Gesicht. Ihre Schultern schmerzten, obwohl ihr Rucksack nur wenige Habseligkeiten enthielt. Sollte sie vielleicht doch lieber umkehren? Was zog sie schließlich hierher außer einem vagen Gefühl aus einem Traum?
Sie blieb stehen. Es waren Meilen zurück bis nach Haworth und ein weiterer Bus würde so schnell vermutlich nicht kommen. Außerdem wollte sie diesem arroganten Arsch auf keinen Fall die Genugtuung gönnen, sie vertrieben zu haben.
Also marschierte sie weiter. So weit konnte es schließlich bis zu dieser bescheuerten Ruine nicht mehr sein.
Irgendwann machte der Weg eine Biegung. Wenn High Moor Grange nach der nächsten Kurve nicht auftauchte, würde sie wirklich umdrehen.
Die nächste Kurve kam, in der Mauer direkt dahinter wuchs ein krüppelig aussehender Busch. Missmutig starrte Jessa die Nebelfetzen an, die in den nassen Zweigen hingen, und dann zuckte sie zusammen, weil sich direkt vor ihr eine Gestalt aus dem Nebel schälte. Im ersten Moment sah es so aus, als habe sie keinen Kopf, doch als Jessa genauer hinsah, erkannte sie, dass die Gestalt eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen hatte.
Mit klopfendem Herzen blieb sie stehen.
»Hallo?«, rief sie. Ihre Stimme kam ihr piepsig vor, das ärgerte sie.
Die Gestalt regte sich nicht. In dem einheitlichen, konturlosen Grau wirkte sie knochenbleich und schweigsam.
Zögernd machte Jessa den nächsten Schritt. »Entschuldigen Sie …«, begann sie und dann musste sie über sich selbst lachen, als sie erkannte, was sie da vor sich hatte.
Es war eine Marmorstatue! Wie peinlich!
Sie ging näher heran, schaute der Skulptur ins Gesicht. Es war die Darstellung einer Frau in antiken Gewändern. Das, was Jessa für eine Kapuze gehalten hatte, war eine Art Schleier, der die Haare und auch die Stirn der Figur bedeckte. Ihre Züge wirkten edel und sehr traurig – fast wie die einer Grabstatue.
Als der Nebel sich kurz lichtete, schweifte Jessas Blick nach links.
Eine ganze Reihe dieser kalten Marmorgestalten säumten den Weg, alle hielten sie die Köpfe gesenkt, alle sahen sie so betrübt und verloren aus wie die erste. Jessa musste an eine Armee verzauberter Jungfrauen denken, die von einem unheilvollen Fluch auf ewig hier an diesen trostlosen Ort gebannt worden waren.
»Sei nicht albern!«, ermahnte sie sich. Gruselig, wie der Nebel ihre Stimme erstickte!
Sie folgte der Reihe der Statuen eine kleine Anhöhe hinauf und endlich schälten sich Gebäudeumrisse aus dem Nebel. Gleich darauf stand sie vor einer Ruine. Sie sah verfallene Gebäudeteile ohne Dächer, leere Fensterhöhlen und eine Freitreppe, der wie einem schadhaften Gebiss ganze Teile fehlten. Ein halb eingestürzter Turm überragte all das.
Es sah unheimlich aus, wie die Fassade sich hinter den Nebelschwaden verbarg, freigegeben wurde, wieder verschwand. Die leeren Fenster wirkten wie blinde Augen und es fiel Jessa nicht schwer, sich vorzustellen, wie der Wind in ihnen sang, wenn es einmal nicht neblig war. Für eine Sekunde glaubte sie, Stimmen und Gelächter von längst verstorbenen Menschen zu hören, die durch die Jahrhunderte zu ihr wehten.
Sie fröstelte. Was jetzt?
Da war keine Spur von dem Gefühl von Alice’ Nähe. Was hatte sie auch erwartet?
Jessa überlegte. Das Gemäuer war gruselig. Sollte sie es sich trotzdem genauer ansehen? Unentschlossen biss sie sich auf die Innenseite der Wange.
Warum eigentlich nicht? Schließlich hatte sie einiges auf sich genommen, um hierherzukommen. Sie rieb sich das schmerzende Knie, dann trat sie mit einem Anflug von Nervosität näher an das verfallene Anwesen heran. Obwohl die Sonne nicht schien, fühlte es sich an, als falle ein Schatten auf sie. Ihr Herzschlag beschleunigte sich. Ein schwaches Kribbeln erfasste ihre Haut, aber das war vermutlich nur die Aufregung.
Bei der Freitreppe wandte sie sich nach links. Der Nebel war so nah beim Gebäude nicht mehr ganz so dicht, trotzdem suchte Jessa mit einer Hand an der Mauer Orientierung. Sie kam an eine Hausecke, umrundete sie und kurze Zeit später erreichte sie eine Treppe, die zu einer Terrasse hinaufführte, auf der die kaputten Fenster bodentief waren. Die Stufen der Treppe waren mit Terracottafliesen belegt, von denen keine einzige mehr intakt war. Einen Fuß vor den anderen setzend, tastete Jessa sich nach oben und dort bis zu einem der leeren Fenster.
Glasscherben knirschten unter ihren Stiefeln. Vor ihr befand sich ein altmodischer Salon. Jessas Blick wanderte über Polstermöbel, deren geblümter Stoff verblasst und modrig wirkte. Auf einem Tisch lag fingerdicker Schmutz, genauso wie auf dem benutzten Teegeschirr und der Etagere mit längst verrotteten Sandwiches.
Es sah aus, als seien die Bewohner vor Jahrzehnten nur mal eben zu einem Spaziergang ins Moor aufgebrochen und nie wieder zurückgekommen. In einem Kamin, in dem bestimmt schon seit hundert Jahren kein Feuer mehr gebrannt hatte, lag ein Haufen hereingewehter Blätter. Der Spiegel über dem Kaminsims war erblindet. Unheimlich!
Jessa musste sich ein Herz fassen, um durch den leeren Fensterrahmen ins Haus zu steigen. Auch drinnen knirschten Glasscherben unter ihren Sohlen. Es herrschte eine dumpfe, undurchdringliche Stille, die fast etwas Lebendiges hatte. Lauschend blieb Jessa stehen. Täuschte sie sich oder sang da jemand? Ganz kurz glaubte sie, die Melodie eines alten Kinderliedes zu hören, das Alice früher immer gesungen hatte. Aber als sie die Luft anhielt, war da nur das Blut, das in ihren Ohren rauschte.
Sie setzte einen Fuß vorwärts … und brach durch das morsche Parkett. Ihr Schienbein schrammte schmerzhaft an der Holzkante entlang, aber zum Glück stieß ihr Fuß nach kaum zwanzig Zentimetern auf irgendein Hindernis, sodass sie nicht stürzte.
Leise fluchend zog sie ihr Bein aus dem Loch und untersuchte es. Sie hatte sich die Haut aufgeschürft, doch das meiste hatte ihre Jeans abgekriegt. Nicht weiter schlimm.
Sie richtete sich auf und sah sich um. Plötzlich kam sie sich unendlich albern vor, weil sie sich von einem Gefühl aus einem Traum hierher hatte locken lassen.
Kopfschüttelnd durchquerte sie den kleinen Salon und verließ ihn durch eine Tür, die schief in den Angeln hing. Ein breiter Gang erstreckte sich in beide Richtungen. Der Boden war mit einem langen rostroten Läufer bedeckt. Mehrere Türen gingen von dem Flur ab und zwischen ihnen hingen Gemälde mit den Porträts von schlecht gelaunten Herren und Damen aus früheren Jahrhunderten.
Am Ende des Ganges lag eine Tür mit Glaseinsätzen, in die stilisierte Bücher geätzt worden waren. Aus irgendeinem Grund kam ihr der Anblick bekannt vor.
Erneut fröstelte sie.
»Alice?« Bevor sie wusste, was sie tat, hatte sie den Namen ihrer Schwester geflüstert.
Es schien, als würde das Wort von den Wänden widerhallen.
»Alter!«, murmelte Jessa.
Dann ging sie zu der Tür mit den Büchern darauf.
Der Geruch der alten Bücher, dieses feine Aroma von Leder und Papier, war einer von Adrians Lieblingsgerüchen, darum hielt er sich oft allein in der Bibliothek auf. Er stand an einem der bodentiefen Sprossenfenster und sah zu, wie der Nebel vor der Scheibe waberte. Er wusste, dass Christopher bei diesem Wetter unruhig und reizbar war, und er war froh, dass es ihm vorhin gelungen war, ihn mit dem Schachspiel wenigstens für ein paar Stunden abzulenken. Aber jetzt war dieser Idiot mit seinem Motorrad dort draußen und Adrian machte sich Sorgen um ihn. Zwar gab es nicht wirklich einen Grund dafür, schließlich würde Christopher selbst bei einem schweren Unfall nicht sterben, aber trotzdem erfüllte es Adrian mit Grauen, wenn er daran dachte, wie Christopher durch den dichten Nebel bretterte.
Er schüttelte den Kopf, wandte sich vom Anblick des Nebels ab und trat vor das Regal mit naturwissenschaftlichen Büchern, die noch sein Vater gesammelt hatte. Langsam ließ er die Fingerkuppen über die Rücken wandern. Bei der Erstausgabe von Darwins Über die Entstehung der Arten, von der er Christopher vorhin erzählt hatte, hielt er inne. Ein wehmütiges Gefühl stieg in seinem Innersten auf. Wie stolz sein Vater gewesen war, dieses Buch zu besitzen! Darwin persönlich hatte es signiert.
Adrian zog den schweren Band heraus und nahm ihn mit zu der Ledercouch vor dem Kamin. Das Feuer im Kamin, das er entzündet hatte, um die klamme Kälte aus dem Raum zu vertreiben, knackte leise. Er setzte sich und schlug die erste Seite auf. Eine Weile betrachtete er die verschnörkelten Buchstaben von Darwins Handschrift, dann blätterte er weiter. Er wollte gerade anfangen zu lesen, als er glaubte, eine Stimme zu hören.
»Alice?«
Adrians Kopf ruckte hoch. »Nein!«, keuchte er.
Die Glastüren schwangen mit einem durchdringenden Quietschen auf. Jessas Blick fiel auf hohe Bücherregale, deren Inhalt teilweise herausgerissen und zu Haufen auf dem staubigen Boden aufgeschichtet dalag. Die gerafften Vorhänge an den zerborstenen Fenstern waren zerschlissen, ihre Farbe kaum noch zu erkennen. Ein riesiger, seit Jahrhunderten erkalteter Kamin war mit Spinnweben überzogen, überall lag der Staub fingerdick und etliche der Bücher, die noch in den Regalen standen, schienen von einer grünen Schicht überzogen zu sein, die wie Moos aussah. Jessa glaubte, Wasser von den Wänden tropfen zu hören. Ihr Blick glitt zu einer uralten, rissigen Ledercouch, aus der die Polsterung quoll. Genau in diesem Augenblick erstarrte sie.
Denn vor dem Sofa stand jemand.
Als ihr Blick ihn streifte, wandte er ihr wie von der Tarantel gestochen den Rücken zu. Alles, was sie zu sehen bekam, war ein dunkelgrauer Hoodie, dessen Kapuze der Typ hastig über den Kopf zog. Seine Haltung wirkte irgendwie eigenartig: leicht vorgebeugt wie bei einem alten Mann und gleichzeitig sprungbereit und voller Spannung. Eines der alten Bücher lag aufgeschlagen auf der zerschlissenen Couch. Hatte der Typ etwa hier in all diesem Dreck gesessen und gelesen?
»Bitte«, stieß er eigenartig flehentlich hervor. »Geh! Verlass diesen Ort so schnell es geht!«
Vor lauter Verwirrung rettete sich Jessa in das Mittel, das ihr schon oft in brenzligen Situationen geholfen hatte. Sie stellte sich stur. »Und wieso?«, gab sie ziemlich unfreundlich zurück. Sie erwartete, dass der Typ sich zu ihr umdrehen würde, aber das tat er nicht.
»Weil du uns in Gefahr bringst«, sagte er. Er hatte eine unheimliche Stimme, flach, irgendwie wie ein Rascheln. »Vor allem meinen Bruder.«
»Ich bringe niemanden in …«, setzte Jessa an, aber sie wurde rüde unterbrochen, weil der Motorradtyp plötzlich auf der anderen Seite des Raumes auftauchte.
»Was zur Hölle machst du hier?« Auch seine Stimme war flach und tonlos, aber im Gegensatz zu dem anderen klang er zornig.
»Wer ist sie?«, stieß der Typ mit der Kapuze hervor. »Was sucht sie hier?«
»Ganz ruhig, Adrian«, sagte der Motorradtyp. »Ich sorge dafür, dass sie sofort wieder verschwindet.« Mit weit ausgreifenden Schritten eilte er auf Jessa zu und seine Stiefel wirbelten dabei eine Menge Staub auf. »Ich habe dir gesagt, dass das hier Privatbesitz ist!«, fauchte er und bedrängte sie mit dem ganzen Körper. »Wie kannst du es wagen, hier trotzdem …«
»Ist ja schon gut!«, fiel Jessa ihm ins Wort. Sie wusste, sie war in der Defensive, und so reagierte sie auf die einzig mögliche Weise. Mit erhobenen Händen wich sie zurück. »Ich wollte …«
»Interessiert mich nicht! Verschwinde von hier!« Sein verzerrtes Gesicht und das fassungslos-zornige Funkeln in seinen Augen machten ihr Angst. Weil sie nicht sofort kehrtmachte, packte er sie grob am Arm.
»Aua!«, protestierte sie. »Du tust mir weh!«
»Umso besser! Dann merkst du’s dir hoffentlich diesmal.« Er warf dem Kapuzentypen, den er Adrian genannt hatte, einen Blick zu, dann zerrte er Jessa mit sich.
Sie wehrte sich, versuchte, seine Finger von ihrem Arm zu lösen, aber sein Griff war erbarmungslos. Außerdem hatte er mindestens doppelt so viel Kraft wie sie. Es nützte überhaupt nichts, dass sie die Füße gegen den Boden stemmte – er zog sie einfach weiter, als würde sie sich überhaupt nicht sträuben.
»Henry!«, schrie er, als sie eine riesige Halle erreichten, in der staubige Spinnweben wie zerschlissene Vorhänge von der Decke und den umlaufenden Galerien hingen und rostige Rüstungen herumstanden. Scheiße, wie viele Typen rannten in diesem gammeligen Kasten denn noch rum?
»Henry! Henry! Herrgott noch mal! Wo steckt dieser Trottel, wenn man ihn braucht?«
Da sich der Trottel offenbar in Luft aufgelöst hatte, zerrte der Typ Jessa weiter, durch eine verborgene Tür in einen schmalen und schmucklosen Gang, der durch eine Art Waschküche hinaus ins Freie führte.
Sie überquerten den mit Unkraut überwachsenen Innenhof und steuerten den Stall an. Mit Wut stieß der Motorradtyp eines der Tore auf, es krachte gegen die Wand und eine riesige Staubwolke wallte auf. Vorbei an mehreren leeren Pferdeboxen zog er sie zu einer, in der sein Motorrad aufgebockt stand.
»Stehen bleiben da!«, kommandierte er, nachdem er Jessa mitten in den Gang gestellt hatte wie eine Schaufensterpuppe.
Er holte die Maschine aus der Box, packte einen Helm, der auf einer alten Futterkiste gelegen hatte, und knallte ihn ihr vor den Bauch. »Aufsetzen!«
»Vergiss es!« Wütend schleuderte sie das Ding fort.
Er schaute zu, wie es in eine Ecke kullerte. Eine seiner Augenbrauen hob sich. »Also gut. Dann eben ohne.« Mit einer eleganten Bewegung schwang er das Bein über den Sitz. »Aufsteigen!«
Diesmal gehorchte sie. Es blieb ihr ja schließlich auch nicht viel anderes übrig. Sie legte die Arme um ihn. Er war angespannt. Sein gesamter Körper schien aus Stein zu sein wie die Marmorstatuen dort draußen.
Er wartete, bis sie sicher saß, startete die Maschine und fuhr durch das offene Tor hinaus in den Nebel.
Zum zweiten Mal brachte Christopher die Kleine mit den unmöglichen Haaren vom Grundstück und bis zur Straße, doch diesmal begnügte er sich nicht damit, sie in einen Bus zu setzen.
Diesmal fuhr er sie nach Haworth und während er die fast schnurgerade Landstraße an Watersheddles Reservoir mit überhöhter Geschwindigkeit entlangjagte und dabei ihre Arme um seinen Körper spürte, wurde ihm bewusst, dass er unfassbar leichtsinnig war. Er war es so sehr gewohnt, sorglos zu sein und zu schnell zu fahren, dass er völlig vergessen hatte, wie gefährlich das für dieses Mädchen war. Es war noch immer nebelig und wenn er mit ihr hinter sich auf dem Bike einen Unfall baute, dann würde das nicht so glimpflich für sie ausgehen wie bei ihrem ersten Zusammenstoß. Er drosselte die Geschwindigkeit ein ganzes Stück.
»Was ist?«, schrie sie gegen den Fahrtwind an. »Hast du Schiss bekommen, oder was?«
Ihre Coolness nötigte ihm fast so etwas wie Respekt ab und er wusste nicht, was er antworten sollte. Im Grunde hatte sie ja recht: Er hatte Schiss, dass ihr etwas passierte. Aber das konnte er ihr ja wohl kaum sagen. Er schüttelte den Kopf und war froh, dass sie das als Antwort akzeptierte. Den Rest der Fahrt hielt sie zu seiner Erleichterung die Klappe.
Vor dem Brontë-Hotel hielt er an und wartete, bis sie abgestiegen war. »Heute fährt kein Bus mehr«, erklärte er. »Darum wirst du hier übernachten und morgen dann dorthin zurückfahren, woher du gekommen bist.«
»Und wer hat dir weisgemacht, dass du das zu bestimmen hast?«
Herrgott noch mal! Wie konnte man nur so widerspenstig sein? Er kletterte ebenfalls vom Motorradsitz. Leicht breitbeinig baute er sich vor ihr auf und setzte seine finsterste Miene auf. Aber sie ließ sich nicht im Geringsten davon beeindrucken. Mit blitzenden Augen hielt sie seinem Starren stand. Und er war tatsächlich der Erste, der den Blick senkte. Scheiße! Irgendetwas musste er unternehmen, damit sie nicht spätestens morgen erneut auf dem Anwesen aufkreuzte und Adrian und ihn damit in unfassbare Gefahr brachte.
»Ich will dich nur schützen«, sagte er.
»Klar. Schützen!« Sie schnaubte spöttisch. »Für wen hältst du dich? Für Robin Hood, oder was?«
Ihre Frage ließ ihn seufzen. »Glaub mir einfach, wenn ich sage, dass es gefährlich für dich ist, auf High Moor Grange rumzulaufen. Und mit High Moor Grange meine ich alles, was sich von hier aus gesehen jenseits des verschlossenen Tores befindet.« Er hätte sie am liebsten geschüttelt, als sie die Augen verdrehte.
»Dieser Typ«, sagte sie und bewies damit, dass sie nicht vorhatte nachzugeben, »dieser Adrian. Was ist mit ihm? Warum hockt er in diesem staubigen, verfallenen Gemäuer? Und warum zeigt er sein Gesicht nicht?«
Weil der Anblick dir den Verstand rauben würde! »Nichts davon geht dich auch nur das Geringste an!«
Kurz sah sie aus, als wollte sie ihm widersprechen, doch dann zuckte sie ziemlich gleichgültig mit den Schultern. »Logisch.« Ihr Blick wanderte an der Fassade des Hotels hinauf. »Ich habe kein Geld, um hier zu übernachten.«
Na, was für eine Überraschung! So wie sie aussah, lebte sie sonst vermutlich auf der Straße.
»Komm mit!« Er marschierte direkt zur Rezeption des Hauses, das im typischen englischen Landhausstil eingerichtet war. Im Gehen zog er eine Geldbörse aus der Hosentasche und entnahm ihr seine schwarze Kreditkarte, die er der Rezeptionistin auf den Tresen legte. »Die junge Lady hier braucht ein Zimmer für eine Nacht.«
»Ich lasse mich von dir nicht aushal…«
»Halt einfach die Klappe!«, fuhr er ihr über den Mund. Dann lächelte er die Rezeptionistin an. »Meine Cousine hier sollte eigentlich bei uns übernachten, aber leider haben wir einen Wasserschaden.«
»Wie ärgerlich!«, flötete die Frau und bekam ganz rote Wangen.
Jessa musste ein Lachen unterdrücken, als sie sah, wie die Rezeptionistin auf den Blödmann reagierte. Wie alt bist du?, dachte sie. Dreizehn?
Bis eben war sie voller Widerstand dagegen gewesen, sich das Hotelzimmer von diesem Blödmann bezahlen zu lassen, aber was wäre die Alternative? Irgendwo im Freien auf einer Parkbank zu schlafen, bevor sie sich morgen mit dieser Ms Galloway treffen konnte? Vielleicht sollte sie ja das Zimmer als kleine Wiedergutmachung für die rüde Behandlung des Typen verstehen. Sie rieb sich das Handgelenk, an dem noch die Abdrücke seiner Finger zu sehen waren.
Der Blödmann sah es und warf ihr einen finsteren Seitenblick zu, der in ihr das Bedürfnis wachrief, ihn zu beleidigen. »Wahrscheinlich bist du es gewohnt, dass alles, was Titten hat, dir in null Komma nichts ohnmächtig vor die Füße sinkt, oder?«
Die Rezeptionistin schnappte nach Luft. Pamela stand auf einem kleinen Schild an ihrem Revers.
Der Typ starrte Jessa an. »Ich verstehe das als rhetorische Frage«, erwiderte er.
»Oh. Sehr bescheiden.« Seine betont überlegene Haltung ging ihr auf die Nerven, aber noch viel mehr ärgerte es sie, dass sie sich überhaupt über ihn aufregte.
Pamela schien peinlich berührt von ihrer Kabbelei. Sie wandte sich ab und gab ein paar Informationen in einen Computer ein. »Wir haben zwei sehr hübsche Einzelzimmer«, sagte sie geschäftig. »Allerdings liegen sie beide zur Straße raus.«
»Egal. Eins davon nehmen wir.« Die Worte kamen undeutlich heraus und überrascht stellte Jessa fest, dass der Typ sich auf einmal den rechten Nasenflügel zuhielt. Plötzlich wirkte er hektisch.
»Mit oder ohne Frühstück?«, fragte Pamela.
Der Blick des Arschlochs glitt an Jessa hinab. »Mit«, sagte er.
»Sehr gern.« Mit einem Strahlen nahm Pamela seine Karte, zog sie durch ein Lesegerät. Jessa verrenkte sich fast den Hals, um den Namen zu erkennen, der daraufgedruckt war.
»Christopher«, half der Typ ihr aus.
Die Scham, weil er ihre Neugier bemerkt hatte, ließ ihre Wangen glühen. »Bilde dir bloß nichts ein«, murmelte sie.
Er grinste breit. »Tue ich nicht, keine Sorge.« Noch immer hielt er sich die Nase zu.
Pamela unterbrach ihr Geplänkel, indem sie sich an Jessa wandte. »Dann brauche ich noch Ihren Namen und Ihre Anschrift.«
Jessa vertrieb die letzten Skrupel darüber, sich das Zimmer bezahlen zu lassen. Entschlossen trat sie dichter an den Tresen heran. »Jessica Downton«, sagte sie.
Und hörte den Typen hinter sich scharf Luft durch die Zähne ziehen.
Er wusste nicht, was ihn mehr schockierte: die Tatsache, dass das Nasenbluten sehr viel schneller einsetzte als gewöhnlich, oder das, was er eben gehört hatte. Seine Gedanken stolperten.
Die Kleine … sie war …
Sie ist Alice’ Schwester?
Es fühlte sich an, als hätte sich der Boden unter seinen Füßen in hauchdünnes Glas verwandelt. Während er mit der einen Hand versuchte, die Blutung zu stoppen, suchte er mit der anderen Halt an dem Tresen der Rezeption.
Jessas Augen waren weit aufgerissen. »Scheiße!«, murmelte sie und für einen kurzen, irrationalen Moment fürchtete er, sie wusste Bescheid darüber, was mit Alice geschehen war. Dann jedoch ging ihm auf, dass sie wegen des Blutes erschrocken war.
Mist! Das hätte sie eigentlich nicht sehen sollen.
Er riss sich zusammen. »Kein Grund, hysterisch zu werden«, sagte er so ruhig, wie er konnte, nahm ein Taschentuch heraus, wischte sich damit Nase und Oberlippe und dann auch noch die blutigen Finger sauber. Während er das tat, sah er Pamela an. »Sind wir fertig?«
Die Rezeptionistin hatte ein leises »Oh!« ausgestoßen, als sie das Blut bemerkt hatte. »Ja«, bestätigte sie jetzt und deutete auf das Taschentuch in seinen Händen. »Kann ich …«
»Nicht nötig. Es ist nichts.« Schon wieder musste er sich das Nasenloch zuhalten, weil neues Blut nachkam. Auch die üblichen Schmerzen kündigten sich jetzt in seinem Hinterkopf an. Es wurde Zeit, dass er von hier verschwand. Er ließ sich von Pamela seine Kreditkarte wiedergeben, dankte ihr und nickte Jessa knapp zu. »Denk dran: Bleib weg von ….«
»Schon klar!«, grummelte sie und Christopher wartete auf ihr übliches Augenrollen. Aber es kam nicht und er spürte, dass sie verunsichert war. Logisch. Mittlerweile musste er auf sie einen ziemlich melodramatischen Eindruck machen: blutend und vermutlich auch aschfahl, wie er es wegen der Kopfschmerzen immer wurde. Er tat so, als sei alles völlig normal.
»Versprich es mir!«, verlangte er.
»Ich verspreche es!« Nun verdrehte sie doch die Augen.
Na also! Fast hätte er gelächelt.
Stattdessen machte er auf dem Absatz kehrt und sah zu, dass er von hier verschwand. Wenige Momente später saß er wieder auf der Maschine und drehte das Gas bis zum Anschlag auf. Das kraftvolle Wummern der Enduro schien sich in Worte zu verwandeln: Sie ist Jessa. Sie ist Alice’ Schwester. Alice’ Schwester. Schwester. Ihre Schwester …
Als er Haworth hinter sich gelassen hatte, warf er den Kopf in den Nacken und stieß einen lang gezogenen Schrei aus, der sich irgendwo über den Bergen im Nebel verlor.
Adrian erwartete ihn beim Stall. Besorgt schaute er Christopher entgegen, und natürlich sah er die Spuren des Blutes in seinem Gesicht sofort.
Christopher wollte abwiegeln, wollte ihm sagen, dass alles gut war, aber es wäre eine Lüge gewesen. Zwar war das Nasenbluten in dem Moment versiegt, als er die Grenze des Anwesens überquert hatte, aber die Kopfschmerzen wirkten noch nach. Er sah doppelt, als er die Enduro neben seinem Bruder anhielt, und als er das Bein über den Bock schwang, wurde ihm kurz so schwindelig, dass er taumelte.
»Hey!« Adrian sprang zu ihm und stützte ihn.
Christopher wehrte ab. Er brauchte keine Hilfe. Doch dann sah er ein, dass seine Knie so wackelig waren, dass er froh über Adrians Halt sein konnte, denn es bestand durchaus die Gefahr, dass er vor seinem Bruder in die Knie ging, und das wollte er auf keinen Fall. Adrian machte sich auch so schon genug Sorgen um ihn.
»Geht gleich wieder«, murmelte er und stützte sich schwer auf der Schulter seines Bruders ab, während der ihm half, nach drinnen ins Herrenhaus zu wanken.
»Schon klar.« Adrian stöhnte auf. »Alter! Füttert Nell dich etwa heimlich mit Kuchen? Was wiegst du denn?«
Das ist mein versteinertes Herz, wollte Christopher scherzen, aber er verbiss sich den blöden Spruch. Auf keinen Fall würde er jetzt auch noch melodramatisch werden. »Muskeln sind eben schwerer als Fett«, entschied er sich für einen unbeschwerteren Scherz.
»Vielleicht solltest du lieber ein bisschen weniger Gewichte stemmen und stattdessen ein paar Schachpartien üben.«
Christopher lachte auf. »Glaub bloß nicht, dass ich dich beim nächsten Mal so einfach davonkommen lasse!« Es war eine leere Drohung. Seit Jahrzehnten hatte er nicht mehr gegen Adrian im Schach gewonnen.
Das Schwindelgefühl ließ vollständig nach, als sie die Bibliothek erreichten. »Geht wieder«, sagte Christopher und machte sich aus Adrians Griff los, bevor der ihn auch noch wie einen alten Tattergreis auf eines der Sofas bugsieren konnte.
Adrian musterte ihn und nickte, als er mit dem, was er sah, zufrieden war.
»Was ist mit dir?«, fragte Christopher. Sein Herz zog sich zusammen in Erwartung einer nur schwer zu ertragenden Antwort, aber zu seiner Erleichterung schüttelte Adrian beruhigend den Kopf. »Es ist alles in Ordnung.«
Christopher zwang sich durchzuatmen. Das Feuer im Kamin verbreitete eine wohlige, nach Tannenharz duftende Wärme. »Bist du sicher?«
Adrian nickte. Er legte den Kopf schief, wie er es immer tat, wenn er wusste, was in Christopher vorging. »Du hattest Angst, dass ich mir etwas antue, während du weg warst.«
Christopher gestand sich ein, dass er auf dem Weg hierher tatsächlich diesen kurzen, aber beängstigenden Gedanken gehabt hatte. Mit den Fingerspitzen massierte er sich Stirn und Schläfen.
»Ich weiß, dass es nichts bringen würde, mich umzubringen«, sagte Adrian. »Allein, meine ich.«
Christopher hielt Adrians forschendem Blick stand und wusste, sie dachten exakt dasselbe.
»Du hast sie rechtzeitig von hier weggebracht«, sagte Adrian. »Das ist gut.«
»Hm.«
Unbehagliche Stille füllte den Raum. Christopher wusste, er musste seinem Bruder von Jessa erzählen. Aber wie sollte er es nur über die Lippen bringen?
Adrian spürte, dass etwas folgen würde. Seine Augen weiteten sich ein wenig. »Was?«, fragte er mit einem Anflug von Anspannung in der Stimme.
Christopher presste den Handballen gegen die Stirn.
»Was hast du, Christopher?«, hakte Adrian nach.
Es gab keinen Weg, es seinem Bruder schonend beizubringen, das wusste er. »Die Kleine …« Sein Mund war plötzlich ganz trocken und er musste erst schlucken, bevor er weitersprechen konnte. »Sie ist Alice’ Schwester.«
Die Stille wurde zu Sirup. Christopher fragte sich, ob Adrian – genau wie er selbst – in diesem Augenblick an die Revolver dachte.
»Du hast sie von hier weggeschafft«, murmelte Adrian endlich.
»Ja. Ja, habe ich.«
»Dann ist doch alles gut.«
Christopher kehrte in sein Zimmer zurück, weil er sich nach den überstandenen Schocks dringend ein wenig ausruhen wollte. Daran war allerdings kaum zu denken, denn als er die Tür zu seinem Schlafzimmer öffnete, stand ein sechzehnjähriges Mädchen vor ihm. Ihre graugrünen Augen blitzten unter ihren wie immer wirren roten Locken hervor.
Er blieb im Türrahmen stehen. »Nell«, sagte er und bemerkte, dass sie viel zu schnell atmete. Bevor er sie fragen konnte, was los war, trat sie einen Schritt zur Seite, sodass sein Blick auf sein Bett fallen konnte. Die Kiste mit den Revolvern stand nicht mehr darunter, sondern darauf. Und sie war geöffnet, sodass die beiden Waffen im Licht der eingeschalteten Deckenlampe matt glänzten.
Ihm wurde kalt.
»Muss ich fragen, was das hier zu bedeuten hat, Christopher?«
Er entschied sich für die Konfrontation und trat einen Schritt näher an sie heran. »Muss ich dich fragen, warum du in meinem Schlafzimmer rumschnüffelst?«
Wie es ihre Art war, schien sie kein bisschen beschämt zu sein. Klar, dachte er. Sie nahm ihre Rolle in dieser ganzen beschissenen Geschichte eben sehr ernst. Sie gehörte zur Familie. Einer ihrer Urahnen war ein Bruder seines Vaters gewesen – was bedeutete, dass sie hier auf High Moor Grange festsaß, genau wie er. Seufzend ließ er den Kopf hängen. »Nell, ich weiß, dass du nur auf mich aufpassen willst.«
Nell schaute ihn an. Schweigend.
»Ich weiß, dass du das für deine Pflicht hältst, weil …«
»Ich warte auf eine Antwort, Christopher!«, fiel sie ihm ins Wort. »Warum hast du Revolver unter deinem Bett?«
Er zwang sich, so gleichmütig wie möglich zu wirken. »Was regst du dich auf? Du weißt, dass ich nicht sterben kann, selbst wenn ich mir eine Kugel in den Kopf jage.« Das war so exakt das, was Adrian eben mit weniger drastischen Worten gesagt hatte, dass Christopher beinahe gelacht hätte.
Nell machte ein Gesicht, als habe er ihr eine Ohrfeige gegeben. »Denkst du darüber nach?«, flüsterte sie. Ihr Blick wanderte in seinem Gesicht umher und er ahnte, dass sie seine Gedanken lesen konnte. Sie wurde ganz blass, als sie begriff, was hinter seinen Worten steckte. »Ihr könnt euch nicht selbst erschießen, aber wenn ihr … euch gegenseitig im selben Moment …« Ihre Stimme brach.
Dann würde es endlich zu Ende sein, dachte er.
»Gott, Christopher!«, stieß sie hervor.
Er nahm ihr die Kiste aus den Händen, schloss sie und schob sie wieder unter das Bett. »Hör zu, Cousinchen …«
»Wie lange hast du sie schon dadrunter?«
Er richtete sich zu seiner ganzen Größe auf. Er überragte sie auf diese Weise um fast anderthalb Köpfe, aber das kümmerte sie nicht. Mit fassungslos und zugleich zornig blitzenden Augen schaute sie zu ihm auf.
»Wie lange, Christopher?«
Er wusste, sie würde ihn nicht um die Antwort herumkommen lassen. Und er wusste auch, dass er sie auf seine Seite ziehen musste, damit sie niemandem von diesen Revolvern erzählte. »Seit das mit Alice passiert ist.« Er wollte nicht weiterreden, aber er wusste auch, dass er es ihr schuldig war. Er hatte ihr das schon viel zu lange verheimlicht, aber, Herrgott, musste sie ausgerechnet heute hier herumschnüffeln, wo er genug mit dieser Jessa zu tun hatte? »Wir haben uns damals geschworen, dass keinem Mädchen jemals das Gleiche passiert wie ihr.«
Nells Lippen teilten sich leicht. Er hasste es, dabei zuzusehen, wie ihre Augen zu schimmern begannen. Nell war jedoch nicht der Typ, der leicht losflennte. Mit bewundernswert fester Stimme sagte sie: »Du glaubst allen Ernstes, dass ich zulasse, dass ihr beide euch gegenseitig erschießt?«
»Nein!« Sanft berührte er sie an den Oberarmen. »Mach dir keine Sorgen um uns.« Weil er spürte, dass sie das nicht überzeugte, zwang er sich zu einem Grinsen. »Hey! Wir sind tough, das weißt du doch!«
Nell runzelte die Stirn. »Was, wenn ich sie dir wegnehme?«
»Versuch es«, erwiderte er.
»Wissen Dad und Henry davon?«
Christopher schüttelte den Kopf. »Von den Revolvern? Nein.« Sie wussten von dem Schwur, das reichte.
»Scheiße, Christopher.« Sie seufzte. »Ich muss Dad und Henry davon erzählen, das ist dir klar, oder?«
»Nein!« Das eine Wort kam sehr viel schärfer aus seinem Mund, als er beabsichtigt hatte.
Nell zuckte tatsächlich zusammen.
Christopher schämte sich. »Hör zu, Nell. Es würde ihnen nur schlaflose Nächte bereiten. Das ist nicht nötig, glaub mir! Solange kein Mädchen hier auftaucht, ist alles gut.« Er zwang sich zu einem Lächeln, von dem er wusste, dass Nell ihm kaum widerstehen konnte. Wie gut, dass sie keine Ahnung von Jessa hatte.
»Das ist nicht sehr beruhigend!«, klagte sie, aber an der Art, wie sie es sagte, wusste er, dass er gewonnen hatte. Sie würde den Mund halten.
Vorerst zumindest.