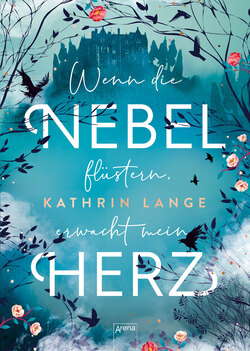Читать книгу Wenn die Nebel flüstern, erwacht mein Herz - Kathrin Lange - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеMit einem altersschwach klingenden Jaulen, das sogar über die Stimme von Billie Eilish in Jessas Kopfhörern zu hören war, quälte sich der Überlandbus die schmale Landstraße entlang. Hinauf ins Moor von Yorkshire, das hinter einer dichten Wand aus grauem Nebel nur zu erahnen war. Ab und an, wenn dieser Nebel sich ein wenig lichtete, schälten sich Umrisse hervor. Eine niedrige Steinmauer. Ein einsames, verfallenes Gebäude. Einzelne Bäume, deren Äste aussahen wie Hände, die nach einem griffen.
Jessas Blick verfing sich in dem konturlosen Grau. Der Bus nahm eine Kurve. Kurz glitten seine Scheinwerfer über das Hochmoor links von ihnen und die Nebelschwaden wirkten wie Geister, deren Körper vom Wind in Fetzen gerissen worden waren.
Jessa schauderte.
Eine Woche war es jetzt her, dass Ms Trenton ihr den Umschlag mit Alice’ Buch gegeben hatte, und Jessa war in dieser Woche immer unruhiger und kribbeliger geworden. Jede Nacht hatte sie von diesem Herrenhaus geträumt und jede Nacht war das Gefühl, dass sie Alice dort suchen musste, stärker geworden. Schließlich hatte sie es nicht mehr ausgehalten. Sie hatte ihr Sparkonto geplündert und sich eine Zugfahrkarte nach Leeds gekauft, wo sie in den Bus in Richtung Haworth umgestiegen war. Dort angekommen, hatte sie versucht, Clarice Galloway aufzusuchen, aber die Bibliothek, in der die Frau arbeitete, hatte geschlossen. Also hatte Jessa dem Impuls nachgegeben und sich auf den Weg nach High Moor Grange gemacht. Sie war in den Überlandbus von Haworth nach Laneshawbridge gestiegen.
Und hier war sie nun. Auf dem Weg zu einem verfallenen Kasten mitten im Moor. Allein aufgrund eines zerfledderten, alten Buches in ihrem Rucksack und dem vagen Gefühl aus einem jede Nacht wiederkehrenden Traum. Dumm eigentlich und trotzdem fühlte sie sich gerade ganz ähnlich wie beim Roofing auf einem Hochhaus an der Dachkante: ein bisschen ängstlich, ein bisschen euphorisch. Und fast so, als wäre sie endlich wieder lebendig.
Mit einem schwachen Lächeln auf den Lippen hörte sie zu, wie Billie Eilish davon sang, dass alle guten Mädchen in die Hölle kamen. Auf der rechten Seite des Busses rückten die Berge näher an die Straße heran und Jessa betrachtete die im Nebel nur undeutlich erkennbaren Hänge.
Eine Frau auf dem Sitz auf der anderen Seite des Ganges war ebenfalls in Haworth eingestiegen. Sie hatte ihr schon die ganze Fahrt über seltsam neugierige Blicke zugeworfen und als sich jetzt ihre Augen begegneten, sagte sie etwas, das Jessa wegen der Kopfhörer nicht verstehen konnte.
Die Frau wiederholte ihre Frage und zwang Jessa damit, einen der Stöpsel aus ihren Ohren zu ziehen.
»Wie bitte?«
»Das stammt aus Sturmhöhe, oder?«, fragte die Frau ein drittes Mal. Diesmal deutete sie auf das Tattoo an Jessas rechtem Arm, das zur Hälfte sichtbar war, weil sie den Ärmel hochgeschoben hatte.
Jessa betrachtete die in ihre Haut eintätowierten Worte und nickte.
»Ein wunderbares Buch«, behauptete die Frau.
Ja, dachte Jessa. Du siehst genau so aus, als würdest du diesen Schinken mögen. Sie zwang sich zu einem unverbindlichen Lächeln und steckte den Kopfhörer wieder ins Ohr.
Die Frau sah enttäuscht aus. Vermutlich hatte sie auf ein nettes, kleines Gespräch über romantische Literatur gehofft und keine Ahnung davon, was sie mit ihrer harmlos gemeinten Frage an Erinnerungen angestoßen hatte.
Denn wieder einmal glitten Jessas Gedanken in die Vergangenheit davon, diesmal zu dem Tag, an dem Alice das Zitat in Schönschrift auf ein weißes Blatt Papier geschrieben hatte – als Vorlage für den Tätowierer. Jessa hatte sie dabei beobachtet, und ihr war ein Fehler aufgefallen …
»Du hast geschrieben yours and mine are the same. Im Buch steht aber his and mine.«
Alice legte den Füllfederhalter weg und lächelte. »Stimmt.«
»Warum schreibst du es nicht richtig auf?«
»Weil es nicht um einen Jungen geht«, sagte Alice. »Ich will diesen Spruch nicht wegen einem Jungen auf der Haut haben.«
»Warum dann?«, erkundigte Jessa sich.
»Deinetwegen.« Alice wuschelte ihr durch die Haare. »Damit ich dich nie vergesse.«
»Du kannst mich nicht vergessen. Wir sind ja immer zusammen.«
Da lachte Alice. »Stimmt auch wieder! Weißt du, was? Ich habe nachgedacht.«
»Worüber denn?«
»Erinnerst du dich noch dran, wie ich dir das Lesen beigebracht habe?«
»Klar.«
»Und daran, wie wir darüber geredet haben, dass Menschen eine Seele haben, damit sie lieben können?«
Auch daran erinnerte Jessa sich. Sie sah ihre Schwester aufmerksam an. In letzter Zeit war Alice ziemlich nachdenklich, fand sie.
Alice tippte auf das Zitat. »Vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht haben wir beide gar keine eigene Seele.« Sie sah Jessa in die Augen. Ihre eigenen glitzerten ganz sonderbar dabei. »Ich meine, vielleicht haben wir beide uns so lieb, weil wir nur eine Seele haben. Darum müssen wir immer zusammenbleiben! Damit unsere Seele ganz sein kann …«
Der Bus fuhr durch eine Kurve und das Ruckeln holte Jessa in die Gegenwart zurück. Links von ihnen war jetzt ein lang gezogenes Gewässer aufgetaucht.
Der Bus hielt am Ende des Gewässers. »Watersheddles Reservoir«, sagte der Busfahrer an.
Jessa stand auf. Hier musste sie aussteigen.
»Sind Sie wirklich sicher, dass Sie bei dem Wetter da rauswollen?«, fragte die Frau neben ihr.
»Ganz sicher«, hörte Jessa sich sagen. Sie war bestimmt nicht den ganzen langen Weg von London bis hierher gefahren, um jetzt, so kurz vor ihrem Ziel, den Schwanz einzuziehen, nur weil es ein bisschen nebelig war.
Der Blick durch die Sprossenfenster von Christophers Zimmer ging auf das Moor hinaus, aber bei dem Nebel war heute nicht viel davon zu sehen. Die kalten grauen Schwaden zogen vor der Scheibe vorbei, berührten sie mit klammen Fingern, als wollten sie durch das Glas hindurch nach Christopher greifen.
Er trat einen Schritt zurück und kämpfte gegen all die furchtbaren Erinnerungen, die ihn immer quälten, wenn es neblig war. Vergeblich.
Ein Gedanke ließ sich einfach nicht vertreiben.
Wie so oft, wenn … es … geschah, war es nebelig gewesen …
»Hey!« Adrians Stimme war leise, aber sie durchschnitt die Kette aus schnell aufeinanderfolgenden Schreckensbildern, die durch seinen Geist taumelten.
Erleichtert drehte Christopher sich um. Sein Bruder stand in der Tür zu seinem Zimmer, unter dem Arm ein hölzernes Schachbrett und in der Hand das Kästchen mit den antiken Elfenbein- und Ebenholzfiguren ihres Vaters.
»Lust auf eine Partie?«, fragte er. Wie immer hatte er die Kapuze seines Hoodies tief ins Gesicht gezogen.
Christopher hatte keine Lust auf Schach, aber er wusste auch, dass das konzentrierte Nachdenken über die Spielzüge ihn vom Grübeln abhalten würde. Also nickte er. »Immer.«
Adrian betrat den Raum. Er schloss die Tür hinter sich mit dem Fuß und sah sich nach einem Platz für das Brett um. Die schwarze Couch und auch der davor stehende Glastisch waren mit getragenen Klamotten und Büchern belegt.
»Wie es aussieht, müssen wir wohl auf der Erde spielen!«, sagte Adrian mit belustigter Stimme. »Hier sieht es aus wie …« Er verzichtete darauf zu erklären, wie es aussah.
Christopher atmete tief durch. Dann löste er sich von der Fensterbank und räumte Tisch und Couch frei. Die Klamotten warf er im Schlafzimmer auf das altmodische Himmelbett, die Bücher stapelte er einfach auf dem Boden.
»Ja«, spottete Adrian. »So ist es definitiv ordentlich.«
Christopher bleckte die Zähne zu einem Grinsen. »Bau schon auf!«
Das tat Adrian. Als er fertig war, nahm er die beiden Damen in je eine Hand, tauschte sie hinter seinem Rücken ein paarmal hin und her und hielt Christopher die geschlossenen Fäuste hin. Christopher tippte auf seine rechte Hand und zog damit die weißen Figuren.
Er setzte seinen ersten Bauern von c2 auf c3.
Adrian schaute ihn verwundert an. »Die Saragossa-Eröffnung? Wirklich?«
Christopher lächelte. »Warte es ab. Diesmal werde ich dich damit vom Brett fegen.«
»Das wäre ja was ganz Neues!« Adrian beugte sich über das Brett. Während er seinen ersten Zug machte, warf Christopher einen letzten Blick nach draußen in den Nebel. Kurz darauf hatte er das trübe Wetter vergessen und war ganz auf ihr Spiel konzentriert.
Er verlor, aber erst nach einem langen und zähen Stellungskampf.
»Matt!«, sagte Adrian, nachdem sie fast zwei Stunden lang erbittert miteinander gerungen hatten. »Willst du gleich eine Revanche?«
Christopher warf sich frustriert gegen die Rückenlehne des Sessels. An Adrian vorbei glitt sein Blick zum Fenster.
Er schüttelte den Kopf. In seinen Adern summte es. »Ich glaube, ich lege mich ein bisschen hin. Ich habe die Nacht nicht besonders gut geschlafen.«
Adrian musterte ihn ein paar Sekunden lang eindringlich und Christopher wusste, was er dachte.
Als ob das was Neues wäre.
Er hielt Adrians Blick stand, bis er nickte.
Gemeinsam räumten sie die Schachfiguren fort. Adrian nahm die Schachtel und das Brett. An der Tür sagte er: »Ich bin in der Bibliothek. Ich habe da gestern ein Buch von Darwin gefunden, das dich bestimmt auch interessiert. Komm dazu, wenn du kribbelig wirst.«
Christopher rieb sich die Augen. »Mache ich«, versprach er. Er hatte allerdings nicht vor, seine Zeit mit Lesen zu verbringen. Solange es nebelig war, hätte er sich nie im Leben auf ein Buch konzentrieren können.
Noch einmal sah Adrian ihm direkt in die Augen. »Hoffentlich!«, sagte er. Dann ging er und Christopher blieb allein zurück.
Einen Moment stand er unschlüssig im Raum und starrte gegen die Tür. Nach einer Weile gab er sich einen Ruck. Er ging ins Schlafzimmer und schob die Klamotten zur Seite, die er vorhin aufs Bett geworfen hatte.
Eine mit Schnitzereien reich verzierte Kiste kam darunter zum Vorschein.
Er öffnete sie.
Darin lag der Trommelrevolver, den er Adrian abgenommen hatte, und daneben noch ein zweiter, genau gleicher. Sachte strich Christopher mit den Fingerspitzen über das matte Metall.
Er fröstelte, weil es sich so gut anfühlte, die Waffen in Reichweite zu wissen. Er war froh, dass Adrian vorhin beim Reinkommen die Kiste auf seinem Bett nicht gesehen hatte. Sein Bruder hatte keine Ahnung davon, dass er die Revolver seit letzter Woche unter seinem Bett aufbewahrte. Und das sollte auch so bleiben, denn auf keinen Fall wollte Christopher, dass sich eine Szene wie neulich wiederholte. Es hatte ihn schockiert, dass ausgerechnet Adrian vorgeschlagen hatte, ihren vor fünf Jahren geschlossenen Schwur durchzuziehen und die Waffen gegeneinander zu erheben. War es nicht eigentlich seine Rolle, ständig mit einem Fuß über dem Abgrund zu schweben?
Er nahm die Kiste, verstaute sie unter seinem Bett und ging zurück ins Wohnzimmer zu seinem Flügel, bei dem er ein paar Tasten anschlug. Die Melodie – eine Variation von Beethovens Mondscheinsonate – perlte durch den hohen Raum.
Draußen vor dem Fenster wurde der Nebel noch ein bisschen dichter. Das Schachspiel hatte ihm für einige Stunden Erleichterung verschafft, aber jetzt fühlte er sich wieder überreizt und müde, melancholisch und aufgekratzt, alles gleichzeitig.
Seufzend klappte er den Deckel über den Tasten zu.
Der Nebel schien nach ihm greifen zu wollen.
Sein Herzschlag beschleunigte sich und diesmal warf Christopher sich auf dem Absatz herum und eilte aus dem Raum. Mit langen Schritten lief er den Gang entlang, vorbei an den nachgedunkelten Gemälden seiner Vorfahren und über die roten Teppiche, die seine Mutter angeschafft hatte. Über eine schmale Steintreppe gelangte er ins Untergeschoss und von dort aus zu den ehemaligen Stallungen. Nur eine der Boxen, in denen früher die Kutschpferde gestanden hatten, war sauber gefegt. In ihr stand Christophers Enduro.
Er lächelte, als er sie betrachtete. Dann schob er die Geländemaschine nach draußen.
»Bleiben Sie unbedingt auf dem Weg! Wenn Sie bei dem Nebel ins Moor laufen, kommen Sie nicht wieder zurück.« Das waren die letzten Worte gewesen, die die Frau auf dem Nebensitz Jessa mitgegeben hatte.
Sie umklammerte die Riemen ihres Rucksacks. Mit jedem Schritt, der sie weiter von der Straße wegführte, schien sich der Nebel dichter um sie zu schließen. Zuerst sah sie noch die Konturen der umliegenden Berge. Nach einer Weile dann waren da nur noch die niedrigen Steinmauern rechts und links. Tief atmete sie die feuchte Luft ein. Sie verlor jedes Zeitgefühl und als plötzlich das Geräusch eines Motorrads über das Moor hallte, zuckte sie zusammen. Doch die Maschine schien weit weg zu sein. Gleich darauf jedenfalls war sie nicht mehr zu hören.
Die Nebelschwaden wurden dichter und es war, als würde sich Watte auf Jessas Ohren legen. Kurz darauf glaubte sie zu hören, wie jemand einen Namen rief, aber sie konnte nicht verstehen, was für einen. Schritte näherten sich ihr. Mit einem Ruck blieb sie stehen, um zu lauschen, aber da war … nichts. Nur ihr eigenes klopfendes Herz und tiefe, drückende Stille.
Langsam ging sie weiter und ermahnte sich, nicht die Nerven zu verlieren.
Es war nur Nebel.
In einem Blog über Yorkshire, den sie auf dem Weg hierher gelesen hatte, hatte jemand von der eigenartigen Akustik geschrieben, die über dem Moor herrschte, wenn Nebel war. Geräusche trugen dann sehr weit und wurden gleich darauf von dem dichten Grau verschluckt. Das hatte rein gar nichts mit Hexenwerk zu tun.
Unheimlich war es aber trotzdem.
Sie lenkte sich davon ab, indem sie sich überlegte, was sie tun würde, wenn sie bei den Ruinen von High Moor Grange angekommen war. Natürlich würde sie sich umsehen. Vielleicht würde sie sich dabei vorstellen, wie Alice ebenfalls dort gewesen war. Und vielleicht spürte sie ja auch Alice’ Anwesenheit, so wie in ihren Träumen. Sie wusste nicht, ob sie sich das wünschte oder ob sie doch eher Angst davor hatte.
Ein unangenehmes Kribbeln rann ihren Rücken hinunter.
Mit einer gehörigen Portion Trotz marschierte sie weiter und landete nur ein paar Minuten später bei einem Hindernis. Die Mauern liefen hier enger zusammen und endeten bei einem Steinbogen, in den ein über zwei Meter hohes schmiedeeisernes Tor eingelassen war. An der höchsten Stelle des Bogens befand sich ein Wappen. Es zeigte zwei gekreuzte Schwerter und darunter die Darstellung eines großen Wolfes mit gesträubtem Fell.
Jessa hatte dieses Wappen auch auf der Website gesehen, auf der sie den Kupferstich gefunden hatte. Es gehörte der Familie, die vor Jahrhunderten das Anwesen erbaut hatte.
Maschendraht reichte bis an den Torbogen und verlor sich rechts und links im Nebel. Jemand hatte offenbar etwas dagegen, dass man sein Land betrat. Ob das gesamte Land eingezäunt war? Schwer vorstellbar. Vermutlich musste sie nur lange genug an dem Zaun entlanggehen, um irgendwann sein Ende zu erreichen.
Andererseits hatte die Frau im Bus ihr geraten, auf dem Weg zu bleiben.
Nachdenklich starrte Jessa das moderne Sicherheitsschloss des Tores an. Der Maschendrahtzaun war ungefähr zwei Meter hoch. Sie war schon über höhere geklettert. Ein Lächeln glitt über ihr Gesicht. Sie rückte ihren Rucksack zurecht, dann griff sie in die Maschen, stemmte die Füße dagegen und zog sich hoch.
Jenseits des Zauns führte der Weg weiter leicht bergauf. Sie marschierte durch den dichten Nebel. Die Geräusche waren mal da, dann wieder waren sie weg.
Irgendwann blieb Jessa mit einem Ruck stehen.
Hatte da jemand eine Melodie gesummt?
An ihrem gesamten Körper richteten sich die Haare auf.
»Alice?«
Die wispernde Stimme erklang so unvermittelt und vor allem so nah, dass Jessa mit einem erschrockenen Schrei auf den Lippen herumwirbelte. Ihr Blick bohrte sich in den undurchdringlichen Nebel, versuchte, ihn zu durchdringen.
Vergeblich.
»Ist da wer?«, fragte sie mit dünner Stimme.
Sie erhielt keine Antwort. Wieder hörte es sich an, als würden weit entfernt erklingende Stimmen herangetragen werden, wieder war da das Brummen dieses Motorrads. Jessa straffte die Schultern. Was war sie nur für ein Schisser! Die gewisperte Stimme war bestimmt nur Einbildung gewesen.
Sie hatte sich gerade selbst davon überzeugt, dass es so war, als der Nebel das Geräusch des Motorrads herantrug. Und diesmal klang es wirklich nah.
Blöd, dass der Nebel jedes Hindernis verbarg, dachte Christopher. Das Risiko, schwer zu verunglücken, war riesig dadurch, zumal er, wie immer, keinen Helm trug.
Es war ihm egal. Die Geschwindigkeit vertrieb die Unruhe aus seinen Gliedern. Und selbst wenn er sich den Schädel an einer Mauer einrammte, würde ihn das schließlich nicht töten.
Er gab noch etwas mehr Gas. Die Enduro bäumte sich auf, grub das Profil ihres Hinterrades tiefer in die nebelfeuchte Erde und schoss vorwärts.
Ob Adrian ahnte, dass er hier draußen war? Vermutlich. Adrian wusste meistens sehr gut, was in Christopher vor sich ging.
Christopher senkte den Kopf tiefer über den Lenker seiner Geländemaschine und lenkte sie auf die lange Auffahrt, die vom Herrenhaus zur Landstraße hinunterführte. Hier drehte er die Geschwindigkeit bis zum Anschlag auf.
Er kannte den Weg im Schlaf.
Gleich würde eine Kurve kommen.
Er legte sich zur Seite, die Räder der Maschine kamen auf dem seifigen Boden ins Rutschen. Gerade noch fing er den Sturz ab. Sein Oberschenkel streifte einen Mauervorsprung, er hatte Glück, dass es ihm nicht das Knie zertrümmerte. Dafür peitschte ihm der Ast eines Schwarzdorns ins Gesicht und riss ihm die Wange blutig.
Er beschleunigte erneut.
Eine Gestalt tauchte aus dem Nebel auf. Adrian!, dachte er erst und dann: Kann nicht sein! Diese Gestalt war viel kleiner. Er riss den Lenker herum. Zu spät! Die Person warf sich mit einem hellen Aufschrei zur Seite und nur deshalb entgingen sie beide dem Zusammenprall.
Ein Mädchen!, durchzuckte es Christopher. Schlingernd brachte er die Enduro zum Stehen, während das Mädchen mit einem wüsten Fluch über die Mauer kippte. Ein Instinkt riet ihm abzuhauen, ihr aus dem Weg zu gehen. Aber er konnte unmöglich weg von hier, ohne sich zu vergewissern, ob es ihr gut ging. Also stieg er notgedrungen ab, bockte die Maschine auf und ging das Stück zurück bis zur Unfallstelle.
Die Kleine rappelte sich gerade auf.
»Alles in Ordnung?« Er streckte die Hand aus, um ihr zu helfen.
»Fass mich nicht an!« Sie schlug wütend nach ihm. Bevor Christopher etwas erwidern konnte, stand sie wieder auf den eigenen Füßen. Dichte schwarze, an den Spitzen leuchtend blau gefärbte Haare verbargen ihr Gesicht, bevor sie sie genervt zur Seite schleuderte.
Alice!
Christopher fühlte sich, als hätte es ihn bei zweihundert Sachen auf den Asphalt geknallt. Gleich darauf jedoch sickerte Erleichterung durch seine Adern.
Das hier war nicht Alice.
Natürlich nicht! Die wutentbrannte, kleine Furie, die da vor ihm stand, hatte zwar dieselbe helle, fast porzellanartige Haut, blaue Augen und einen ausgeprägten, ziemlich hübschen Amorbogen an der Oberlippe, genau wie Alice. Aber da endeten die Ähnlichkeiten auch schon. Alice hätte nie im Leben ihr Gesicht durch ein Nasenpiercing verunstaltet und die Haare so unmöglich blau zu färben, wäre ihr auch niemals eingefallen.
Christopher wurde bewusst, dass er die Kleine anstarrte. Um seine Verwirrung zu verbergen, zischte er: »Kannst du nicht aufpassen?«
»Das ist nicht dein Ernst, oder? Du hast mich doch eben beinahe umgebracht!« Der Blick ihrer blauen Augen bohrte sich tief in seinen und da endlich hatte er seinen Verstand wieder beisammen.
Adrians Worte hallten in ihm wider: Was, wenn wieder ein Mädchen hier auftaucht …?
Er verdrängte die aufsteigende Panik, indem er sich in Unfreundlichkeit rettete. »Was machst du hier?«, zischte er. »Das ist Privatland. Du hast hier nichts zu suchen!« Er gab seiner Miene ein betont finsteres Aussehen. Wenn er dafür sorgte, dass die Kleine verschwand, würde Adrian nicht mal mitbekommen, dass sie da gewesen war.
Doch dummerweise schien er mit seinem Tonfall einen Nerv getroffen zu haben. Statt sich schuldbewusst umzudrehen und zu verschwinden, starrte sie ihn noch wütender an. Dann stemmte sie die Hände in die Hüften und schleuderte mit einer Kopfbewegung diese absurden blauschwarzen Haare nach hinten. »Spiel dich bloß nicht so auf!«, erwiderte sie.
Was war denn das für ein Arschloch?
Bretterte der Typ sie erst beinahe mit seiner blöden Angeberkarre über den Haufen und dann wurde er auch noch unfreundlich? Der hatte sie ja wohl nicht mehr alle!
Jessa musste den Kopf in den Nacken legen, weil der Idiot ein ganzes Stück größer war als sie. Waren die beiden Striemen quer über seiner Wange Dreck oder Blut?
Er sah gut aus, groß, schlank, dunkle Haare und ebenmäßige Gesichtszüge. Seine Augen hatten die Farbe von Bernstein. Er trug nur Jeans und ein weißes Hemd, bei dem er noch dazu die oberen Knöpfe offen hatte, sodass sie sein Schlüsselbein und ein Stück seiner Brust sehen konnte. Und das, obwohl es so kalt war, dass Jessa trotz ihrer alten Lederjacke fröstelte.
Klar. Obercool auszusehen, ging eben vor. Wie sie solche Typen hasste!
»Wie bitte?«, fragte er verdutzt.
Sie beschloss nachzulegen. Angriff war schließlich immer noch die beste Verteidigung. »Was bitte funktioniert bei dir nicht? Dein Gehör oder dein Gehirn?«
Er schnappte nach Luft. Sie schien ihm ziemlich den Wind aus den Segeln genommen zu haben.
Gut so!
Dann jedoch atmete er tief und langsam durch, eine Geste, die so herablassend wirkte, dass Jessa am liebsten gekotzt hätte. Seine Stimme war flach, als er meinte: »Ich wollte nur sehen, ob du dich bei deinem Sturz verletzt hast.«
»Hab ich nicht. Vielen Dank.« Jessa bewegte das rechte Bein ein wenig. Das Knie tat ihr weh. Und die Jeans, die dort sowieso schon kaputt gewesen war, war noch ein bisschen weiter aufgerissen. Aber immerhin blutete sie nicht.
Ganz im Gegensatz zu ihm. Er hatte die beiden Kratzer in seinem Gesicht jetzt offenbar bemerkt. Mit dem Handrücken wischte er darüber.
»Ich wäre allerdings gar nicht auf die Fresse geknallt, wenn du nicht wie ein Vollidiot hier langgerast wärest«, sagte sie.
»Ja. Das hatten wir schon.« Er wirkte irgendwie verwirrt und wütend gleichzeitig. Drohend kam er einen Schritt näher. Offenbar war er nicht nur im Gesicht verletzt, denn ihr fiel auf, dass er humpelte. »Und jetzt sieh zu, dass du von hier verschwindest. Das ist Privatbesitz!«
Jessa wich zurück und ärgerte sich über sich selbst. Schließlich hatte sie auf den Straßen von London schon mit ganz anderen Typen zu tun gehabt. Dagegen war dieses Landadelssöhnchen hier nur ein Weichei, Angeberkarre hin oder her. »Wo steht das geschrieben, Arsch?«, fragte sie.
Was war das denn für eine lahme Erwiderung? Das kriegt ja jede Fünfjährige besser hin.
Seine Augenbrauen waren zusammengezogen, sodass sie sich über seiner ebenmäßigen Nase fast berührten, aber sonst reagierte er nicht auf ihre Beleidigung. Stattdessen griff er nach ihrem Arm und wieder schlug sie seine Hand zur Seite.
Diesmal gab er ihr einen rüden Schubs, der sie in Richtung Straße taumeln ließ. »Abmarsch!«, befahl er. »Ich bringe dich zur Straße.«
»Du kannst mich mal! Wofür hältst du dich? Für Gottes Geschenk an die Menschheit, oder was?«
»Ich bin Gottes Geschenk an die Menschheit. Und wenn du jetzt nicht auf der Stelle kehrtmachst und dieses Land verlässt, dann lege ich dich über’s Knie.«
Sie lachte auf. »Das hättest du wohl gern!«
»Bilde dir nichts ein.« Mit dem Kopf wies er ihr die Richtung und wartete, bis sie an seiner Enduro vorbeigestapft war. Dann hob er das Bike auf und drehte es so, dass es den Weg auf der gesamten Breite versperrte. »In ungefähr einer halben Stunde fährt der Bus nach Haworth vorbei.«
Sie reagierte auf diese Information, indem sie ihm den Mittelfinger zeigte, dann ging sie ein paar Schritte, bis der Nebel den unmöglichen Typen verschluckt hatte. Sie konnte hören, wie er das Bike anwarf, und war schon froh, dass sie ihn los war. Aber zu ihrem Ärger näherte sich das Geräusch. Er kam ihr nach!
Wollte er kontrollieren, ob sie wirklich verschwand?
Offenbar.
Sie beschloss, so würdevoll wie nur möglich weiterzugehen. Stur schaute sie geradeaus und auch als er langsam neben ihr herfuhr, würdigte sie ihn keines Blickes. Na ja, wenn sie ehrlich war, stimmte das nicht ganz. Aus dem Augenwinkel schielte sie ein-, zweimal zu ihm hinüber, betrachtete sein Profil. Er war ganz schön blass, dachte sie. Die Schrammen in seinem Gesicht hoben sich grell gegen seine Haut ab. An seinem Mittelfinger der rechten Hand glänzte ein breiter Silberring mit verschlungenen, sehr alt aussehenden Mustern. Irgendwie gefiel ihr das Teil.
Wütend über ihn, über sich selbst und darüber, dass sie überhaupt irgendwas an ihm gut fand, marschierte sie neben seiner Maschine her, bis sie zu dem Tor kamen.
»Wie bist du da nur drübergekommen?«, fragte er mehr sich selbst, während er einen Schlüssel aus der Tasche nestelte und das Tor aufschloss.
»Ich bin geflogen.«
Er sah sie abschätzig an und stieß das Tor auf. »Raus!«
Ihr blieb nichts anderes übrig, als zu gehorchen, immerhin war sie unrechtmäßig auf seinem Land. »Na dann, schönes Leben noch«, sagte sie, weil sie dachte, er würde hinter ihr wieder abschließen und verschwinden. Doch er dachte nicht daran. Er schob seine Enduro durch das Tor und machte sich erst danach daran, es wieder zu verschließen.
»Du willst aber nicht den ganzen Weg bis zur Straße mitkommen!«, entfuhr es Jessa.
Mit einem undurchdringlichen Blick sah er sie an. »Doch. Nur zur Sicherheit, falls dir wieder Flügel wachsen.«
Sie war drauf und dran, ihm die Zunge rauszustrecken. Gerade noch konnte sie sich davon abhalten.
Er lachte leise und begleitete sie bis hinunter zur Straße. Dort blieb er bei ihr, bis der Überlandbus sich näherte. In Jessa kochte es, trotzdem erschrak sie, als er unvermittelt mit erhobenem Arm auf die Straße trat. Er überfährt dich! Aber der Busfahrer sah ihn rechtzeitig, bremste und hielt an. Es war ein anderer Bus als der, mit dem sie vorhin gefahren war. Dieser Fahrer wirkte weitaus weniger freundlich und schien nicht besonders amüsiert darüber zu sein, dass er auf freier Strecke halten musste. Trotzdem öffnete er die Türen.
»Einsteigen!«, befahl der Motorradtyp Jessa und schob sie die Stufen hinauf. Er selbst stieg hinter ihr ein. »Die junge Dame fährt bis Haworth«, sagte er, zog eine schmale Börse aus seiner Hosentasche und bezahlte die Fahrt.
Der Fahrer musterte sie abschätzig und aus irgendeinem bescheuerten Grund kam Jessa sich in ihren abgetragenen Klamotten plötzlich schäbig vor. Die Sachen, die der Typ trug, wirkten teuer und elegant.
Sie verdrehte die Augen. Was war das denn plötzlich für eine seltsame Anwandlung? Sie gab doch sonst nichts auf ihr Äußeres. Ganz im Gegenteil. Das Leben auf der Straße hatte ihr beigebracht, dass es nicht darauf ankam, was man besaß oder am Leib trug.
»Setz dich lieber!«, riet der Typ ihr. »Die fahren hier manchmal einen ziemlich heißen Reifen.« Er nickte dem Fahrer knapp zu und stieg wieder aus.
Die Türen schlossen sich mit einem Zischen hinter ihm.
Durch die Scheibe hindurch starrte Jessa ihn wütend an. Täuschte sie sich oder waren die Striemen in seinem Gesicht plötzlich weg? Vermutlich war es doch kein Blut gewesen, das sie da vorhin gesehen hatte, sondern einfach nur Dreck, den er weggewischt hatte. Sie sah zu, wie er sich seiner Maschine zuwandte. Er schien sie schon vergessen zu haben. Sein Humpeln war jetzt deutlicher zu sehen.
Zornig warf sie sich auf einen freien Sitz. »Was für ein Blödmann!«, grummelte sie und als der Bus die nächste Kurve umrundet hatte und der Typ außer Sichtweite war, sprang sie auf. »Bitte halten Sie noch mal an!«, rief sie.
Dieser Idiot würde sie nicht davon abhalten, nach High Moor Grange zu gehen und dort nach ihrer Schwester zu suchen!