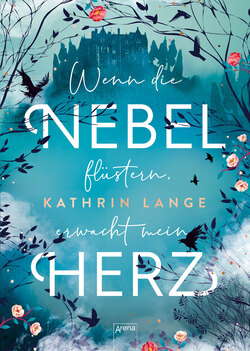Читать книгу Wenn die Nebel flüstern, erwacht mein Herz - Kathrin Lange - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDas Zimmer war klein, aber gemütlich eingerichtet. An der Wand über dem Bett hing eine Kopie des Gemäldes mit den Schwestern Brontë, das sich auch auf Alice’ Taschenbuch befand. Jessa blieb eine Weile lang mitten im Raum stehen und betrachtete den gelblichen Fleck, wo sich ursprünglich Branwell Brontë befunden hatte. Aus irgendeinem Grund musste sie dabei an den Nebel rund um High Moor Grange denken.
Dann jedoch wanderten ihre Gedanken zu diesem Motorradtypen. Christopher.
Seine Nase hatte ziemlich plötzlich angefangen zu bluten. Vor allem aber ohne ersichtlichen Grund. Außerdem ließ die Art, wie er bleich geworden war, auf Schlimmeres schließen. Ob er krank war?
Vielleicht war es ja das, wovor er sie schützen wollte: eine ansteckende Krankheit, die die Gegend rund um das Herrenhaus verseucht hatte. Und vielleicht war die auch der Grund dafür, dass dieser Adrian, der Typ mit der Kapuze, sein Gesicht nicht zeigen wollte.
Nachdenklich strich Jessa über ihr Handgelenk. Die Stelle, wo der Blödmann sie gepackt hatte, war immer noch rot. Missmutig zog sie ihre Lederjacke aus, legte sie über den geblümten Sessel und streifte sich die Schuhe von den Füßen. Dann warf sie sich auf das Bett und nahm sich vor, keine weiteren Gedanken an diese beiden Kerle zu verschwenden.
Sie war schließlich wegen Alice hier. Morgen würde sie in die Bibliothek gehen und mit dieser Clarice Galloway reden. Was aber, wenn sie keine Spur von ihrer Schwester fand? Würde sie dann unverrichteter Dinge nach London zurückfahren? Ihr Geld reichte gerade noch für eine Zugfahrkarte.
Einen Schritt nach dem anderen, dachte sie. Sie rollte sich auf die Seite, angelte nach ihrem Rucksack und nahm Sturmhöhe heraus. Grübelnd strich Jessa über den hellgrünen Einband. Alice hatte dieses Buch geliebt. Es war kaum vorstellbar, dass sie sich freiwillig davon getrennt hatte. Warum aber hatte sie es dann in diese Bibliothek gestellt, wo Ms Galloway es offenbar gefunden hatte? Hatte sie es vielleicht vergessen? Auch das glaubte Jessa nicht. Alice hatte früher immer Bücher mit sich rumgeschleppt. Und sie hatte nicht ein einziges Mal eines irgendwo aus Versehen liegen lassen. Warum also ausgerechnet dieses, das ihr so wichtig gewesen war?
»Ach, Mist!«
Es brachte gar nichts, jetzt zu grübeln. Morgen um diese Zeit wüsste sie vielleicht schon mehr. Und bis es Zeit war, Ms Galloway aufzusuchen, konnte sie genauso gut die Annehmlichkeiten dieses Hotels nutzen. Immerhin blechte dieser Christopher dafür, was die Sache noch angenehmer machte. Sie stand auf und ging ins Badezimmer, das mit einer auf Klauenfüßen stehenden Badewanne gleichzeitig altmodisch und charmant wirkte. Auf dem Duschvorhang war eine altertümliche Handschrift abgebildet. Jessa versuchte, die krakelige Schrift zu lesen, aber sie konnte kein einziges Wort entziffern. Sie runzelte die Stirn.
Eine ganze Batterie von Pflegeprodukten stand auf dem Bord über dem Waschbecken. Jessa nahm sie der Reihe nach in die Hand. Es gab Duschgel, Shampoo, Conditioner, Bodylotion und sogar ein Schaumbad für eine Wannenfüllung. Auf jeder einzelnen der kleinen Fläschchen war das Gesicht einer blassen, jungen Frau mit halblangen Haaren und einem Samtband um den Hals abgebildet. Vermutlich eine der Brontë-Schwestern. Denen entging man hier offenbar nicht mal im Bad.
Jessas Blick wanderte von dem Fläschchen in ihrer Hand zu der Wanne und ein Lächeln glitt über ihr Gesicht. Sie stöpselte den Abfluss zu und drehte das heiße Wasser auf. Als sie das Schaumbad in den Strahl gab, begann es, köstlich nach Sandelholz zu duften.
Sie blieb über eine Stunde in der Wanne, wusch sich die Haare und behandelte sie mit dem Conditioner, was die blauen Spitzen wunderbar weich und geschmeidig machte. Nach dem Bad benutzte sie die Bodylotion und während sie sich eincremte, merkte sie, dass ihr Magen knurrte. Das Letzte, was sie gegessen hatte, war ein billiger Burger am Bahnhof in London gewesen. Wie lange war das jetzt her? Sie sammelte die leeren Fläschchen ein, warf sie in den Mülleimer und schlüpfte dann in saubere Unterwäsche. Danach kramte sie in ihrem Rucksack nach zwei Müsliriegeln, die sie vom Frühstückstisch in Children’s Retreat hatte mitgehen lassen. Die und ein Zahnputzbecher voll mit Leitungswasser mussten als Abendessen reichen, aber das war nicht weiter schlimm. Sie war schon länger mit weniger ausgekommen.
Zum Ausgleich für das karge Mahl lümmelte sie sich vor den Fernseher. Endlich mal konnte sie sich durch sämtliche TV-Kanäle zappen, ohne dass eine Erzieherin ihr befahl, ins Bett zu gehen.
In dieser Nacht träumte sie erneut, dass sie durch das Moor lief. Diesmal jedoch stieß sie im Traum nicht zufällig auf das Herrenhaus, sondern sie suchte gezielt danach, denn sie hatte das unbändige Gefühl, dass Alice wollte, dass sie das tat. Im Traum war es, als würde ihre Seele sie zu diesem Haus treiben, weil sie die von Alice suchte, weil sie wieder ganz sein wollte. Bevor sie Alice jedoch fand, wachte sie schweißgebadet auf.
Als es Zeit für das Frühstück war, duschte sie, dann zog sie sich an. Im Licht der Badezimmerlampe wirkten die Abdrücke von Christophers Fingern an ihrem Handgelenk lila, was fieser aussah, als es war. Die Prellung tat kaum weh und Jessa hatte sie beinahe sofort wieder vergessen. In dem Moment, als sie die Zimmertür öffnete, um hinunter in den Frühstücksraum zu gehen, kam ein junger Mann aus dem Nachbarzimmer.
»Oh. Guten Morgen«, grüßte er. Er war einen ganzen Kopf größer als sie und sah auf eine kompakte Art stark und sportlich aus. Er hatte einen dichten roten Hipsterbart, einen von der Sorte, die Jessa unfassbar albern fand. »Auch so früh aus dem Bett gefallen?«, erkundigte sich der Typ.
Sie nickte nur.
Er ließ sich davon nicht beirren. »Mein Name ist Henry«, stellte er sich vor und hielt ihr eine Zwischentür auf.
»Danke«, murmelte sie, ging hindurch und verzichtete darauf, ihm zu sagen, wie sie hieß.
Wenn es ihn ärgerte, ließ er es sich nicht anmerken. Er hielt ihr ebenso galant auch noch die Tür des Frühstücksraums auf und zu ihrer Erleichterung suchte er sich einen Tisch in einigem Abstand von ihrem.
Am Frühstücksbüfett allerdings traf sie ihn wieder.
»Gerade erst angekommen?«, fragte er.
Wieder nickte sie nur. Vielleicht kapierte er ja irgendwann, dass sie nicht mit ihm quatschen wollte.
Er grinste breit. »Wie eine Touristin siehst du nicht aus.«
»Bin ich auch nicht.« Sie biss sich auf die Lippe und lud sich Eier und Speck auf einen Teller.
»Sondern?« Er wartete auf eine Antwort und als sie einfach schwieg, setzte er nach: »Was hast du heute so vor, meine ich.«
Ihr Blick huschte durch das Fenster in die Ferne auf der Suche nach einer passenden Antwort. »Ich mache einen Spaziergang durchs Moor und suche mir einen Felsen, von dem ich mich stürzen kann, um keine dummen Fragen mehr beantworten zu müssen.«
»Oha.« Er lachte. »Kapiert. Sorry, ich lass dich schon in Ruhe.«
Sie sah ihm ins Gesicht. Er wirkte eigentlich ganz nett, aber um ihn das nicht merken zu lassen, wandte sie ihm den Rücken zu. Mit ihrem Teller kehrte sie zu ihrem Platz zurück und ließ es sich schmecken. Nachdem sie alles restlos verputzt hatte, ging sie ein zweites Mal, um sich Früchte und Joghurt zu holen. Beim dritten Gang, bei dem sie sich für Toast mit Marmelade entschied, nickte Henry ihr anerkennend zu. »Gesunder Appetit«, kommentierte er.
Darauf reagierte sie gar nicht. Sie hatte eigentlich vorgehabt, das Frühstück so lange auszudehnen, bis die Bibliothek öffnen würde, aber irgendwann hielt sie Henrys ständige, betont unauffälligen Blicke nicht mehr aus und beschloss zu gehen.
»Schönen Tag noch«, wünschte er, als sie schon an der Tür war.
Sie zwang sich zu einem einigermaßen freundlichen Tonfall. »Dir auch.«
Sie ging auf ihr Zimmer, putzte sich die Zähne und ging auschecken.
An Pamelas Stelle saß heute Morgen ein freundlicher junger Mann, der ihr mit einem strahlenden Zahnpastalächeln einen »wundervollen Tag« wünschte. Draußen auf dem Parkplatz gab Jessa die Adresse der Bibliothek in ihr Handy ein. Das Gebäude war ganz in der Nähe, aber das war hier wohl alles.
Haworth war sehr viel kleiner, als sie es sich vorgestellt hatte, und das bedeutete, sie würde keine fünf Minuten brauchen, um bei der Bibliothek anzukommen. Sie beschloss, die Zeit, bis die öffnete, mit einem Spaziergang rumzubringen.
Die Luft über dem Moor war so früh am Morgen glasklar, sodass es schien, als wolle das Wetter den Nebel und damit den gestrigen Tag wiedergutmachen. Der Himmel hatte die Farbe einer tausendmal gewaschenen Jeans und die wenigen Wolken, die darüber hinsegelten, sahen aus wie schneeweiße Wattebälle. Zu alldem bildete die Heide mit ihrem flammenden Violett einen scharfen Kontrast. Der einsame Baum, der auf dem höchsten der Hügel stand, reckte seine Zweige Richtung Osten, als wolle er nach dem Horizont greifen.
Christopher stützte den Unterarm gegen das Fenster des Speisezimmers und lehnte die Stirn gegen den Handrücken. Er hielt sein Smartphone in der Hand, aber er zögerte, Henry anzurufen. Der würde sich schon darum kümmern, dass Jessa nicht wieder auf die Idee kam, hierher zurückzukehren. Es war nicht nötig, sich dessen ständig zu versichern, auch wenn das Bedürfnis danach groß war.
»Idiot!«, murmelte er zu sich selbst.
»Wer?«, fragte Adrian hinter seinem Rücken. »Du? Oder ich?«
Christopher wandte nur kurz den Kopf zu ihm. Zu viele Gedanken kreisten in seinem Schädel und er war er unendlich müde. Er hatte die Nacht so gut wie gar nicht geschlafen, hatte sich ruhelos herumgewälzt und darüber nachgegrübelt, wie Alice’ Schwester hierhergefunden hatte. Ob sie ahnte, dass Alice hier gewesen war. Was er tun sollte, wenn sie noch mal herkam. Und nicht zuletzt: was er und Adrian machen sollten, würde es wieder von vorn losgehen.
»Alles in Ordnung?«, fragte Adrian. Er saß am Esstisch und versuchte zu frühstücken. Aber nach der Rühreimenge zu urteilen, die noch immer auf seinem Teller lag, hatte er ebenso wenig Appetit wie Christopher. Kein Wunder. Jessas Auftauchen hatte auch ihn bis ins Mark erschüttert. Christopher hätte zu gern gewusst, wie er die Nacht verbracht hatte, aber er traute sich nicht zu fragen.
Um ihm auszuweichen, ließ er den Blick durch das Speisezimmer schweifen. Der Kontrast zwischen den antiken Seidentapeten und Möbeln und der billigen Pfanne, aus der Adrian aß, war irgendwie lächerlich. Christopher schaute wieder hinaus auf das Moor. »Die Heide steht in Flammen. Heather hätte jetzt ihre Staffelei geholt und gemalt.« Es fühlte sich auf perverse Weise gut an, ihren Namen zu erwähnen. Es ließ den gleichmäßigen, dumpfen und dadurch so unerträglichen Kummer in seinem Inneren für eine Sekunde zu einem grellen, reinigenden Brennen werden. Er unterdrückte den Wunsch, hinaus auf den Friedhof zu Heathers Grab zu gehen.
Er hörte, wie Adrian die Gabel auf dem Pfannenrand ablegte. Sein Schweigen war vorwurfsvoll.
Christopher schloss die Augen. Verdammt! Seit Jessas Auftauchen fühlte er sich dünnhäutig, nein, mehr noch, es war, als hätte er überhaupt keine Haut mehr. Als würde ihn der kleinste Luftzug schreien lassen. Mit der flachen Hand rieb er sich über das Gesicht.
»Du machst dir Sorgen, dass sie zurückkommt, stimmt’s?«
»Henry überwacht sie«, sagte er. »Er sorgt dafür, dass sie nicht wieder hier auftaucht.«
Wen wollte er damit beruhigen? Adrian? Oder doch eher sich selbst? Er hatte Jessa kennengelernt und er hätte ein Volltrottel sein müssen, um zu glauben, dass sie sich so einfach von High Moor Grange fernhalten lassen würde.
Schweigen dehnte sich zwischen ihnen aus. Schließlich war es Adrian, der als Erster wieder sprach. »Wo hast du die Revolver, Christopher?«
Die Worte ließen Christopher beinahe in die Knie gehen. Seit fünf Jahren war da dieses ständige Wispern in ihm, dieses permanente: Tu es! Beende es, bevor es wieder zu einer solchen Katastrophe kommt! Und jetzt, wo es aussah, als würde genau das passieren, zögerte er?
Er musste nur seinen Bruder ansehen, um zu begreifen, warum. Seitdem Adrian, wie er, mit dem Gedanken spielte, ihrer beider Leben zu beenden, war er selbst sicher, dass er das auf jeden Fall verhindern musste. Dass er Adrian beschützen musste. Auch wenn ihn das mehr kosten würde, als er ertragen konnte.
Mit zitternder Hand hielt er Daumen und Zeigefinger zwei Millimeter voneinander entfernt. »Vor fünf Jahren waren wir so dicht dran. Wir hätten dich fast gerettet.«
Adrian senkte den Kopf, sodass die Kapuze sein Gesicht vollständig verbarg. »Ja«, sagte er. »Fast.« Seine Stimme war nur ein Flüstern.
Die öffentliche Bibliothek von Haworth war genau so, wie Jessa sie sich vorgestellt hatte: klein, verwinkelt, mit dem intensiven Geruch nach altem Papier, Bohnerwachs und Staub. Der Tresen, an dem die Ausleihe stattfand, war nichts weiter als ein Schreibtisch in einem der vorderen Räume des Hauses, das offenbar früher einmal ein Wohnhaus gewesen war. Der Boden bestand aus alten Eichendielen, die Fenster waren klein und wirkten in den dicken Mauern eher wie Schießscharten.
Die Bibliothekarin war eine ältliche Dame und auch sie sah genau so aus, wie Jessa sich jemanden vorstellte, der hier arbeitete. Die Frau hatte die grauen Haare zu einem Knoten geschlungen, ihre Kleidung bestand aus Rock, Bluse und Strickjacke. Eine Lesebrille hing an einer Kette um ihren Hals. Das kleine silberne Namensschild, das auf ihrem Schreibtisch stand, wies sie als Clarice Galloway aus.
»Guten Morgen«, grüßte Jessa sie. »Mein Name ist Jessa Downton.« Sie wartete einen Augenblick, ob bei dem Nachnamen etwas bei Ms Galloway klingelte. Als das nicht der Fall war, schob Jessa hinterher: »Alice Downton war … ist meine Schwester. Das Mädchen, das …«
»Oh, ja!« Ms Galloways Miene erhellte sich. »Das Mädchen, dem das Buch gehörte, das ich neulich gefunden habe. Warte, Sturmhöhe, nicht wahr?«
»Genau.«
»Wie nett, dass du hierherkommst. Warum kommt sie nicht selbst?«
»Meine Schwester ist vor fünf Jahren spurlos verschwunden.« Jessa stieß die Worte hervor wie etwas, das sie dringend loswerden musste. Auf dem Weg hierher hatte sie mehrere Versionen durchgespielt, wie sie es möglichst taktvoll erwähnen sollte, aber offenbar gab es keine schonenden Worte für so was. Jedenfalls nicht in ihrem Kopf.
Schlagartig erlosch Ms Galloways Lächeln. »Oh.« Sie schnappte nach Luft und legte eine Hand auf ihr Herz.
Weil die Dauer ihres betroffenen Schweigens sich unerträglich in die Länge zog, fuhr Jessa fort: »Ich bin hier, weil ich rausfinden möchte, was passiert ist.«
»Hat die Polizei das denn nicht?«
Hätte sie vielleicht, wenn sie vernünftig ermittelt hätte, dachte Jessa. »Nein«, antwortete sie. »Leider nicht.«
»Nun.« Ms Galloway legte den Kugelschreiber weg, mit dem sie bei Jessas Eintreten etwas auf altmodischen Buchlaufkarten notiert hatte. »Ich fürchte, ich kann dir nicht weiterhelfen. Alles, was ich weiß, ist, dass ich das Buch in unserem Bestand gefunden habe. Jemand muss es ins Regal gestellt haben. Ich habe allerdings keine Ahnung, wieso.«
Jessa schaute in die Richtung, in die sie gedeutet hatte. »Können Sie mir zeigen, wo genau Sie es gefunden haben?«
»Natürlich.« Ms Galloway kam hinter ihrem Schreibtisch hervor und marschierte mit kurzen, energischen Schritten den ehemaligen Hausflur entlang, dann in einen der hinteren Räume und dort in den hintersten Winkel. Eine junge Studentin, die an einem Tisch saß und einen dicken Wälzer vor sich liegen hatte, schaute kurz auf, kümmerte sich dann jedoch nicht weiter um sie.
Das Regal, in dem Alice’ Buch gestanden hatte, gehörte zur Abteilung Enzyklopädien und Sammelwerke. Dem Alter der hier stehenden Lexika und Bildbände nach zu urteilen, wurden die Bücher ungefähr alle hundert Jahre einmal benutzt. Kein Wunder. In Zeiten von Internet und Wikipedia gab es vermutlich kaum etwas Nutzloseres als alte Nachschlagewerke. Ein Wunder, dass die Bibliothek die alten Schwarten noch nicht entsorgt hatte.
»Da hat es gestanden«, erklärte Ms Galloway und deutete auf das oberste Brett eines Regals, auf dem sich eine zweibändige und offenbar ziemlich alte Sagensammlung befand. »Zwischen den beiden Sagenbänden. Es ist mir nur aufgefallen, weil es keine Signatur hat.«
Jessa zog Alice’ Buch aus der Tasche. Die Schutzumschläge der beiden Bände hatten fast dieselbe Farbe wie dessen Einband. Es war kein Wunder, dass es dort so lange unentdeckt gestanden hatte, zumal die Sagen seit Jahren niemand mehr ausgeliehen hatte, wie Ms Galloway nun erklärte.
»Und deine Schwester ist spurlos verschwunden? Hier in Haworth?« Die Bibliothekarin schauderte.
Jessa nickte. »Könnten Sie mir einen Gefallen tun und nachschauen, ob Sie eine Alice Downton in Ihrem System haben?« Halb erwartete sie, einen längeren Vortrag über Datenschutz gehalten zu bekommen. Aber Ms Galloway schien selbst viel zu neugierig, um sich um solche nervigen Hindernisse zu scheren. Gut, dachte Jessa. Wenn diese Bibliothekarin das Rätsel um Alice’ Verschwinden so interessant fand, kam ihr das gerade recht.
Ms Galloway marschierte zurück zu ihrem Schreibtisch und tippte eine Weile lang auf der Tastatur ihres Computers herum, der noch altertümlicher war als die in Children’s Retreat.
»Hier«, sagte sie dann und deutete auf den Bildschirm. »Wir haben tatsächlich eine Alice Downton im System. Moment. Der letzte Eintrag für sie datiert vom 3. September 2015.«
Das war nur einen Tag, bevor Alice sich zum letzten Mal bei ihr gemeldet hatte!
Jessas Magen machte einen kleinen, flatterigen Satz. Sie hatte wirklich eine Spur von Alice entdeckt! »Was hat sie ausgeliehen?«, fragte sie ein bisschen atemlos.
»Hm. Mal sehen. Das sind alles Bücher über oder von Branwell Brontë. Das war der jüngere Bruder der drei Brontë-Schwestern.«
Der Maler, der das Bild auf Alice’ Buch gemalt hatte. Wieder einmal betrachtete Jessa das Cover. Sie fand diesen Branwell nicht besonders talentiert. Die Gesichter der drei Frauen waren flächig und nicht sehr fein ausgearbeitet, die Farben eintönig und irgendwie uninspiriert. »Könnte ich die Bücher, die Alice ausgeliehen hat, einsehen?«
»Natürlich. Du musst dafür allerdings einen eigenen Ausweis beantragen.« Datenschutz war Ms Galloway zwar egal, aber mit den Formalitäten einer Ausleihe war sie dafür offenbar umso genauer.
Jessa nahm es mit Humor und eine Viertelstunde später saß sie an dem Tisch, an dem eben noch die Studentin gesessen hatte, die aber mittlerweile gegangen war. Vor sich hatte sie drei alt aussehende Sachbücher, die sich allesamt mit diesem Branwell Brontë beschäftigten. »Dieses hier«, hatte Ms Galloway gesagt, »hat nach deiner Schwester niemand anderes mehr ausgeliehen.«
Es war eine dicke, dunkelrot eingebundene Schwarte mit dem Titel Branwell Brontë – Maler, Schriftsteller, Lehrer. Das meiste darin war ziemlich langweiliges Zeug. Jessa blätterte es dennoch durch und überflog Lebensdaten, Forschungen zu Branwells Arbeit an einem Werk namens Angria und vielem mehr. An einem Artikel blieb ihr Blick hängen.
Jemand hatte Unterstreichungen gemacht.
Und diese Unterstreichungen hatten einen dunklen Türkiston.
Wieder gab es in Jessas Magen dieses komische flatterige Gefühl. Sie schlug Sturmhöhe auf und verglich den Farbton der Unterstreichungen mit der Tinte, mit der Alice ihren Namen und ihre Adresse in das Buch geschrieben hatte.
Sie stimmten überein.
Ungefähr eine Stunde lang brauchte Jessa, um den Artikel zu lesen, für den Alice sich so sehr interessiert hatte, dass sie ihre Angewohnheit, besonders sorgsam mit Bibliotheksbüchern umzugehen, über den Haufen geworfen und ganze Passagen darin angestrichen hatte.
In dem Artikel ging es um die Frage, warum Branwell im Alter von nicht mal dreißig Jahren den Verstand verloren hatte. Das Ganze war ungeheuer kompliziert und so schwer verständlich geschrieben, dass Jessa irgendwann ein Gähnen nicht mehr unterdrücken konnte. Für so langweiliges Zeug hatte Alice sich interessiert? Warum nur?
Seufzend legte sie den Zeigefinger als Lesezeichen zwischen die Seiten und klappte das Buch zu. Danach starrte sie eine Weile lang grübelnd vor sich hin, bis Ms Galloway den Kopf zur Tür hereinsteckte und fragte: »Irgendwelche Erkenntnisse?«
Jessa zuckte mit den Achseln. »Nur dass Alice sich offenbar brennend für diesen Branwell interessiert hat.«
Da lächelte die Bibliothekarin. »Mir ist eben eine Idee gekommen.« Sie winkte Jessa zu sich heran.
Jessa zögerte, doch dann stand sie auf und folgte Ms Galloway. Die führte sie zu einer Treppe ihm hinteren Teil des Gebäudes. Hier hatte man irgendwann einmal einen moderneren Anbau angefügt, denn als sie nun durch eine gläserne Tür gingen, befanden sie sich in einem Treppenhaus, das aussah wie das einer Behörde aus den Siebzigern. An der Treppe ließ Ms Galloway Jessa den Vortritt, dann führte sie sie einen mit Linoleum ausgelegten Gang entlang und bis zu einer Tür mit Milchglaseinsatz. Prof. Victor Addingham stand auf einem Schild daneben. Ms Galloway klopfte und wartete kaum auf das »Herein«, das folgte. Eilig stieß sie die Tür auf und stürmte in das Zimmer. Jessa folgte ihr.
»Professor Addingham«, begann die Bibliothekarin. »Darf ich Sie einen kurzen Moment stören?«
Der Mann, der hinter dem mit Papieren und Büchern übervollen Schreibtisch saß, war am Telefonieren. »Kann ich Sie später zurückrufen, Professor Taylor?«, fragte er in sein Handy. Sein Gesprächspartner antwortete etwas, er bedankte sich und legte dann auf. »Das haben Sie ja schon, Clarice«, sagte er mit einem Seufzen. Er schien um die fünfzig zu sein. Seine Haare waren an den Schläfen ergraut und so unordentlich, als hätte er sie sich gerade gerauft. Er trug eine Brille mit silbernem Drahtgestell, eine hellbraune Strickjacke über einem verknitterten Hemd und Jessa vermutete, dass unter dem Schreibtisch eine ausgebeulte Cordhose das Outfit eines waschechten Gelehrten komplettierte.
Ms Galloway überhörte den Vorwurf in seiner Stimme. »Diese junge Dame hier braucht Ihre Hilfe.« Sie packte Jessa und schob sie ein Stück nach vorne, was nicht ganz einfach war, denn das Büro war winzig und vollgestopft. »Jessa ist hier, weil sie auf der Suche nach ihrer verschwundenen Schwester ist.«
Während sie das sagte, hätte Jessa beinahe einen Stapel Bücher umgestoßen. Gerade noch konnte sie den windschiefen Turm davon abhalten, in sich zusammenzurutschen.
Ein leises Ächzen entfuhr der Kehle des Mannes.
»’tschuldigung«, murmelte Jessa und schaute von dem Bücherstapel hoch.
»Ich … schon gut.« Professor Addingham erhob sich. Er nahm die Brille ab und fuhr sich mit der flachen Hand durch die Haare, die danach noch zerzauster aussahen. »Ich fürchte, ich weiß nicht, wie ich in dieser Angelegenheit behilflich sein kann.« Er hatte eine schöne Stimme, tief und wohlklingend. Jessa konnte sich gut vorstellen, wie er damit den Hörsaal einer Universität füllte und seine Studenten in den Bann zog.
»Ich dachte, Sie könnten sich vielleicht an irgendwas von damals erinnern«, warf Ms Galloway ein. »Immerhin arbeiten Sie schon seit dreißig Jahren hier!«
Da ließ sich Professor Addingham wieder auf seinen Stuhl sinken. Die Federn quietschten leise. »Hm … In der Tat erinnere ich mich daran, dass einmal jemand von der Polizei hier war und nach einer jungen Frau gefragt hat. Ist das wirklich schon fünf Jahre her? Du liebe Güte, wie die Zeit vergeht!«
»Was haben Sie der Polizei gesagt?«, fragte Jessa. Ein leichtes Kribbeln hatte sie erfasst. Kam sie jetzt einen Schritt weiter?
Offenbar nicht, denn Professor Addingham schüttelte bedauernd den Kopf. »Nichts. Denn ich habe diese junge Dame nie getroffen. Alles, was ich tun konnte, war, dem Polizeibeamten viel Glück bei der Suche zu wünschen.« Während er das sagte, blätterte er in dem Manuskriptstapel herum, an dem er gearbeitet hatte, als sie eingetreten waren. »Ich fürchte also, ich bin keine große Hilfe. Tut mir wirklich sehr leid … wie war noch mal dein Name … Jessica?«
»Jessa«, verbesserte sie automatisch. Das Kribbeln wurde ersetzt von einem Gefühl von Enttäuschung. »Danke trotzdem.«
»Hm. Gern geschehen.« Er war in Gedanken schon wieder bei seiner Arbeit. »Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen? Ich muss das hier dringend fertig machen.«
»Natürlich.« Jessa sah Ms Galloway an.
Die wirkte nicht zufrieden, aber sie schien zu viel Respekt vor dem Professor zu haben, um ihn weiter zu nerven. »Komm«, sagte sie zu Jessa, dann bugsierte sie sie aus dem engen Büro. »Schade. Ich hätte mir gewünscht, dass er dir hätte helfen können.«
Jessa folgte ihr zu ihrem Arbeitsplatz zurück. »Tja«, murmelte sie. »Das war es dann wohl.«
»Vielleicht noch nicht«, sagte Ms Galloway. Mit der Spitze ihres Zeigefingers tippte sie sich gegen die Unterlippe. »Ich habe eine Tante, die seit Jahrzehnten in Haworth lebt. Sie ist zwar schon ein bisschen dement und wohnt im Altersheim, aber wenn sie klar ist, ist sie ein wandelndes Lexikon. Vielleicht kann sie sich an ein Mädchen erinnern, das vor fünf Jahren spurlos verschwand.« Ms Galloway sah auf die Uhr. »Ich habe um halb eins Mittagspause. Wenn du bis dahin warten kannst, könnten wir gemeinsam zu Elizabeth gehen.« Sie lächelte. »So heißt sie. Meine Tante Elizabeth.«
Jessa konnte sich zwar nur schwer vorstellen, dass das etwas bringen würde. Vermutlich war ein Besuch bei dieser Elizabeth nicht mehr als das Greifen nach einem Strohhalm, aber was hatte sie schließlich zu verlieren? Also beschloss sie, die Hilfe der Bibliothekarin anzunehmen, auch wenn diese ihr die vermutlich nur aus reiner Neugier und und Sensationslust anbot.
»Warum nicht?«, willigte sie ein.