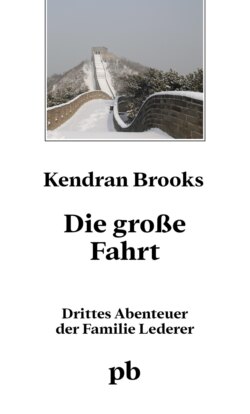Читать книгу Die große Fahrt - Kendran Brooks - Страница 6
China, 1382
ОглавлениеZwei Wochen war es her, dass uns der Vater verlassen hatte. Bisher hörten wir nichts vom ihm. Ich war an diesem frühen Vormittag mit zwei meiner Schwestern auf den Wochenmarkt gegangen, denn wir wollten uns Naschzeug kaufen. Mit dem Händler wurden wir rasch einig, denn er kannte uns und unsere Familie und versuchte erst gar nicht, uns Kinder übers Ohr zu hauen. Wir standen noch am Randes des großen Platzes zusammen und kauten genüsslich die kleinen, honigsüßen Kuchen, als sich an einem der Zugänge zum Markt, genau uns gegenüber, ein Dutzend furchterregende Tiger zeigten, die langsam auf den Platz geritten kamen. Sie sammelten sich auf einer freien Fläche neben den Marktständen, stiegen dort steifbeinig von den Pferden und starrten die überaus ängstlichen Marktbesucher bedrohlich an. Ihre Gesichtsmasken sahen fürchterlich wild aus, waren rot und gelb bemalt. Darunter trugen die Soldaten dick gepanzerte Rüstungen mit langen Schwertern. Unbeweglich verharrten sie, die eine Hand am Griff ihrer Waffe, die andere die Zügel ihrer Pferde haltend. Sie schienen offensichtlich auf etwas zu warten.
Wir Kinder standen atemlos da und starrten zu den fremden Soldaten hinüber. Das waren bestimmt keine Mongolen, auch keine Männer aus Yunnan. Dafür waren die Soldaten mit den Tigermasken viel zu groß gewachsen. Es mussten Chinesen aus dem Norden sein.
Die Kaufleute begannen ihre Stände hastig zusammen zu packen und ihre Waren in Sicherheit zu bringen. Rasch leerte sich der Platz. Zurück blieben die wartenden Tiger, die weiterhin unbeweglich ausharrten.
Nach einer Weile trafen weitere Gruppen von Soldaten ein, manche zu Fuß, andere zu Pferd. Ihre Anzahl stieg immer weiter an, bis der gesamte Platz mit ihnen gefüllt war. Meine Schwestern und ich standen immer noch da und blickten die fremden Krieger ängstlich und gleichzeitig fasziniert an. Doch plötzlich stand unsere Mutter neben uns und fuhr uns an: »Kommt sofort nach Hause. Das hier ist nichts für Kinder.«
Sie trieb uns zurück zum Anwesen, durch das Tor und auf den Hof hinein. Die beiden Hausdiener hatten auf unsere Rückkehr gewartet und schlossen hastig die Flügel hinter uns zu, legten auch den schweren Querbalken vor.
»Ins Haus mit euch«, befahl unsere Mutter mit strenger Stimme und wir Kinder gehorchten ohne Widerspruch, gingen hinein und setzten uns auf die Kissen an der großen Tafel in der Küche. Unsere Mutter ging nervös auf und ab, blickte immer wieder mit sorgenvollem Gesicht durch das Fenster auf den Hof hinaus. Dann begann sie plötzlich zu weinen. Meine Schwestern und ich waren über diesen Stimmungsumschwung bestürzt und erschüttert, blickten uns ohne Verständnis gegenseitig an. Was war geschehen? Warum weinte unsere Mutter? Hatte sie solche Angst vor den fremden Soldaten?
Plötzlich drang von draußen lautes Poltern zu uns herein. Jemand musste vor unserem Tor stehen und kräftig mit einem Knüppel dagegen schlagen. Eine Stimme rief auf Chinesisch: »Auf Befehl von General Xu Da, öffnet sofort.«
Meine Mutter hieß uns, in der Küche zu bleiben. Sie selbst ging jedoch zur Tür hinaus auf den Hof. Von dort drang ihre Stimme bis zu uns hinein.
»Hier ist das Haus des ehrenwerten Ma Hajji. Es sind nur Frauen, Kinder und ein paar Diener hier. Zieht in Frieden weiter.«
Doch der Mann vor dem Tor ließ sich durch die Worte meiner Mutter nicht wegweisen, sondern rief zornig: »Öffnet sofort das Tor oder ihr alle dort drinnen werdet sterben. Wir kommen auf direkte Anweisung von General Xu Da und dulden keinerlei Widerspruch.«
Über diese Worte erschraken meine Schwestern und ich. Gebannt standen wir am Fenster, reckten die Köpfe und schauten auf unsere Mutter. Die stand wenige Meter vor dem Tor, hatte sich hoch aufgerichtet, mit kerzengeradem Rücken, eine stolze, unnahbare Frau. Sie wies unsere Diener an, den Balken zu entfernen. Wang und Shin schlotterten vor Angst, so sehr fürchteten sie sich vor dem, was das Tor bislang draußen gehalten hatte. Als die Sperre endlich entfernt war, schwangen die Flügel sogleich auf und fünf Soldaten drangen mit gezogenen Schwertern in den Hof, verteilten sich dort und bedrohten unsere Mutter und die beiden Diener. Wir Kinder erschraken bei ihrem Anblick heftig und drängten uns unwillkürlich stärker zusammen, blickten jedoch weiterhin gebannt nach draußen.
Der Anführer der fünf Männer befahl: »Durchsucht Haus und Stall und bringt alle auf den Hof.«
Die anderen vier Soldaten setzten sich in Bewegung. Zwei steuerten den Stall an, zwei kamen ins Haus, fanden uns nach wenigen Sekunden und während einer von ihnen uns nach draußen schubste, suchte der andere die weiteren Räume ab.
Auf dem Hof mussten wir uns in einer Reihe aufstellen. Meine Mutter blickte den Anführer der Horde starr an. Sie schien keinerlei Angst mehr gegenüber dem Bewaffneten zu empfinden, zeigte dem gefährlich aussehenden Mann eine stolze Verachtung. Sie strahlte dabei so viel Kraft und Sicherheit aus, dass sie selbst diesen harten Soldaten zu beeindrucken schien. Ich bewunderte meine Mutter in diesem Augenblick mehr als je zuvor. Sie war eine echte Kriegerin und meinem Vater eine überaus würdige Ehefrau.
Als auch die anderen drei Soldaten zurückgekehrt waren und ihrem Anführer meldeten, dass sie niemand weiteres mehr gefunden hätten, wandte der sich an meine Mutter: »Ist das dein einziger Sohn?«, und damit deutete er mit seinem Schwert auf mich.
»Ja«, log meine Mutter und ihre Stimme klang dabei klar und fest, »er heißt He und ist zehn Jahre alt.«
»Er kommt mit uns«, meinte der Anführer hart und bestimmt und fügte dann an, »ihr anderen bleibt hier.«
Damit war alles gesagt. Zwei Soldaten packten mich unter den Achseln und hoben mich mühelos hoch und wandten sich zum Gehen, während meine Mutter aufschrie und sich auf den Anführer stürzte. Dieser schlug ihr jedoch brutal mit der Faust ins Gesicht und sie fiel benommen zu Boden. Meine Schwestern begannen schreiend zu weinen und ich hing, schlotternd vor Angst, zwischen den beiden hochgewachsenen Soldaten, spürte ihre harten Finger an meinen Oberarmen, fühlte ihre starren Lederrüstungen durch meine Hosenbeine. Vor Schreck war ich unfähig mich zu wehren, zu schreien oder auch nur zu weinen.
*
Ich weiß nicht, wie lange wir Kinder in diesem feuchten Keller eingesperrt waren. Bloß ein paar Tage? Oder gar viele Wochen? Die Zeit kam uns endlos vor und längst hatten wir aufgehört, die Mahlzeiten zu zählen, die sie uns regelmäßig hineinbrachten. Es waren die einzigen Minuten, wo die Schwärze um uns herum durch ein paar Öllampen erhellt wurde.
Die Soldaten hatten nach ihrem Einmarsch in Kunyang alle Knaben auf dem Dorfplatz zusammengetrieben. Hier hockten wir eine ganze Zeit lang am Boden, bis auch das letzte Haus durchsucht war. Danach führte man uns auf der Hauptstraße zur Stadt hinaus. Wir gingen stundenlang durch den Staub, bis die ersten von uns vor Schwäche hinfielen und nicht mehr weiterlaufen konnten. Ein Nachtlager wurde abseits der Straße aufgeschlagen und wir Kinder bekamen einen Becher Wasser und eine Schüssel Brei zu essen. Am nächsten Morgen ging es weiter, den ganzen Tag über und bis in die Nacht hinein. Längst hatten wir uns Blasen an den Füssen gelaufen und viele von uns wankten bei jedem Schritt, drohten vor Schwäche umzufallen. Keiner von uns wusste, wo wir uns befanden und wohin man uns brachte. Längst waren wir von der Hauptstraße auf einen Seitenweg abgebogen, der uns zwischen hohe Hügel führte. Es war bereits dunkel, als vor uns im Schein einiger Lampen ein riesiges Gehöft auftauchte. Die Gebäude waren ganz aus Stein gebaut und drei Stockwerke hoch. Nie zuvor hatte ich ein so großes Haus gesehen, abgesehen von Palast von Prinz Basalawarmi. Man führte uns durch ein Portal ins Innere. Dort mussten wir eine steinerne Treppe hinuntersteigen. Das Licht der wenigen Lampen warf bizarre Schatten an die Wände und die meisten von uns Kindern fürchteten sich vor ihnen, denn sie sahen aus wie Drachen oder böse Geister, die uns jeden Moment anfallen und verschlingen konnten. Die Jüngsten fingen wieder an zu weinen, wurden von den chinesischen Soldaten sogleich grob angeschnauzt. Unten ging es einen langen Gang mit vielen Türen entlang. An seinem Ende stand eine davon offen und wir wurden in einen großen, aber sehr niedrigen Raum gedrängt. Etwas Stroh war auf dem Boden ausgebreitet und es roch modrig und nach Alkohol. Vielleicht war er bisher als Lagerraum für Reiswein verwendet worden.
Wir mussten uns hinsetzen, dann gingen die Soldaten auch schon hinaus, verschlossen die Türe hinter sich und es wurde um uns herum finster. Viele Kinder riefen eine ganze Weile lang vor Angst nach ihrer Mutter oder ihrem Vater. Wir weinten gemeinsam und fühlten uns von aller Welt verlassen. Doch nach einiger Zeit wurden wir müde, kuschelten uns aneinander und schliefen erschöpft ein.
Seit unserer Ankunft gab es für uns weder Tag noch Nacht, nur eine sich öffnende Tür mit hellem Lampenschein, rasch verteiltem und hastig hinunter geschlungenem Essen und langem Warten in Dunkelheit.
Irgendwann blieb die Türe nach einer Mahlzeit jedoch offenstehen. Wir mussten uns nackt ausziehen und danach in zwei Reihen aufstellen. Dann wurden wir durch die Tür hinaus auf den Gang und von dort die Treppe hoch geführt. Es wurde immer heller um uns herum, wir sahen das Tageslicht von oben durch ein Fenster fluten, spürten in uns eine steigende Aufregung.
Wir traten durch das Portal in die gleißende Sonne hinaus. Halb blind stolperten wir zwei Stufen hinunter in den Hof und ich spürte plötzlich Sand unter meinen nackten Fußsohlen, klebriger Sand. Meine Augen tränten und schmerzten immer noch, als wenn mir jemand Nadeln hineinstoßen würde, so sehr brannte das Licht der Sonne in ihnen. Erst nach einer ganzen Weile klärte sich mein Blick und ich erkannte einen weiten Hof vor mir, auf dem auch noch andere Gruppen von nackten Knaben standen, hockten oder lagen, umringt von Soldaten. Von überall her tönten schmerzhafte und erschrockene Kinderschreie zu uns hinüber und als ich auf den Boden blickte, erkannte ich, dass der Sand um uns herum ganz braun war und entsetzlich süßlich stank.
Ein Chinese mit einer ledernen, fleckigen Schürze trat zu unserer Gruppe hinzu. Er hielt ein blutiges Messer in der Hand. Zwei Soldaten packten wortlos den erste von uns an seinen Armen und schoben ihn zum Mann mit der Schürze hin. Dieser griff dem Jungen zwischen die Beine, zog an seinem Geschlechtsteil und schnitt es dann mit einem Ritsch seiner scharfen Klinge einfach ab.
Der Knabe schrie erschrocken auf, hatte noch gar nicht begriffen, was mit ihm geschehen war. Sein Glied mit dem Hodensack ließ der Mann mit dem Messer achtlos in einen bereitstehenden Korb fallen. Dann kam auch schon der nächste von uns dran, wurde von zwei anderen Soldaten zum Mann mit dem Messer geführt, ein Schnitt und ein weiterer Penis landete im Weidekorb. Wir anderen Kindern standen starr vor Schrecken, konnten nicht glauben, was wir sahen. Dann drängten die ersten von uns aus dem Ring der Erwachsene, wollten ihnen entkommen. Doch die Männer hielten uns zusammen, verteilten Ohrfeigen oder schlugen mit ihren Fingerknöcheln hart auf unsere Köpfe, so dass wir Sterne sahen und uns rasch wieder zusammendrängten. So ergaben sich die meisten von uns ihrem Schicksal, wie Schafe im Angesicht der Schlachtbank. Jeder von uns kam an die Reihe, wurde von zwei Soldaten gepackt, zur Klinge geführt und verlor dort sein Geschlechtsteil. Alle schrien nach dem Schnitt auf, viele sanken sogar bewusstlos zu Boden oder weinten haltlos. Doch sie alle wurden von den Soldaten grob gepackt und zu einer etwas entfernt stehenden Mauer geschleppt. Dort war Stroh in Bahnen ausgebreitet und die Knaben wurden in langen Reihen darauf abgelegt. Dutzende lagen schon dort, krümmten sich vor Schmerz, Scham und grenzenloser Wut.
Mein älterer Bruder Wenming hatte mir vor einiger Zeit eine Schauergeschichte erzählt, in der ein Knabe von bösen Männern kastriert worden war. Wenming wollte mich mit der Erzählung sicher bloß erschrecken, was ihm aber nicht wirklich gelang. Die Geschichte klang einfach zu unmöglich. Doch genau dieses Schicksal sollte nun auch mir blühen. Das war für mich kaum vorstellbar. Träumte ich das alles bloß? Immer noch starr vor Schrecken schaute ich mit großen Augen dem grausigen Schauspiel nur wenige Meter entfernt zu. Doch ich spürte einen immer heftigeren, unbändigen Zorn in mir aufsteigen, geboren aus meiner Hilflosigkeit.
Als sie dann auch mich packten, da wehrte ich mich mit all meiner Kraft und Verbissenheit gegen die beiden Verfolger. Nein, so einfach wollte ich es ihnen nicht machen. Ich kämpfte wie um mein Leben. Mit einem Bein trat ich nach dem Stiefelschaft eines der Soldaten, traf ihn mit dem Fußrücken schmerzhaft auf das Schienbein. Er schrie auch ärgerlich auf und ließ meinen Arm einen Moment lang los. Ich warf mich herum und biss dem anderen Kerl in den Unterarm. Dieser war zwar durch seine dicke Jacke geschützt, doch meine Zähne bohrten sich mit ganzer Kraft in den Stoff hinein. Er schrie ebenfalls auf, eher ärgerlich als schmerzhaft, schwang seinen Arm herum und ich wurde mitgerissen. Dann schlug mir der erste Mann mit der Faust hart auf den Kopf und ich verlor für zwei Sekunden das Bewusstsein, fühlte bloß, wie sie mich von neuem packten und mir diesmal die Arme auf den Rücken drehten. Trotz der Schmerzen in meinen Schultern bäumte ich mich auf, als sie mich vor den Mann mit dem Messer führten, versuchte, diesem mit meinen Füssen in den Bauch zu treten. Der lachte jedoch bei meinem Strampeln nur grimmig auf und wich den Beinen geschickt aus, ließ gleichzeitig sein Messer zu Boden fallen und schnappte mit beiden Händen nach meinen Fußgelenken, vermochte sie zu packen. So zwangen mich die drei Männer schließlich auf den Boden, wo ich mich immer noch mit ganzer Kraft wehrte. Doch es half alles nichts. Einer der beiden Soldaten kniete sich auf meine Brust und hielt meine Arme fest, so dass mir die Luft wegblieb, der andere packte meine Fußgelenke und zwang meine Beine auseinander. Der dritte mit dem Lederschurz hob schließlich die blutige Klinge vom Boden auf. Dabei grinste er mich belustigt und anerkennend zugleich an.
»Du bist ja ein richtig tapferer Kämpfer«, meinte er überhaupt nicht böse, sondern aufmunternd und gut gelaunt, »aus dir kann mal was werden, Junge.«
Dann wischte er das sandige Messerblatt an seiner Lederschürze ab und griff nach meinem Penis. Seine schwielige Hand fühlte sich rau an, als er zugleich Glied und Hodensack von mir packte, an ihnen zog und beide mit einem raschen Schnitt seiner Klinge abtrennte. Ich schrie mehr vor Überraschung denn vor Schmerz auf, ja, anfangs spürte ich gar nichts von der Verletzung zwischen meinen Beinen, hatte bloß ein völlig leeres Gefühl in meinem Unterleib. Der auf meiner Brust kniende Soldat ließ endlich von mir ab, ich richtete meinen Oberkörper etwas auf, stützte mich dabei auf meine Ellbogen und blickte auf die Wunde zwischen meinen Beinen hinunter. Als ich das viele Blut sah und roch, wurde mir elendig und am liebsten wäre ich in diesem Moment gestorben. Der Mann mit der Klinge stand immer noch lächelnd über mir. Dann warf er mir meinen Penis auf den Bauch und meinte: »Den darfst du ausnahmsweise behalten. Weil du so tapfer gekämpft hast, mein Junge.«
Mein Glied mit der so überaus zarten Haut und dem schrumpeligen Hodensack mit den beiden kleinen Eiern darin fühlte sich noch warm, aber völlig fremd in meiner Hand an. Ich drückte sie trotzdem an meine Brust, verbarg sie mit beiden Händen wie einen Schatz. Doch dann stellte sich der furchtbare Schmerz plötzlich ein, überflutete meinen ganzen Körper wie eine feurige Welle. Ich krümmte mich zusammen und begann laut schreiend zu weinen. Halb betäubt vor Pein lag ich am Boden, schrie meine heiße Angst und die grenzenlose Wut gleichermaßen hinaus. Jemand packte mich unter den Achselhöhlen und schleppte mich hinüber zur Mauer mit dem ausgebreiteten Stroh, ließ mich dort achtlos fallen.
Wenig später trat eine Frau zu mir hin, drehte mich auf den Rücken und untersuchte die klaffende Wunde zwischen meinen Beinen. Sie streute erst eine Handvoll weißes Pulver darauf, das höllisch brannte und sich sofort rot zu verklumpen begann. Der neue Schmerz übertraf den bisherigen sogar noch und ich glaubte einen Moment lang, sie hätte mir fein zerriebenes Salz in die Wunde gestreut und die Frau wollte mich zu Tode quälen. Doch dann legte sie ein weiches, mehrfach eingeschlagenes Tuch darüber und wickelte eine Stoffbahn geschickt um mein Becken und die Oberschenkel, fixierte so den Verband auf der Wunde. Dann stand sie auf und ging zum nächsten Knaben, der kaum einen Meter von mir entfernt hingelegt worden war. Es war Zui Sha, ein Nachbarjunge aus meinem Dorf. Mit ihm hatte ich mich nie gut verstanden und wir hatten uns böse Streiche gespielt, hatten uns auch schon mehrmals geprügelt.
Nachdem auch er verbunden war, drehte er mir sein verweintes Gesicht zu.
»Wir sind alle tot, He«, jammerte er mit vor Schmerz gezeichnetem Gesicht.
»Warum sagst du so etwas, Sha?«, gab ich ihm trotzig zur Antwort. Ich versuchte, den unsäglichen Schmerz zwischen meinen Beinen zu ignorieren und meine Stimme möglichst fest klingen zu lassen, »man hat uns zwar geschunden, doch nicht getötet.«
»Ich spüre aber, dass ich sterben werde. Schau doch meine Wunde an. Sie blutet immer noch weiter. Der ganze Verband ist schon rot.«
Ich blickte zwischen seine Beine und tatsächlich drückte sein Blut bereits durch das Tuch hindurch und tränkte die Stoffbahnen. Erschrocken und voller Angst blickte ich an meinem Körper hinunter, erkannte sogleich, dass der dicke Verband nur einen einzigen, recht kleinen, roten Punkt aufwies, der nicht weiter anwuchs. Die Blutung musste bei mir wohl gestoppt haben. Sofort machte sich ein beruhigendes Gefühl in mir breit, eine eigentümliche Freude, trotz meiner so misslichen Lage und all der Schmerzen. Ich richtete mich noch etwas höher auf und rief die Frau an, die erst mich und dann Zui Sha verbunden hatte und die bereits zwei Kinder weiter am Boden kniete, um den nächsten Knaben zu versorgen.
»Was willst du?«, gab sie ärgerlich zurück.
»Können Sie bitte noch einmal nach meinem Freund hier sehen? Bei ihm hört es nicht auf zu bluten.«
Sie blickte dumpf und ohne erkennbares Interesse zu Sha hinüber und schüttelte dann den Kopf.
»Manche überleben, die meisten sterben sowieso. Jeder bekommt dieselbe Chance.«
Damit ging sie weiter zum nächsten Knaben in der Reihe. Das Gesicht der Frau hatte bei ihren kalten Worten völlig gleichgültig und wie tot ausgesehen, als wäre sie aus Stein und kein lebendiges Wesen. Dieses unbeteiligte, verhärmte Gesicht der Frau, die wohl längst zu keiner menschlichen Regung mehr fähig war, würde mich mein Leben lang verfolgen.
Sha starb wenige Stunden später. Ich war in einen betäubenden Halbschlaf gefallen, hörte kaum mehr sein Jammern oder auch nicht das der anderen Knaben um mich herum. Doch als ich wieder zu mir kam, atmete Sha nicht mehr. Seine starren, weit geöffneten Augen blickten mich jedoch immer noch ängstlich an. Auch die meisten anderen Knaben um mich herum waren wohl aufgrund des hohen Blutverlusts irgendwann in der Nacht gestorben. Die meisten schienen allerdings friedlich und vor Erschöpfung eingeschlafen zu sein. Ihr Herz hatte irgendwann einfach aufgehört zu schlagen.
Soldaten gingen unsere Reihen ab, packten alle toten Kinder, schleiften sie zu einem Karren hinüber und warfen sie dort achtlos aufeinander, stapelten sie bis über die Seitenbretter hinaus. Dann kam auch Sha neben mir an die Reihe, landete auf dem bereits sehr vollen Wagen ganz zuoberst. Er lag auf seinem Rücken, die Arme weit von sich gestreckt, den Kopf nach unten und zu mir hingedreht. Er schien mich immer noch anzustarren, voller Angst und ohne jede Hoffnung.
Als sie den Karren über den unebenen Hof wegführten, da baumelte sein Kopf hin und her. Es sah aus, als würde sich Sha immer noch darüber wundern, was ihm zugestoßen war.