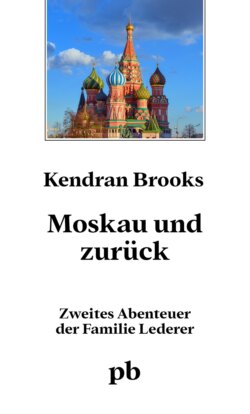Читать книгу Moskau und zurück - Kendran Brooks - Страница 8
Freitag, 26. Sept. 2008
ОглавлениеJules hatte die Nacht über nicht schlafen können, lag lange wach, wusste bald nicht mehr, wie er seinen Körper betten sollte. Darum war er aufgestanden und in den Sportraum hinunter gegangen, strampelte sich dort auf dem Hometrainer eine halbe Stunde lang die Seele aus dem Leib. Dann stürzte er unter die Dusche, stellte den Wasserhahn auf eiskalt und drehte ihn bis zum Anschlag hoch. Zu Anfang konnte er kaum atmen, so sehr traktierte ihn der harte Strahl, nahm ihm ganz einfach die Luft weg. Nach einer Weile wechselte er auf warm und verringerte die Wassermenge, streckte die Arme aus und stützte sich mit den Händen an der gekachelten Wand ab, ließ das Wasser auf seinen Nacken plätschern und seinen Gedanken freien Lauf. Hinterher wusste er nicht mehr zu sagen, wie lange er in der Dusche gestanden war. Irgendwann hatte er sich abgetrocknet, eine leichte Trainingshose übergezogen und war hoch ins Wohnzimmer gegangen, hatte sich aufs Sofa gesetzt.
Seitdem starrte er zum Fenster hinaus, auf den nebelverhangenen Genfersee hinunter, der sich mit der aufsteigenden Sonne langsam aus seiner weißen Decke zu lösen begann. Nur ein Anruf von Henry Huxley hatte ihn für kurze Zeit aus seinem Dämmerzustand erwachen lassen. Danach gab er sich ihm wieder hin.
Jules fühlte sich so unendlich müde und kraftlos, lag mehr, als dass er saß, spürte seine verkrampften Nackenmuskeln, die ihm bald schon Kopfschmerzen bereiten würden. Seine fehlende Energie war bestimmt auch eine Folge des reichlich genossenen, dreißigjährigen Dalmore, der ihm den ganzen Abend lang und die halbe Nacht über ein zuverlässiger Freund war. Die zuvor fast volle Flasche stand nun leer neben dem Glas auf dem Tisch und trotzdem hatte er im verlassenen Ehebett keinen Schlaf finden können.
Seine Gedanken formten sich nur langsam und waren allesamt so trüb wie der neblige Tagesbeginn draußen, dort, wo das wirkliche Leben stattfand.
Gab es ein Bewusstsein nach dem Tod?
Jules hoffte es für all jene, die bereits gestorben waren und daran geglaubt hatten. Denn wie unsagbar traurig wäre doch ein Leben, wenn man über Jahre und Jahrzehnte hinweg einem Traum nachgejagt war, der sich letztlich als reine Illusion erwies?
Er selbst mochte nicht an ein Dasein nach dem Sterben glauben. Er lehnte die Gnadenlehre eines Augustinus ebenso ab, wie die Erwiderungen Julians. Beide legten das Schicksal der Menschen in die Hände eines unergründlichen Gottes, der angeblich alle Fäden in der Hand hielt, jedoch nicht daran ziehen mochte.
Aber ewiges Leben oder Wiedergeburt waren wenigstens Funken der Hoffnung für all jene, die unerfüllte Wünsche, unerledigte Aufgaben oder schlimme Verfehlungen hatten zurücklassen müssen.
Ewiges Leben?
Wiedergeburt?
Konnte man ernsthaft an etwas so Absurdes glauben?
Schon als Jugendlicher war es ihm reichlich feige vorgekommen, die eigene Sterblichkeit vor sich selbst zu verleugnen, sich aus diesem Grund einer Religion hinzugeben und so eine Art von konsequentem, lebenslangem Selbstbetrug zu zelebrieren. Der Glaube an eine Zeit nach dem Tod war für Jules seit jeher bloß eine Beruhigungspille für die eigenen Nerven gewesen, zur Dämpfung eines wachen und erwachsenen Verstandes. Auf etwas zu spekulieren, das mit dem Verstand nicht fassbar war, konnte einfach nicht der richtige Weg sein.
Doch war Verstand das einzig Wahre im Leben?
Wenn der Schmerz in einem tobte, konnte sich der Mensch schlecht dagegen wehren. Vor allem dann nicht, wenn er den Schmerz, so wie Jules, auch noch willkommen hieß.
Für Jules bedeutete der Druck in seinem Herzen, die Flauheit in seinem Magen, die Verwirrung in seinem Hirn die Erlösung vor dem eigenen Versagen, eine Buße im Angesicht seines verhassten Schicksals.
Endlich raffte er sich auf, schleppte sich in die Küche, nahm eine der stets gewärmten Espresso Tassen von der Heizplatte der Kaffeemaschine, stellte sie unter den Ausguss und drückte die richtige Taste. Das harte Knacken im Mahlwerk stach in seinen Kopf, wühlte dort Erinnerungen auf, Bilder von splitternden Knochen und zermatschten Gliedmaßen. Das Busunglück in Ecuador, die Frau neben ihm, deren Brustkasten vom abgebrochenen Ast durch das zerbrochene Fenster hindurch aufgespießt wurde. Das Blubbern der schwarzen Flüssigkeit, die sich erst mit starkem Strahl, kurz darauf bereits heller und dann schaumig tropfend in die Tasse ergoss, erinnerte ihn an das gurgelnde Röcheln des Mädchens in der Sitzreihe vor ihm, dessen Kopf vom selben Ast fast vollständig abgetrennt wurde.
Jules wischte die dunklen Erinnerungen beiseite und stürzte den Espresso trotz seiner Hitze in einem Zug hinunter, verbrannte sich wohltuend Zunge und Mundraum. Er spürte den Schmerz auf das Angenehmste, lockte ihn selbst weiter und tiefer in sein Gehirn hinein, immer in der Hoffnung, damit die andere, viel tiefer sitzende Pein endlich zu vertreiben, diesen heimtückischen Herd all seiner Qualen, dieser eine und wahrhaftige Teufel, der irgendwo in ihm drinnen beständig auf der Lauer lag, jederzeit bereit, erneut heraus zu springen und ihm alle positiven Empfindungen zu rauben oder auszusaugen, ihm auf diese Weise auch noch den allerletzten Lebenswillen ins Nirgendwo abzuleiten.
Sollte er heute vielleicht wieder einmal mit dem Boot auf den See hinausfahren? Er brauchte bloß Jacke und Schuhe anziehen, die lange Treppe bis zum Steg hinuntergehen, die Leinen losmachen, starten und Gas geben.
Doch wozu?
Als Flucht vor der Wahrheit? Nur um sich noch länger etwas vorzumachen? Bloß um sich den Tatsachen nicht stellen zu müssen? Irgendwann würde er doch wieder zurückkehren müssen, in dieses Haus, das kein Heim mehr war, zurück in das einst vertraute Leben, in dem so viel schiefging, in ein Dasein, das er am liebsten abgestreift und weggeworfen hätte. Doch für diesen einen Schritt hätte er genügend Kraft aufbringen müssen, ein gewisses Maß an Energie. Und die verspürte er längst nicht mehr in sich.
Jules ging langsam zurück in das Wohnzimmer, setzte sich auf dieselbe Stelle der Couch wie zuvor. Das Leder fühlte sich noch warm an. Links von ihm lag das Handy, mit dem er mit Henry telefoniert hatte. Über was hatten sie gesprochen? Er wusste es nicht mehr.
Die Sonne hatte in der Zwischenzeit die letzte Tristheit des Nebels verscheuchen können und überflutete den See nun golden, hatte ihn ganz für sich eingenommen und ließ das Wasser verführerisch glitzern.
Ja, es wäre herrlich, mit dem Jeanneau Leader über die flachen Wellen zu hüpfen, getrieben von dreihundert Pferdestärken. Jedes Antippen des Gashebels würde der Motor mit Freuden aufnehmen und in Kraft und Schub umsetzten. Der kühlende Wind würde ihm ins Gesicht peitschen, seine Augen tränen und den Mund erstrahlen lassen. Das Lenkrad würde vibrieren und ein kribbelndes Zittern auf Hände und Arme übertragen. Über ihm wäre nichts als der klare, blaue, endlos weite Himmel, während er über das Wasser jagte.
Ja, das wäre genau das Richtige, um all seine trüben Gedanken endlich weg zu wischen. Es wäre das Richtige gewesen, wenn er dabei nicht ganz allein gewesen wäre.