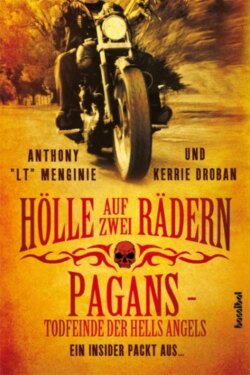Читать книгу Hölle auf zwei Rädern - Kerrie Droban - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеJohns’ Hospital in Delaware County war für einen Drogensüchtigen oder Armen ein guter Grund, nicht krank zu werden. Die Wände ähnelten aschfahler Haut, durchzogen von blutleeren und verkümmerten Venen. Das Personal schlurfte über die Flure, und ihre Gespräche erinnerten an das Geschnatter einer seltenen Vogelart. In der Luft hing der Geruch von Fäulnis und verdreckter Bettwäsche. Das geschäftige Treiben wurde durch gellende Schreie unterbrochen.
Ein Arzt mit pockennarbigem Gesicht und zusammengepressten Lippen spielte mit seinem Kugelschreiber, während er um Worte rang. Er wirkte so unordentlich wie die Patienten. Nur sein weißer Kittel und der Geruch von Desinfektionsmitteln unterschieden ihn von den anderen. Ich ging nervös über den Flur der Intensivstation, die Arme vor der Brust verschränkt, die Schultern hochgezogen, und hoffte, dass die Körperhaltung meine Angst verschleiern konnte.
„Menginie, stimmt doch?“ Er war über meinen italienischen Nachnamen gestolpert.
„LT.“ Ich zuckte mit den Schultern, als wäre es egal geworden, wie mich die Leute nennen. Little Tony. Kid. Kleiner. Ich hatte noch nicht mal einen Namen, bis ich alt genug war, um zu sprechen.
„Sie hat eine 30-prozentige Überlebenschance.“
Ich schluckte und ließ meinen Blick in den angrenzenden Raum schweifen.
Meine Mutter lag zusammengekauert wie ein Fötus auf dem Bett und wippte hin und her. Sie riss das dünne Laken runter, das auf den Boden fiel. Dünne Strähnen ihres blonden Haares klebten an den Wangen. Sie hatte schon seit Wochen nicht mehr geduscht und stank nach Erbrochenem. Das Blut pochte in meinen Ohren und ich fröstelte, was an der Kälte lag, vor allem aber am zunehmenden Gefühl der Verzweiflung. Das ist meine Mum. Ich darf sie nicht verlieren. Sie ist meine ganze Familie, Zeuge meiner Geburt. Ich spürte meinen Körper nicht mehr, betäubt von Resignation, und kam mir vor wie ein 13-Jähriger, der an seinem Daumen lutschte und nicht in der Lage war zu weinen. An diesem Punkt verdrängte der ungestüme und aggressive Wille zum Handeln die Emotionen. Ganz schön gefühlsduselig, dachte ich mir. Ich war 28 und der Sohn des berüchtigsten und brutalsten Anführer des Pagan Motorradclubs.
„Hilf mir“, flüsterte Mum. „Zieh die Vorhänge zu.“
„Was fehlt ihr?“, fragte ich. Sie schläft und bricht, schläft und bricht.
„Sie ist Alkoholikerin.“ Der Arzt steckte den Kugelschreiber in die Kitteltasche. „Sie leidet an Entzugssymptomen. Bei ihr wirkt sich das schlimmer aus, als bei einem Heroin-Entzug. Im Moment muss sie sich übergeben, wenn sie keinen Alkohol trinkt!“
Täglich Unmengen Wodka und zur Abwechslung Grand-Dad und Jack Daniel’s – ja, sie musste ihren Preis dafür zahlen.
„Die Bauchspeicheldrüse ist entzündet und hat einen Laborwert von 16.000. Bei Gesunden liegt der bei 200 oder darunter“, fuhr der Doktor fort, doch ich hörte kaum zu.
„Sie wird sterben, nicht wahr?“ Ich begann zu zittern.
„Ich bin schon lange tot“, brüllte Mum.
„Sie verletzt sich mit Rasierklingen, wussten sie das?“ Ich ging langsam zur Krankenschwester, die die Pupillen meiner Mutter mit einer Stableuchte untersuchte, als würde sie nach einem Funken der Jugend tief in einer Höhle suchen. Das ganze Zimmer roch nach Urin. Und dies war erst der zweite Tag von voraussichtlich wochenlangen Krankenhausbesuchen! Bisher ging es Mum nicht besser. Sie reagierte selbstdestruktiv. Ein Bett auf der Intensivstation bedeutete, dass hier kaum jemand lebend rauskam. Dieser Gedanke nagte an mir, denn der Tod hatte meine Kindheit bestimmt – allein 13 Beerdigungen bevor ich zwölf Jahre alt war. Nach den ersten Begräbnissen spulten die Trauernden ein Programm der Gefühle ab, die sie für angemessen hielten, aber nicht so empfanden. Meist versammelten sich die Biker vor einer stickigen Friedhofskapelle, wobei der bewegungslose Gesichtausdruck ihre schlimmste Angst verbarg – die Angst vor dem eigenen Tod, der rasend schnell auf sie zukommen, sie wie der Schuss einer Schrotflinte aus dem Leben reißen konnte.
„Sie ist 52?“ Die attraktive, etwas steife Krankenschwester zog die Augenbrauen hoch und sah mich an, als hätte ich mir das Alter gerade ausgedacht.
Sie sieht aus wie 80, benimmt sich aber wie eine Zehnjährige, wie ein Säugling. Stirbt sie?
„Wissen Sie, wer Sie sind?“, fragte sie Mutter mit lauter und eindringlicher Stimme, die erst wenige Augenblicke zuvor noch geglaubt hatte, dass George Washington immer noch Präsident ist.
Mum antwortete blinzelnd: „Meinem Aussehen nach wohl ein Museumsstück.“ Getrocknete Spucke bedeckte ihre Lippen und die milchigen Augen schwollen an. Mum war so spindeldürr, dass sie einem missgebildeten Kind glich. Mit den schrecklich bleichen Händen berührte sie zitternd den Hals und stammelte etwas von Bikern und dem Kodex des Pagan Club – das Bike, der Club, der Hund, die Frauen und dann die Kinder. In dieser Reihenfolge.
„Hilf mir“, schrie sie mich an.
Hilf mir. Das Fernsehen über ihrem Bett dröhnte vor sich hin. Mum wand den knöchrigen Arm durch das verchromte Bettgitter und versuchte mich zu berühren.
„Da gibt es etwas, dass du über deinen Vater wissen musst“, keuchte sie mit klangloser Stimme. Die Krankenschwester verließ diskret den Raum. Jetzt kommt’s. Mir war Mangy egal, denn ich hatte jeglichen Bezug zu meinem alten Herrn verloren. In einem Zeitungsartikel wurde er als Schildkröte beschrieben, die sich in einem Schwarzenviertel in Philadelphia verkroch und manchmal einen verstohlenen Blick aus dem Panzer warf – König seiner eigenen, dunklen Welt, geschützt von genau den Bürgern, die er zu zerstören geschworen hatte.
„Mum, bitte sag nichts.“
„Mangy und ich haben uns in einer Bar kennen gelernt, dem Accident. Das hätte ich als böses Omen auffassen müssen. Er machte mir nie einen Heiratsantrag. Eines Tages befahl er mir einfach, seine alte Dame zu werden.“ Mit zitternden Händen zog sie das Kissen zurecht.
„Ich war keine gute Frau.“
„Ich bin mir sicher, dass du alles richtig gemacht hast“, antwortete ich, mir meiner Lüge bewusst.
Sie schüttelte den Kopf. „Ich hatte die Nerven, zwei Mal schwanger zu werden.“
Das waren also die Neuigkeiten!
„Ich habe das erste abgetrieben, denn ein Kind passte einfach nicht in das Biker-Leben.“ Sie hustete. „Aber das zweite.“ Sie legte den Kopf auf die Seite und lächelte mich an: „Ich machte Mangy klar, dass er verrecken kann, wenn er mich daran hindern würde, es auszutragen.“
„Danke, Mum.“
Einen Moment lang herrschte totale Stille. Ich richtete die Fernbedienung auf den Fernseher, um ihn abzustellen, und die schönen Menschen mit ihren ach so weißen Zähne verschwanden.
„Er beobachtet mich schon wieder.“ Mum umklammerte den Hals mit ihren Händen. Tag drei. Ihr ganzer Körper zitterte. Sie sah noch dünner aus und wirkte wie ein unförmiger Kopf, der an einem Kleiderbügel befestigt ist. Mum schien nur noch mit weißen Kabeln verdrahtet zu sein. Aus dem Bettmonitor erklang ein Piepton. Zumindest auf dem Monitor zeigte sich Leben. Der Puls wurde mit einer grünen Kurve abgebildet. Ein Katheterbeutel tanzte auf ihrer Hüfte.
„Wer?“ Ich schlüpfte aus dem roten Trenchcoat und hängte ihn über eine Stuhllehne.
„Dein Vater. Er steht vor dem Fenster.“
„Mum, wir sind in der vierten Etage.“ Trotzdem warf ich einen Blick nach draußen. Die Straße unten schimmerte blau, erleuchtet von den Scheinwerfern der Autos. Schnee fiel. In meinem Kopf spürte ich ein Hämmern und ich sehnte mich nach einem Joint. Ich war nicht von dem Zeug abhängig – nicht mehr. Aber Marihuana beruhigte die Nerven.
„Er ist gekommen, um uns Geld zu bringen“, unterbrach Mum meine Gedanken. Sie war aus dem Bett gestiegen.
„Nein!“ Ich drehte mich schnell um, packte sie am Ellbogen und führte sie langsam zurück zum Krankenbett.
„Mir ist so kalt“, flüsterte sie mit einer dünnen und kindlichen Stimme.
Langsam setzte ich sie hin, auf Bettlaken, die mit Fäkalien braun beschmiert waren.
„Schwester“, rief ich, als ein kalter Luftzug über meine Haut strich. Über mir drehte ein Ventilator seine Runden und warf gezackte Schatten auf die Decke. Für manche Menschen glich Johns’ Hospital einem Grab. Für Arme bestand kaum eine Aussicht auf Genesung. Sie wurden einfach ihren Angehörigen zurückgegeben, wie ein Haufen zusammengeschusterter Ersatzteile, in der Hoffnung, dass niemand einen Unterschied bemerkt. Im langen Flur hallten Schreie, unterdrücktes Stöhnen und Flüche.
„Was ist denn mit euch allen los? Helft ihr!“ Wutentbrannt rannte ich in den Flur.
Die Krankenschwestern betrachteten mich mit einem stumpfsinnigen, leblosen Gesichtsausdruck. Überall lag Papier auf dem Boden. Eine, den Kugelschreiber hinter das Ohr gesteckt, flüsterte zu ihrer Kollegin: „Unser Antreiber.“
Verdammt. Ihr sollt alle verdammt sein.
Mit zitternden Händen ging ich wieder in Mums Zimmer, befeuchtete einen Waschlappen und tupfte vorsichtig um die wunden Stellen an ihrem Bein herum. Dann wusch ich ihn aus und strich damit langsam über Mums Arme und ihr Gesicht. Kalte Tränen liefen an ihren Wangen herab.
„Du bist ein gutes Kind, so ein gutes Kind.“
Mum. Wie wahnsinnig riss ich sie an den Schultern hoch, nur noch eine trockene Hülle, in die sich Maden eingenistet hatten. Erschreckt zuckte ich hoch. Der ganze Körper war noch steif vom Schlaf auf dem unbequemen Stuhl. Meine Beine kribbelten. Mutter keuchte. Sie schlief, und ihre Beine steckten in diesen Katzenpantoffeln mit den aufgenähten Stoff-Figuren. Ein Arzt stand im Türrahmen und hatte eine ernste Miene aufgesetzt.
„Sie kann keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen.“ Erschöpft und müde presste er Mums Fieberkurve an seine Brust. Auf dem Monitor sah ich nur noch eine flache, grüne Linie.
„Ist sie tot?“, fragte ich mit zitternder Stimme.
„Wenn sie nicht bald etwas trinkt, wird sie sterben.“
Die Linie auf dem Monitor machte einen leichten Ausschlag. In Mum regte sich noch ein Hauch von Leben. Ich drückte ihre Hand. Die Haut war faltig. Ich spürte jeden einzelnen Knochen. „Du darfst keinen Alkohol mehr trinken, verstehst du?“ Ich spürte, wie sich ein Kloß in meinem Hals bildete.
Tränen bedeckten die Wimpern. Ganz zaghaft hauchte sie: „Das verspreche ich.“ Dann, nach einer kurzen Pause, fragte sie: „Und wie sieht es mit den Tabletten aus?“
„Da ist ein kleines Mädchen in meinem Zimmer.“ Mutters krallenähnliche Finger umklammerten das Bettgitter. Die Pupillen ihrer eingefallenen Augen waren größer, als sie eigentlich sein sollten.
„Hier ist niemand, Mum.“ Ich streckte mich zum Fenster und sah mein Spiegelbild im Glas. Meine Augen wirkten leblos, als wäre das Licht in ihnen erloschen. Ich biss mir mit den Zähnen auf die Wangeninnenseite und spürte das eigenartige Gefühl von Monotonie gepaart mit Anspannung. Beerdigungen versprachen wenigstens einen Abschluss und Feierlichkeiten, während Krankheiten, besonders Demenz, einen Menschen auf sich selbst zurückwarfen, ihn dazu brachten, sein eigenes Leben zu hinterfragen. Und ich war mir nicht sicher, ob ich mich schon für so eine Innenschau bereit fühlte.
„Da ist sie doch“, drängelte Mum, wobei sie mit der dürren Hand in der Luft gestikulierte. Sie warf die Laken zur Seite und setzte sich auf den Bettrand. „Schaff sie hier raus. Sie wird sterben.“
„Mum, was machst du da“, protestierte ich. „Das ist doch nur mein Mantel!“ Ich zog den Trenchcoat vom Haken, hielt ihn vor die Brust und winkte mit den leeren Ärmeln.
Der Gesichtsausdruck meiner Mutter verfinsterte sich, sie zog die Augenbrauen zusammen und ließ die Zunge schlangengleich über ihre Oberlippe fahren. „Motherfucker“, kreischte sie und warf mir die Fernbedienung an den Kopf. Unsicher stellte sie sich hin, fiel auf den Boden, wodurch sich ein nasser, brauner Fleck auf ihrem Krankenhausnachthemd zeigte.
„Schwester“, schrie ich mit erstickter Stimme. „Verdammt noch mal, helft uns doch!“
Ich zog Mutter vom verdreckten Boden hoch, fiel mit ihr aufs Bett und roch den nach Aufschnitt stinkenden Atem. Meine Arme waren mit Kot verschmiert. Sie hatte Durchfall und der Nachtopf quoll über. Der Darm entleerte sich mit ungeheurem Druck. Ich erinnerte mich an einen ihrer Selbstmordversuche vor vier Jahren. Sie hatte sich mal wieder im Badezimmer eingeschlossen. Es war noch dunkel, ungefähr vier Uhr morgens. Ich schreckte durch das Geräusch laufenden Wassers hoch. Ein Topf knallte in der Küche.
Dann hörte ich das bekannte Knistern von Cellophan, als Mum wieder eine Packung Rasierklingen öffnete, und hämmerte an die Tür des Bads. Keine Antwort.
„Hau ab!“
Ich klopfte noch lauter. Teller zerschellten in der Küche unter mir. Gedämpftes Lachen drang durch die Dielen.
Ich hörte ein metallisches Klicken, denn Mum hatte den Riegel zur Seite geschoben. Mit einem Quietschen öffnete sich die Tür und da sah ich sie: nackt, ein Bein in der Badewanne, während das andere über den Rand baumelte, blutverschmiert, mit einer Rasierklinge in der Oberschenkelarterie.
„Sie wird morgen entlassen“, erklärte der Arzt und drückte Mums Akte fest an seine Brust. „Hat sie ein Zuhause?“
Ich stand in ihrer Küche und hatte die Hände in die Seiten gestemmt. Ein schwerer Druck lastete auf meiner Brust. Ich traute mich nicht, das Licht anzumachen. Es war wohl besser im Dunkeln zu arbeiten und sich der Illusion hinzugeben, dieses Drecksloch sauber machen zu können. Chuck, der aktuelle Lebensgefährte von Mum, hockte auf einem Stuhl in der Ecke. Sein Oberkörper war vornüber gebeugt, er war blind und zitterte. Keiner von uns brachte ein Wort über die Lippen. Ich fühlte mich total verloren, wie ein Möbelstück aus einem anderen Haus, das nicht zum Inventar passte. In meiner Erinnerung tauchte ein Geruch auf – der widerlich süßliche Gestank von ungewollter Nähe. Doch dann atmete ich befreit durch. Ich muss zugeben, dass ich als Kind besorgt war, mein Leben würde keine Spuren hinterlassen – dass all die Gewalt und die Wut die Wände wie eine starke Droge durchdringen würden, dass ich mich auflösen würde. Übrig bliebe nur ein leerer Raum für nichts ahnende Bewohner, die einfach neu begännen – als wäre der Schmerz nur eine schillernde Politur, die entfernt wird. Keine Narben. Keine Zeugen. Nur noch ein Geruch.
Ich tröpfelte das Bleichmittel auf einen Putzlappen und holte tief Luft. Schmutziges Geschirr stapelte sich in der Spüle. Der Müllbeutel quoll über von leeren Flaschen Wodka, Jack Daniel’s und Dosen von Frühstücks-Fastfood. Wasser tröpfelte aus dem Hahn und hinterließ ein Rinnsal auf der Arbeitsplatte. Die Tür des Kühlschranks öffnete sich mit einem Knacken, und das kleine Lämpchen flackerte. Fliegen umschwirrten halb gegessene Hamburger. Verschüttete Milch lief die Ablagen runter, da der Karton ohne Verschluss auf der Seite lag. Ich blickte auf das zerknitterte Schwarzweißfoto eines lächelnden Kindes. Die Regale waren mit zahllosen Reihen Bierdosen gefüllt. Das Saubermachen wurde zu einem Ritual, einer Art kathartischer Befreiung. Ein Raum spiegelte das Leben seiner Bewohner wider. Nichts war statisch. Der Dreck würde sich wieder ausbreiten, aber trotzdem gab mir das Putzen ein gutes Gefühl – einfach den Schmutz auf der Oberfläche wegwischen. Auch wenn das alles keinen Sinn ergab.
Ich öffnete ein Fenster und spürte, wie mir der kalte Wind ins Gesicht schlug. Es war noch früh am Morgen, und der Himmel war bedeckt. Ich hatte versprochen, meine Mutter an Nachmittag abzuholen. Ich ließ mich auf die Knie fallen und schrubbte wie ein Wahnsinniger den Boden mit der Bleiche, wobei sich die Farbe von Mattbraun in Elfenbein veränderte. Der Schweiß lief mir von der Stirn und stach in meinen Augen. Ich arbeitete bis meine Hände wund wurden, stand auf, ging zur Arbeitsplatte und träufelte noch mehr Bleiche auf den Lappen. Das matte Licht am Himmel verdunkelte sich und schien heftigen Schneefall anzukündigen. Ich leerte einen weiteren Müllbeutel und streckte mich, da ich nun schon seit Stunden am Arbeiten war und mein ganzer Körper schmerzte. Doch der Schmerz gab mir ein gutes Gefühl und erinnerte mich an meine Lebendigkeit. Das war etwas ganz Besonderes – sich lebendig zu fühlen.
„Das riecht hier gut“, meinte Chuck, wobei er doch noch seinen Kopf erhob.
„Meinst du, es wird ihr gefallen?“, hakte ich nach.
„Es wird ihr noch nicht mal auffallen.“