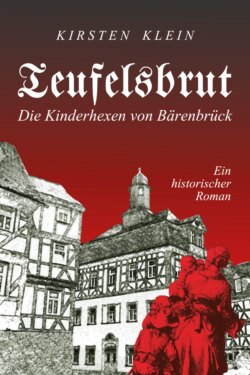Читать книгу Teufelsbrut - Kirsten Klein - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеDer letzte lange Winterabend war verstrichen, doch die Geschichten am Kamin blieben unvergessen. Laue Frühlingswinde fegten durch Türen und Fenster, löschten das Feuer und trieben die erstarrten Glieder zur Geschäftigkeit an. Meist allein saß die Großmutter auf ihrem Stuhl in der Ecke und bewegte lautlos die Lippen. Bei ihr verlor der Frühling Jahr um Jahr mehr an Macht. Längst hatte sich der Altersfrost in ihre Gelenke eingenistet und wollte auch den Sommer über nicht mehr weichen. Nur Marie, die noch nicht recht im Hause mithelfen konnte, hockte oft zu ihren Füßen auf dem Schemel und konnte sich nicht satt hören. Sie wusste längst jedes Wort, das der Großmutter über die Lippen kommen würde und erzählte manchmal leise mit. Die Greisin wusste das nicht, denn ihre Ohren hörten das Feuer nur noch Kraft der Erinnerung, und Gesichter wurden zu einander immer ähnlicheren hellen Flächen, von denen sich Augen und Lippen nur unscharf abhoben.
Wenn Marie aber ungelenk den Besen ergriff, sich über den Stiel wie auf ein Steckenpferd schwang und durch die Stube galoppierte, dabei das Reisig über den Boden schleifte und Staubwolken aufwirbelte, wiegte die Großmutter mahnend den Kopf, und ihre Lippen zitterten. Entriss dann die Magd dem Kind das Gerät und jagte es schimpfend hinaus, so beruhigte sich die Großmutter.
Meistens lagen die Greisenhände ineinander gefaltet im Schoß, denn sie taugten fast nur noch zum Gottesdienst. Der, so fand sie, war in diesem Hause am nötigsten. Auch unablässige Buße hatte allerdings nicht verhindert, dass ihre Tochter nach Maries Geburt gestorben war, obwohl alles so leicht vonstatten ging, verdächtig leicht. Eiligst war Marie getauft worden, und es erschien wie ein Wunder, dass Gott dieses gebrechlich wirkende Geschöpf am Leben erhalten hatte. Sicher hatte er noch Wichtiges mit ihr vor. Die Großmutter war fest überzeugt davon und wachte mit inbrünstigen Gebeten über sie seit ihrem ersten Atemzug.
Aber das einst so zarte Kind entwickelte eine ungeahnt kräftige Natur. Solange sie erzählte, konnte die Großmutter Maries wildes Wesen zu Ruhe und Andacht anhalten, doch mit dem letzten Wort schien der Bann zu reißen. Die Schilderungen weckten stärker die Neugier des Kindes als seine für so notwendig erachtete Furcht. Kein Zweifel – der Teufel wollte sich der Kleinen bemächtigen.
Warme Frühlingswinde hatten die Winterkälte ausnehmend stürmisch verjagt und bereits in den ersten Märztagen des Jahres 1669 überall noch ruhendes Leben aufgescheucht.
Entgegen dem Rat der Großmutter, das Kind besser noch unter häuslicher Kontrolle zu behalten, musste sich Marie im fünften März ihres Lebens mit zwei Zicklein bei Sonnenaufgang erstmals den zur Weide ziehenden Kindern anschließen.
„Die anderen werden schon Acht geben“, meinte der Vater zur leise in sich hinein murrenden Alten, womit für den wortkargen Mann alles dazu gesagt war. Seitdem er seine eigene Frau begraben musste, war er noch stiller geworden – fast so still wie die Toten auf dem Gottesacker, meinten die Leute. Keine hatte bisher seine zweite Frau werden wollen, und allmählich begann mit der Hoffnung auf einen Erben auch er selbst dahin zu sterben. Irgendwann, so tuschelte man hinter vorgehaltenen Händen, würde er sich wohl einfach selbst sein Grab schaufeln und nicht mehr zurückkehren.
Mit einer Weidenrute trieb Marie die beiden Zicklein aus dem Stall und zur Umfriedung hinaus. Barbara Bickler, die flussabwärts wohnte, hatte das Kind von weitem bemerkt, war vom Hirtenweg ab die Kreuzgasse zum Schaffnerhaus entlang gelaufen und hatte das Gatter bereits geöffnet. Marie verzog das Gesicht. „Das hab’ ich selber machen wollen!“, schrie sie und trieb die Zicklein, wild mit der Rute fuchtelnd, die leicht ansteigende Kreuzgasse hinauf.
„Siehst fast aus wie unser Bock“, lachte Barbaras jüngerer Bruder Michael, der mit dem anderen Vieh auf dem Hirtenweg, nahe der südlichen Stadtmauer, gewartet hatte. „Fehlen nur noch die Hörner, aber vielleicht sieht man sie nur nicht.“ Martin Heiliger, zwölf und fast einen Kopf kleiner als Michael, lachte zaghaft mit, was ihm den Spott des Älteren eintrug. „Und du hörst dich an wie unser Bock.“
Verschämt verstummte Martin und blickte sich um. Obwohl Michael laut gesprochen hatte, schienen andere Kinder es nicht mitgekriegt zu haben, waren noch zu weit entfernt.
Maries runde Stirn glühte trotzigrot, als sie vergeblich versuchte, ihre beiden von den anderen Ziegen und Schafen abzutrennen. Durch Michaels erneutes Gelächter in diesem Bemühen erst recht angefeuert, rannte sie in inmitten der Herde den Hirtenweg flussaufwärts, an der Stadtmauer entlang. Rechter Hand drängten sich Lehm- und Fachwerkbauten aneinander, immer schiefer und dichter, immer mühsamer geteilt vom Gassengewirr, je näher Bärenbrücks ältester Stadtteil rückte. Kinder, Haus für Haus ärmlicher, in Kleidern, zusammengeflickt wie Gemäuer und Fensterläden, trieben ihr Vieh aus engen Seitengässchen hinaus zum Weideweg und schlossen sich den anderen an. Mit armseligen Glöckchen im Dachstuhl erhob sich der Turm der Spitalkirche über die umstehenden Dächer. Im Vorbeigehen warfen die Kinder flüchtige Blicke durch die Seitengassen zum Spitalplatz, aus ihrem Gedankentrott gerissen von den Rufen der Stadtarmen und durchziehenden Bettler. Die äußere Stadtmauer beschrieb einen Bogen und zwang die Hirten näher heran. Hier war die Glutach noch schlank und verschwand fast zwischen den inneren Mauern, die sie säumten.
Das nordwestliche Ufer stieg nach einer schmalen Häuserzeile steil an und hob sich vom alten Stadtteil ab mit versetzt gebauten Patrizierpalästen, zwischen denen sich paradiesisch anmutende Gärten erstreckten. Dahinter, jenseits der äußeren nördlichen Stadtmauer, schienen Weinberge bis an den jetzt wolkenlosen Himmel heranzureichen und ließen ihre Reben von der Märzsonne verwöhnen.
Mühsam hielten die Kinder das hungrige Vieh auf dem eingetretenen Hirtenweg, bis sie die letzten Häuser im Rücken hatten, an der Rennermühle vorbei waren und das nordwestliche Stadttor passierten. Von hier an wand sich die Glutach in immer engeren Schleifen. Wenn das Gras erst höher spross, würde es scheinen, als wüchsen beide Weidehälften ein paar hundert Fuß weiter am Waldsaum zusammen. Von dort an ließ sich die Glutach zwischen dunklem Nadelgehölz bis zu ihrem Ursprungsquell verfolgen. Halbwüchsigen Burschen galt es manchmal als Mutprobe, allein im Bärenwald zu verschwinden und nicht ohne stattliche Beute zurückzukehren. Meistens handelte es sich dabei um einen Eichelhäher oder ein Wiesel. Doch konnte man unter Umständen leicht selbst im Bärenwald zur Beute werden. Über Generationen hinweg überlieferte sich, dass einst – wann, wusste niemand mehr genau zu sagen – ein Hütebub seine Schafe zu nah an den Wald herangeführt und dadurch einen neugierigen Braunbären angelockt haben sollte. Tapfer habe er seine Herde verteidigen wollen, sei aber von dem Untier ergriffen und in den Wald geschleppt worden. Später habe man nur noch seine Gürtelschnalle gefunden und den Eltern zum Andenken gebracht.
Mit der Zeit wurde diese Geschichte zur Legende. Zuletzt erzählte man sich, unter der weißen Herde wäre ein schwarzes Schaf gewesen, das den Buben zum Wald gelockt hätte, denn unter seinem Fell steckte der Teufel. Seitdem vermied es, wer konnte, seine Kinder mit einem schwarzen Schaf zu diesem Weidegrund zu schicken.
Die jungen Viehhirten packten ihre getrockneten Hirsefladen aus, schöpften mit Holzbechern Wasser aus der Glutach und hockten sich am Uferrand ins Gras oder auf herumliegende Steine. Ziegen und Schafe stillten ihren Durst und begannen gemächlich zu grasen.
„Marieles Ziegen sind genauso zickig wie sie.“ Grinsend beobachtete Michael, wie eine der Braun-weiß-gescheckten mit gesenktem Kopf ein Schaf von einem frischgrün sprießenden Grasflecken wegstieß.
Barbara warf der Kleinen einen mahnenden Blick zu. „Das Mariele weiß schon, dass es sich nicht so benehmen darf wie das dumme Vieh, nicht wahr, Mariele?“
Das Kind schützte einen vollen Mund vor und nickte, ohne Barbara anzusehen. Der fast Erwachsenen oblag die unausgesprochene Pflicht, nicht allein auf ihre vierbeinigen Schäfchen zu achten. Seit den ersten Weidetagen dieses Jahres fiel ihr auf, dass die zehnjährige Anna Wagner dauernd ihre Nähe suchte. Auch jetzt saß sie wie zufällig neben ihr und rieb das feine Blondhaar an ihrer Schulter, eifersüchtig beäugt von Martin, der sich sehnsuchtsvoll an Annas Stelle wünschte. Doch seit einiger Zeit verwehrte ihm Barbara eine solche Nähe, zumindest in der Öffentlichkeit.
„Ist ja nicht dumm vom Vieh, wenn es sich durchsetzt“, gab Michael zu bedenken.
Barbara seufzte. „Von uns Menschen verlangt Gott, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen.“
Michael zückte das Messer an seinem Gürtel und schnitzte an seiner Weidenrute herum. „Ich hab’ schon viele gesehen, die sich nicht gottgefällig benommen haben und dafür sogar belohnt worden sind.“
„Der Herr Pfarrer sagt, dass unser Herrgott dem Bösen absichtlich so viel Macht lässt, weil er uns dadurch prüfen will.“
„So, sagt er das?“ Nicht nur Michael wunderte sich über Annas Worte. Bisher sprach sie nur, was unbedingt nötig war.
„Sicher Michel“, bestätigte Barbara, die sich über den Hochmut in des Bruders Stimme ärgerte. „Du hättest es eigentlich auch hören müssen, oder hast du in der Schule geschlafen?
Der Junge sprang auf und trieb mit der Rute zwei Schafe auseinander, die sich friedlich beknabberten.
„Ich hab’ es gehört“, behauptete Marie.
Michael wollte gerade noch mal zuschlagen, hielt in der Bewegung inne und lachte. „Du? Du gehst doch noch gar nicht zur Schule.“
Barbara strich der abwehrenden Marie über das Haar. „Ich weiß aber trotzdem, dass es so ist“, beharrte das Kind, „und noch viel mehr weiß ich. Wenn ich Großmutters Zaubersalbe dabei hätte, würde ich die Gerte damit einreiben und ordentlich zuhauen. Dann wollten sich Ziegen und Schafe gleich miteinander vertragen. Mit der Zaubersalbe kann man aber noch viel mehr anfangen. Die Großmutter reibt nachts immer den Besenstiel damit ein, bevor wir ausfliegen.“
Die Worte purzelten aus ihrem Mund und überschlugen sich, als Marie erzählte, wie die Großmutter sie oft in der Nacht wecke und in die Stube hinunterführe. Dort stünde schon der Besen über dem Boden in der Luft und warte. Die Fensterläden seien weit aufgerissen, und der volle Mond leuchte silbern herein. Dann sausten sie auf dem Besenstiel durch das Fenster, auf den Mond zu. Die Haare flatterten im Wind, und die Großmutter hinter ihr lache immer lauter. Bald landete der Besen hier.
Maries Augen schweiften über die Wiese. Michael öffnete den Mund, um gegen ihr Geplapper anzusprechen, aber irgendetwas ließ ihn innehalten. Zu seinem eigenen Erstaunen lauschte er gebannt den Worten der Kleinen – er, der sich mit seinen vierzehn Jahren endlich den anderen Knaben bei ihren Zusammenkünften anschließen durfte.
Die unerwartete Aufmerksamkeit bestärkte Marie. Ein lustiges Treiben sei hier gewesen, ereiferte sie sich, viele Leut’ – so viele, dass man die Wiese nicht mehr gesehen habe.
„Leute?“ Barbara zögerte. „Aus Bärenbrück?“
Marie nickte und plapperte weiter. Die Schustersfrau habe sie gesehen und den Lukas, der in der alten Stadt wohne, ganz nah am Fluss – und noch viele andere. Getanzt hätten sie alle, um ein großes Feuer herum, worin Fleisch am Spieß gebraten worden sei.
Das Kind sprang auf und tanzte über die Wiese. Alle sahen ihm zu. Auch Schafe und Ziegen hoben die Köpfe.
Anna drückte sich an Barbaras Seite und erschrak, als sie spürte, wie selbst die Neunzehnjährige zitterte. „Mich fröstelt“, meinte sie, rieb sich die Arme und bedachte Anna mit einem entschuldigenden Blick. „Es ist eben noch recht frisch hier draußen.“
Anna nickte scheu. Als Barbaras Augen unversehens Martins begegneten, wandte sie sich abrupt ab und fröstelte nur noch mehr, fragte sich, was ihr solch einen Schrecken einjagte. Es war nicht allein jene seit einiger Zeit stets gegenwärtige Verlorenheit im Blick des Jungen. Da war noch etwas anderes. Aber ehe Barbara darüber nachdenken konnte, erforderte wieder Marie ihre Aufmerksamkeit. Die Kleine erstarrte in tänzerischer Pose, als sei ihr etwas Wichtiges eingefallen, und deutete auf den Fluss. „Da bin ich getauft worden – genau da!“, rief sie aus. „Aber das Wasser war ganz rot.“
„Das hast du einmal so gesehen, als die Sonne untergegangen ist und sich im Wasser gespiegelt hat“, meinte Barbara beschwichtigend.
„Nein, es war blutig.“ Marie duldete keinen Widerspruch. „Meine Großmutter hat mich dem Teufel vorgestellt. Der hat mich geritzt und mit meinem Blut getauft.“
Wie sollte dieses ahnungslose Ding auf dergleichen kommen – wenn es nicht so gewesen war? „Und – hast du dem Heiland abschwören müssen?“ Michaels Stimme fieberte.
Marie schüttelte gelassen den Kopf. „Nein, das hab’ ich nicht getan. Dafür bin ich noch nicht verständig genug, hat meine Großmutter gemeint.“
„Dann ist es noch nicht zu spät für dich – vielleicht.“ Barbara sah den Kindern an, dass ihre Worte verrieten, wie ernst sie Maries Geschichten nahm. „Ach was, das hast du dir doch alles nur zusammengesponnen“, fügte sie schnell hinzu. „Erzähl’ niemandem mehr davon, hörst du? Und lustig kann das schon gar nicht gewesen sein.“
Marie spürte die verhohlene Neugier der Großen. „Oh doch, doch, furchtbar lustig war’s. So viel Freud’ darf ich sonst nie haben.“
„Wenn es so lustig ist, will ich auch mal dabei sein. Ich erzähle es keinem.“
Barbara fuhr ihrem Bruder über den Mund. „Michel, hör’ nur, was du da sagst.“
„Du hast mir nichts zu sagen“, wies der Junge seine Schwester zurecht. „Mir können sie so leicht nichts anhaben. Dir würde ich es freilich nicht raten.“
„Michel“, wiederholte Barbara, „auch wenn du schon vierzehn bist und die anderen Knaben dich aufgenommen haben – das Böse soll man nicht herausfordern. Dem kann auch ein ausgewachsenes Mannsbild anheim fallen.“
„Ich werd’ ihm standhalten.“
Barbara erschrak über die Entschlossenheit in Michaels Stimme und bereute, dass sie offensichtlich seine aufkeimende Mannesehre angegriffen hatte. Nun musste er erst recht darauf bestehen und durfte sich vor den Mädchen, besonders vor der erst Fünfjährigen, keine Blöße geben. Insgeheim beschloss Barbara, zu Haus nochmals auf ihn einzuwirken.
„Wirst schon sehen“, sprach Michael in ihre Gedanken hinein, „wie ich mit dem Teufel umspringe.“ Dabei rannte er auf einen Ziegenbock zu, fasste ihn an den Hörnern und zerrte ihn im Kreis herum.
Barbara entzog sich seinem Blick, der Zustimmung heischte, und sah zum Frühlingshimmel. So hell, so klar leuchtete er – jetzt, nachdem der Winter hoffentlich vertrieben war. Lautlos sandte sie ein Stoßgebet hinauf.
Die Hütekinder auf der anderen Seite mieden das direkte Ufer, denn angeblich hatte die Glutach bisher nur unter ihnen Opfer gefordert. Kaum einer glaubte dabei an einen Zufall, zumal Ermittlungen ergeben hatten, dass Unglücksfällen stets Streitigkeiten zwischen Kindern beider Seiten vorausgegangen waren. Obendrein lag das Judengässle im alten Stadtteil, auf südwestlicher Seite. Sogar Erwachsene gingen nicht nah am Ufer entlang, obwohl Kinder beliebtere Opfer böser Wünsche waren und deshalb öfter ertranken – nach allgemeiner Überzeugung. Nordwestlich verlief die Mauer ohne Tor, und erst innerhalb der Stadt, östlich der Spitalkirche, führte der schmale Fischersteg zum anderen Ufer hinüber.
So blieb dem von Osten kommenden Besucher oder Durchreisenden der Weg durch die Armut nicht erspart, es sei denn, er schlug einen Bogen zum nördlichen Tor. Dann konnte er durch die Weinberge spazieren, den Duft frischen Grüns atmen und seinen Durst auf den Rebensaft anregen. Wem die Wahl blieb, seine Tageszeit dermaßen lustwandelnd zu verbringen, der gehörte sowieso auf die Sonnenseite.
Gottlob Lammer war auf der Sonnenseite ansässig, zwischen den Palästen der Patrizier. Auch er sah oft auf die Bewohner der armseligen Häuserzeile am nördlichen Ufer der Glutach herab, die immerhin im Schatten der patrizischen Anwesen lag – allerdings hauptsächlich von der Kanzel aus. Pfarrer Lammer war davon überzeugt, dass vor allem diese Menschen, wie jene auf der anderen Seite, obrigkeitlicher Aufsicht bedurften und unter ihnen wiederum in besonderem Maße die Kinder, welche noch schwach und formbar waren, also begehrte Objekte des Teufels. In diesem Bewusstsein hatte Lammer bereits kurz nach seinem Amtsantritt vor knapp zwanzig Jahren den ehemaligen Kornspeicher am Fuße des Pfarrhauses zu einer Elementarschule umbauen lassen. Das hatte sein Durchsetzungsvermögen hart gefordert, waren doch die Einschnitte des erst ein Jahr zuvor beendeten Krieges in Bärenbrück wie überall sonst tief und nur allmählich zu heilen. Die Leute konnten sich nicht für die Schule begeistern, denn dann mussten sie ja täglich mehrere Stunden die Mitarbeit ihrer Kinder entbehren. Natürlich wollte jeder mithelfen, die Kleinen zu gottesfürchtigen Christen zu erziehen, was laut Lammer nur werden konnte, wer den Katechismus fleißig lesen und auswendig aufsagen lernte. Außerdem hatten viele noch miterlebt, was einer Stadt drohte, wenn das Böse in ihren Gassen erstmal Fuß gefasst hatte und nach dem griff, worin ihre Zukunft lag – nach den Kindern.
Wo also einst Heu und Feldfrüchte lagerten, beschloss Lammer, künftig in Gottes Sinne menschlichen Geist und Seele unter seinen Augen reifen zu lassen.
Zuerst unterrichtete Gottlob Lammer selbst, doch als verantwortungsbewusster Hirte durfte er sich nicht nur den Lämmern seiner Herde widmen. Bei den Knaben vertrat ihn inzwischen fast ständig Johannes Kurzhals, ein etwas zur Melancholie neigender, aber tüchtiger junger Gelehrter. Zur Unterrichtung der Mädchen lenkte Gott Lammers Augenmerk bald auf Reinhild Rotnagel, eine patrizische Jungfer, die durch ihre fast unweibische Gelehrsamkeit einen zweifelhaften Ruhm errungen hatte und dem Heiratsalter entronnen war. Was jedem möglichen Heiratswilligen zu suspekt war, erschien Lammer einer Herde Schulkinder gerade angemessen.
Jungfer Rotnagel fügte sich in das Lehramt, und über die Jahrzehnte hinweg hatte sich kaum etwas in Bärenbrücks Elementarschule verändert, einschließlich des Kampfes, den Lammer um jeden Schultag mit den Eltern führen musste. Er begann auch in diesem Frühling, sobald das Vieh wieder auf die Weide durfte und die Felder bestellt werden mussten.
An einem Märzmorgen stand Gottlob Lammer vor dem Portal seines Hauses und sah den Schulberg hinab. Der Ärger glomm noch in seinen Augen, grub sich in die verkniffenen Mundwinkel und erschreckte einige Kinder, die gerade den Schulberg heraufkeuchten, weil sie so spät dran waren, erst noch das Vieh füttern oder den Stall ausmisten halfen. Ein artiger Gruß entrang sich ihren atemlosen Mündern, ehe sie im Schlund des Schulhauses verschwanden. An immerwährendes Schuldigsein gewöhnt, ahnten sie nicht, dass Lammers Ärger eigentlich nicht ihnen galt.
Wie die Vergangenheit gelehrt hatte, musste ein Gottesdiener in Bärenbrück Augen und Ohren überall haben. Zusätzlich bediente sich Lammer fremder Sinnesorgane. Die der Kinder waren mitunter am schärfsten, dazu meistens noch rein und unverlogen – allen voran die des eigenen Sohnes, wie Lammer glaubte. Da er ohnehin in seines Vaters Schuhe hineinwachsen musste, sollte Heinrich Lammer jetzt schon Aug und Ohr für seine künftige Aufgabe schulen.
Heinrich war in den Schulraum für die Knaben gegangen, noch bevor sein Vater ihn fragen konnte, ob er die Anna Wagner gesehen habe. Jungfer Rotnagel war nämlich aufgefallen, dass das Mädchen plötzlich nicht einmal mehr die ersten Fragen des Katechismus flüssig aufsagen konnte und auch sonst irgendwie verändert schien. Seit drei Tagen war sie der Schule fern geblieben, wahrscheinlich zum Hüten geschickt worden, wie so viele andere Kinder. Lammer beunruhigte, dass Anna nahe der Gasse wohnte, wo sich das Unheil einst zuerst eingenistet hatte. Ihre womöglich bereits angegriffene Seele konnte nun draußen, außerhalb der behütenden Stadtmauer, noch empfänglicher sein für das immer lauernde Verderben.
Lammer hörte das vielstimmige Morgengebet durch die Mauern dringen und schritt den Schulberg hinab. Nur wer seinen üblichen Gang genauestens kannte, hätte seine kaum verhohlene Eile bemerkt. An der Kirche, kurz oberhalb des Marktplatzes, mündete der Schulberg in das Neue Kirchgässle, welches nur durch ein paar gutbürgerliche Bauten vom Zentrum der Stadt getrennt wurde. Als Lammer der Gasse ein Stück flussabwärts der Glutach folgte, fiel sein Blick auf das linkerhand etwas versetzt hinter dem Kaufhaus stehende Gasthaus zum Ochsen. Lammer schweifte ab und warf ihm dann einen zweiten, einen missbilligenden Blick zu, der an dem jetzt unbelebt wirkenden Gebäude abprallte. Wurde der Wagner Hannes dort in letzter Zeit nicht beinahe allabendlich gesehen, in wenig rühmlichem Zustand, und vernachlässigte er etwa seine hausväterlichen Pflichten?
Bestärkt in seinem Vorhaben, schritt Lammer aus, überquerte nach dem kurzen Abschnitt der in den Marktplatz mündenden Büßergasse die Täuferbrücke und folgte am anderen Flussufer weiter der Büßergasse, bis sie auf das Alte Kirchgässle stieß. Nur wenige Fuß weit wieder flussaufwärts musste er nun zwischen bescheiden sich ihm zuneigenden Anwesen zurücklegen. Schon als das Rauschen der Glutach hinter seinem Rücken verebbte, glaubte er fern in noch frühmorgendlicher Stille den hellen Klang des Schmiedehammers zu vernehmen. Lammer wandte den Kopf nach links, woher das Geräusch kam, das ihn mit jedem Schritt einsilbiger anmutete.
Das unentwegte Weiterhämmern teilte Lammer mit, dass Wagner ihn nicht kommen sah, obwohl die Schmiede nach Osten hin lag. Wie ertappt, hob der Schmied den Kopf, sprang von seinem Schemel auf und strich sich das verklebte Haar aus der Stirn, als der Geistliche vor ihm stand. „Gott zum Gruß, Herr Pfarrer – so früh hier bei mir?“
Lammer ließ seinen Blick über die schweißglänzenden, muskelgestählten Arme gleiten. „Wie ich sehe, Meister Wagner, seid auch Ihr schon fleißig bei der Arbeit.“
Wagner reckte den Hals und blinzelte in die Sonne. „Meine Arbeit beginnt, sobald mir der Herr genug Licht dazu schickt.“
Lammer nickte. „So ist es recht, Meister Wagner, wider den Müßiggang.“
„Ja, ja“, brummte Wagner und kratzte sich überlegend am Kopf. „Sie hat schon viel Kraft für die Jahreszeit“, plauderte Lammer betont harmlos weiter und sah unverwandt in Wagners Augen, die jetzt glühten wie heißer Stahl. Den Pfarrer überraschte das unbestimmte Gefühl, als würde sich dahinter mehr verbergen als der gewöhnliche Respekt vor der Geistlichkeit. „Denkt Ihr auch daran, Eure Tochter zu ebensolch christlichem Verhalten zu erziehen?“
„Ja, ja – die Sonne hat viel Kraft“, plapperte Wagner nach.
Lammer sah sich um, als suche er etwas. „Eure Tochter, habt Ihr sie auf die Weide geschickt?“
„Die Anna?“
Lammer lächelte. „Habt Ihr noch andere Töchter?“
Wagner schüttelte den Kopf. „Ich weiß schon, Ihr kommt wegen der Schule.“
Lammer nickte gnädig, wie ein Lehrer, dessen etwas begriffsstutziger Schüler endlich die richtige Antwort gab.
„Ich brauche sie dringend zum Hüten“, versuchte sich Wagner zu rechtfertigen. „Außerdem – als Mädchen...“
„Ihr wisst, wie wichtig es gerade für ein Mädchen ist, den Katechismus gut zu kennen?“
Der breitschultrige Mann nickte gehorsam und schien ein wenig zu schrumpfen. „Ja, ich hab’ gedacht, das würde sie wohl schon alles wissen, was für sie wichtig ist.“
Lammer ließ sich Zeit mit seiner Erwiderung. „Nun, es sah auch so aus, aber...“ Er hielt inne und wartete ab, bis die Unruhe in Wagners Blick sich noch steigerte. „Bitte redet doch weiter, Herr Pfarrer“, bettelte er endlich. „Was hat sie gesagt – ich meine, hat sie irgendwas gesagt?“
‚Was sollte sie wohl gesagt haben?’, dachte Lammer. „Eben nicht, sie stottert neuerdings sogar oder gibt es vor – vielleicht, weil sie verbergen will, dass sie nicht gelernt hat. So jedenfalls vermutete es meine getreue Jungfer Rotnagel. Allein dieser Tatbestand – sollte er sich bestätigen , wäre bereits höchst bedenklich.“
Lammer hielt in seiner Rede inne und gewahrte erstaunt, wie Wagner in seine äußere Statur zurückzufinden schien. „Stottern hab’ ich sie zu Hause noch nicht hören, Herr Pfarrer. Sie ist meist sehr still, ja, ein stilles Ding, meine Anna. Ist doch besser für ein Mädchen, als wenn es so vorlaut ist.“
„Aber sie antwortet brav und flüssig auf alles, was man sie fragt?“, hakte Lammer so geschwind ein, dass Wagner nahtlos anschloss: „Ja, ja, gewiss tut sie das.“
Lammer räusperte sich siegessicher. „Das spräche dann allerdings dafür, dass sie in der Schule doch ihre Wissenslücken aus dem Katechismus verbergen will.“
Wagner sah zu Boden, auf die blanken Schuhe des Geistlichen, deren Spitzen unter dem schwarzen Gewand hervorlugten, nickte ergeben und blickte verwundert wieder auf, als der Pfarrer eine scheinbar harmlose Frage stellte. „Versteht Eure Anna gut mit dem Vieh umzugehen?“
Wagner nickte eifrig. „Ja, sehr gut. Es ist ja auch die Barbara dabei und passt mit auf.“
Lammer wiegte den Kopf. „So so, die Tochter der seligen Bicklerin.“
Verunsichert sah Wagner in Lammers Gesicht, das Bedenken ausdrückte. „Was meint Ihr damit, Herr Pfarrer?“
„Nichts, nichts.“ Lammer winkte ab. „Sie ruhe in Frieden.“
„Wenn Ihr das sagt...“, beruhigte sich Wagner.
„Davon abgesehen, Meister Wagner, der Mensch kommt vor dem Vieh. Also habt ein wachsames Auge auf Eure Tochter und schickt sie zur Schule.“
Während der Schmied noch beteuerte, dass er das tun wolle, hatte sich der Pfarrer abgewandt und vernahm fern hinter sich wieder das einsilbige Hämmern.
Nur gelegentlich, wo Seitengassen abgingen, war die Mauer diesseits der Glutach unterbrochen, als Zugang für Fischer und Wäscherinnen. So begleitete Lammer, von kurzen Einblicken abgesehen, allein das gleichförmige Rauschen des Wassers, als er das Alte Kirchgässle entlang flussaufwärts schritt. Menschen, an denen er vorbei kam, sahen flüchtig von ihrer Arbeit auf und grüßten ihn ebenso verwundert wie ehrfürchtig. Seltsam fremd fühlte er sich hier, beunruhigend fremd für einen, der die Leute gut genug kennen sollte, um Einfluss auf sie zu nehmen. Freilich blieb ihm der Knüppel kirchlicher Macht für alle Zweifelsfälle. Wer andere züchtigen konnte, ob mit Zunge oder Rute, stand notgedrungen abseits. Gottlob Lammer fühlte sich nicht nur allein, sondern einsam – im quälenden Bewusstsein, dass er dieses Empfinden nicht nur der Gegend hier zuschreiben konnte. Sein Haupt erhoben, den Blick stur geradeaus gerichtet, ließ er das nahe der Ufermauer erbaute Haus des Totengräbers Schaffner hinter sich, ging nun doch merklich schneller und überquerte die das Alte Kirchgässle wenige Fuß vor der Spitalkirche kreuzende Hirtengasse. Schließlich erwarteten ihn heute noch zahlreiche Aufgaben, zuerst eine Unterredung mit Spitalpfarrer Gernot Weiß.Das Alte Kirchgässle führte fast bis zum Chor, so dass Lammers weit wehendes Gewand im Vorbeieilen beinahe das schadhafte Gemäuer des Langhauses streifte. Ohne direkt hinzusehen, vernahm er die leisen Klagen der an der Chormauer angesiedelten Bettler. Es waren fast täglich andere, denn man duldete keinen lange in der Stadt, und doch glich die Armut sie zumindest äußerlich schnell einander an. Drinnen in der Kirche, während des Gottesdienstes, wenn die Worte seiner Predigt auch ihn tröstlich ablenkten, dazu noch das fahle Licht, ertrug Lammer die Gegenwart der Elenden leichter. Gewiss verlangte Gott ihm ab, auch hinter ihrem faulen Atem und unter ihrer Haut, die schmutzigem Teig ähnelte, zudem noch mangelhaft verdeckt war von nicht mehr zu flickenden Lumpen, edle Abbilder seiner selbst zu erkennen. Doch es war – weiß Gott –, immer wieder eine der schwierigsten Prüfungen. Am wenigsten widerten ihn verelendete Kinder an, deren Seelen er vor allem nähren wollte, für die er sich mitunter vehement einsetzte. Nicht zuletzt hatte Gottlob Lammer seine Elementarschule gerade für solche Kinder gegründet. Wenn man ihre geistliche Speisung vernachlässige – darin war er sich mit dem Spitalspfarrer einig –, könne man sie gleich dem Bösen zum Fraß vorwerfen.
Lammer überquerte den ehemaligen Marktplatz Bärenbrücks wobei seine Gedankengänge ständig von Leuten durchkreuzt wurden, die ihn ehrfurchtsvoll grüßten und sich insgeheim fragten, was den Herrn Pfarrer wohl heute morgen in dieses armselige Viertel führte.
Aus einer der Seitengassen, die wie düstere Strahlen vom Platz wegführten, schlich ein Junge in zerlumpter Hose an einem Haus entlang. Wenn er sich nicht so auffallend darum bemüht hätte, unbemerkt zu bleiben, sobald er den Pfarrer gewahrte, wäre er ihm wahrscheinlich entgangen. Als Lammer jetzt auf ihn zueilte, blieb er stehen und starrte gegen das Fachwerk, als wollte er ein Loch hineinbohren.
Lammer fasste ihn unter dem Kinn und drehte sein Gesicht zu sich her. „Wie heißt du? Bist du nicht einer von meinen Schülern?“
„Ja, Herr Pfarrer.“
„Sprich lauter, ich kann dich nicht verstehen“, gebot Lammer scharf.
„Ja, ich bin Lukas, einer Eurer Schüler.“
Lammer nickte zufrieden. „Und warum bist du nicht in der Schule?“
Die Frage klang freundlich, aber solcher Freundlichkeit war nicht zu trauen. „Weil – meine Mutter ist krank, Herr Pfarrer. Ich hab’ was für sie besorgen müssen.“
„Ach, so ist das.“ Lammer hielt die Hand auf. „Zeige mir doch einmal, was du für sie besorgt hast.“
Lukas kramte umständlich in den Taschen seiner zerlumpten Hose. „Medizin, Herr Pfarrer – ach bitte, lasst mich gehen. Meine Mutter wartet, ihr ist so übel.“
„So zeige mir geschwind die Medizin, Lukas.“
Als für einen Augenblick das Sonnenlicht sein bleiches Gesicht beleuchtete, sah der Pfarrer, dass Lukas selbst nicht gesund sein konnte. Er zog seine Hand aus der Hosentasche, umklammerte etwas darin, als sei es ein Heiligtum und streckte die dürren Finger aus. „Sie sagt, sie bräuchte das unbedingt“, erklärte er schnell. Es klang wie eine Entschuldigung.
Lammers Stimme schnitt ihm wie ein Schwert in die Ohren. „So, das braucht sie also. Wie kann sie es wagen, dir so etwas abzuverlangen?“ Lammers Stimme wurde milder. Er strich dem erschrockenen Jungen sogar über den Kopf. „Du hast also nicht gelogen. Deine Mutter ist wirklich krank. Aber das da wird ihr nicht helfen.“ Mit spitzen Fingern ergriff er das Amulett auf Lukas’ Hand, welches die Pfeilmarter des heiligen Sebastian darstellte, und ließ es zwischen den Falten seines Gewandes verschwinden. „Das ist Götzenanbetung, Lukas. Wer hat es dir gegeben?“
„Eine Frau. Ich kenne sie nicht. Meine Mutter – sie hat im Fieber gesprochen und den heiligen Sebastian um Fürbitte angefleht. Da hab’ ich... Ich hab’ doch solche Angst, dass sie stirbt.“
„Da hast du jemanden gesucht, der dich mit abergläubischem Tand bedienen konnte.“
Lukas war so verstört, dass Lammer ihn an den Schultern rütteln musste, ehe er auf weitere Fragen antworten konnte. „Wo finde ich dieses Weib?“
Lukas wandte sich um und deutete in die Gasse, von woher er gekommen war. „Da hinten.“
Lammer folgte dem ausgestreckten Zeigefinger. „Bete mit deiner Mutter zu Jesus Christus“, gebot er Lukas und war im nächsten Moment in der Gasse verschwunden.
Während er durch die Düsternis eilte, die hier vorherrschte und kaum einen Sonnenstrahl einließ, warf er Blicke in Ehgräben und die schrägen Mauern hinauf. Nicht länger sollte unreiner Aberglauben hier Zuflucht finden. Es stank vom muffigen Gemäuer herab. Abgestandener Urin rann träge aus den Ehgräben. Lammer war fest entschlossen, dem Lauf des Bösen, das sich ihm in Gestalt eines Weibes zu entziehen trachtete, Einhalt zu gebieten. Hinter der nächsten Ecke konnte es sich verkrochen haben, in der nächsten noch engeren Seitengasse. Der Pfarrer hetzte durch das Viertel, glaubte, das Schnaufen jenes Weibes zu vernehmen, musste endlich innehalten und sich eingestehen, dass er seinen eigenen Atem rasseln hörte.
Sie war fort, hatte nur den Gestank zurückgelassen. Erst jetzt, zum tiefen Einatmen gezwungen, nahm Lammer ihn auf, hastete in den nächsten Ehgraben und übergab sich. Hinter irgendeiner dieser schäbigen Mauerkrusten lachte ein Kind. Lammer klang es wie Spott in den Ohren. Die Lippen noch unrein, hob er den Kopf, blickte umher wie ein Verirrter. Erst allmählich, als das Lachen verklungen war, fand er in seine ehrwürdige Haltung zurück und besann sich auf das, was ihn ursprünglich hierher geführt hatte, seine Besprechung mit dem Spitalpfarrer. Spontan beschloss er, die Rede dabei unbedingt auf den Kampf gegen den Aberglauben zu bringen.
Die junge Frau stand dem Spital am nächsten vor der Ufermauer, neben sich die anderen Fischweiber, und sah über die noch zappelnden Leiber hinweg durch die farblose Masse schlicht gekleideter Begutachterinnen Lammers schlanken Schatten aus der Seitengasse heraustreten. Augenblicklich mäßigte sie ihre Stimme, pries fast flüsternd ihre Ware an. „Fische, frische Fische.“
Frauen, die eben noch ihre Nase darüber rümpften, schauten auf. Alle grüßten zum Herrn Pfarrer hinüber und überlegten, was ihn wohl hergeführt hatte, wie auch Lina, die junge Fischverkäuferin. Ihre Schwester Alrune wohnte in jener Seitengasse, die ein Herr wie Pfarrer Lammer nicht ohne triftigen Grund betreten würde. Noch bevor sie sah, wohin er ging, verlor sie ihn aus den Augen und fuhr damit fort, ihre Ware anzupreisen. „Fische, frische Fische, Fische...“
„Ja, ja, er ist frisch, wenn er auch riecht wie aus dem Ehgraben gefischt. Nun sagt schon, was wollt Ihr dafür?“
Die junge Frau verstummte, sah sich von einem Gesicht bedrängt, während die übrigen Verkäuferinnen das mit dem Geistlichen eingekehrte leise Gemurmel überschrien und eine die andere zu übertrumpfen suchte. Vertraute Worte für die junge Frau, die sie selbst allwöchentlich hier gebrauchte, aber plötzlich gerieten sie in ihrem Kopf durcheinander.
Was hatte der Pfarrer dort gesucht, wo sie wohnte? Sie sah sich um – überall aufgerissene Münder, scheinbar auf sie gerichtet. „Fisch, Fisch – frischer Fisch!“, schrie sie und überschrie die anderen, bis sie nur noch sich selbst hörte.
Sanft strich Gernot Weiß über die von harter Arbeit gezeichneten und an den Fingergelenken knotig verdickten Hände der Pfründnerin. Dabei bemerkte er, wie ihr Zittern verebbte, ihr schmerzverzerrtes Gesicht sich allmählich entkrampfte und ihr Blick aus trüben Greisenaugen sich ihm voller Dankbarkeit zuwandte. „Ist schon recht so“, meinte er. „Das bisschen Ruhe habt Ihr Euch redlich verdient.“
Je nachdem, wie wohlhabend sie waren, verbrachten Pfründnerinnen ihren Lebensabend im Spital. Wem wie dieser Frau zur bescheidensten Unterkunft die Mittel fehlten, der konnte sich seine letzte Wohnstatt durch Krankenpflege erarbeiten. Etliche nutzten diese Möglichkeit, vornehmlich Witwen.
Ehe Gernots letztes Wort verklang, erzeugte ein Klopfen gegen die Tür erneuten Schrecken in der Greisin, erneutes Zittern ihrer Gliedmaßen. Wie bei einer Missetat ertappt, sah sich der junge Pfarrer seinem eintretenden Amtsbruder gegenüber und erwiderte dessen knappen Gruß. Unter Lammers scharfem Blick, empfand Gernot sich zu Rechtfertigungen genötigt und verachtete sich, weil es ihm nicht gelang, den unterwürfigen Ton aus seiner Stimme zu tilgen. Er habe die Frau aus dem gemeinschaftlichen Krankensaal nehmen müssen, für ein paar Stunden. Sie sei nervlich zermürbt und erhalte nur hier die nötige Ruhe. „Aber lasst uns doch bitte in meiner Amtsstube weiterreden“, fügte Gernot hastig hinzu, um wenigstens die ihm Anvertraute vor Lammers schneidender Stimme zu bewahren. Der verließ wortlos das winzige Zimmer, schritt über den Flur und ließ sich von seinem Amtsbruder in dessen Stube den bequemsten Stuhl anbieten, ohne sich jedoch zu setzen. Stattdessen hieß er Gernot Platz nehmen, stützte beide Hände auf das Pult und beugte sich über ihn. „Dieses Weib gehört ja wohl kaum zu jenen, die das Spital dafür gebührend entlohnen können!“
„Sie hat es sich redlich verdient, durch ihrer Hände harter Arbeit“, wagte Gernot einzuwenden und wollte weitere Rechtfertigungen folgen lassen, doch Lammer war zu sehr in Fahrt, um hinzuhören. „Wird sie denn nicht bereits für diese Arbeit entlohnt, indem sie hier kostenfrei wohnt?“
„Gewiss, aber...“ „Ihr widersprecht!“, unterbrach Lammer ihn abermals und drang mit seinem stechenden Blick noch penetranter auf ihn ein. „Wollt Ihr das Spital etwa ruinieren, indem Ihr Mittel an solche verschwendet, denen sie aufgrund ihres Standes überhaupt nicht zustehen? Wenn Ihr nicht einsichtig seid, sehe ich mich gezwungen, darüber Meldung zu erstatten!“
Unwillkürlich war Gernot mit seinem Stuhl zurückgerückt und hob nun beschwichtigend die Hände. „Nun haltet doch bitte einen Moment inne und lasst mich erklären“, bat er. „Ich wollte dieser Leidgeplagten lediglich ein paar Stunden Ruhe und Wärme gönnen. Da unten zieht es zuweilen schier unerträglich“, fuhr er so hastig fort, dass seine Worte sich überschlugen. „Sie ist doch nur noch Haut und Knochen, kann der Frühjahrskälte nichts entgegenbringen. Viel Zeit wird ihr ohnehin nicht mehr vergönnt sein.“
Lammer starrte den Jüngeren noch strenger an und schlug mit flacher Hand auf den Tisch. „Es ist wider Gesetz und Ordnung!“
„Ja, ja“, stimmte Gernot ergeben zu, um ihn sich endlich ein bisschen vom Leib halten zu können. „Nun setzt Euch doch bitte. Ihr habt natürlich recht.“
„Gut, wenn Ihr es endlich einseht“, meinte Lammer, fixierte sein Gegenüber aber noch geraume Weile, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, und ließ sich erst dann auf dem ihm angebotenen Stuhl nieder.
Gernot atmete insgeheim auf und wollte Lammer fragen, was ihn denn eigentlich zu ihm geführt habe, aber der kam ihm zuvor. „Es mehren sich bedenkliche Anzeichen für unlauteren Lebenswandel in Bärenbrück“, begann er und schilderte als jüngstes Beispiel seine Begegnung mit Lukas.
Gernot nickte seufzend. Ja, er kenne diesen Jungen. Seine Mutter habe im Spital gearbeitet und sich eine langwierige Erkältung zugezogen. „Ich wollte sie vom Bader behandeln lassen, aber sie hat noch ein Kleinkind und fürchtete, es könne sich hier eine noch schlimmere Erkrankung holen. Bitte übt Nachsicht mit Lukas. Sein Vater ist letztes Jahr gestorben und jetzt hängt alles an ihm. Ich werde mit ihm reden, damit er den Unterricht wieder besucht.“
Lammer nickte zwar, zog aber ein mürrisches Gesicht. „Und was ist mit diesem Weib, dieser Amulettverkäuferin? Gottloser Aberglaube droht sich in Bärenbrück auszubreiten!“
Obwohl es auch in seiner Amtsstube nicht gerade warm war, fühlte Gernot, wie sich in ihm ein Schweißausbruch anbahnte. „Gewiss“, begann er, mühsam beherrscht, konnte jedoch das Zittern in seiner Stimme kaum unterdrücken. „Ein paar alte Leute vermögen sich wohl noch immer nicht ganz davon zu lösen.“ Ehe seine Stimme völlig versagen konnte, kam Gernot eine rettende Eingebung zu Hilfe. „Man muss ihnen Zeit lassen, sie nicht vor den Kopf stoßen“, berief er sich auf einen Ausspruch Martin Luthers.
Lammer schüttelte den Kopf. „Das sagte er im vorigen Jahrhundert. Inzwischen wurde dem Volk mehr als genug Zeit gelassen, um die neue reine Lehre voll und ganz in sich aufzunehmen. Wer das immer noch nicht kann“, ereiferte er sich mit wieder anschwellender Stimme, sprang auf und schlug auf den Tisch, der wolle es einfach nicht, gehorche lieber dem Bösen und drohe auch seine Kinder zu verderben. „Niemals werde ich solches zulassen!“
Den Türgriff schon in der Hand, wandte sich Lammer zu seinem Amtsbruder um. „Und vergesst nicht, jene Pfründnerin wieder auf den ihr gebührenden Platz zu verweisen. Entlohnt für ihr hartes Erdenleben wird sie im Himmelreich. Euch steht das nicht zu!“
Selbst nachdem Lammer längst fort war, brauchte Gernot Weiß noch geraume Zeit, bis er in seinen üblichen Tagesrhythmus zurückfand. Sinnend verharrte er am Fenster und ließ seinen Blick über Bärenbrück schweifen, über die Weinberge hinweg bis hin zum nordwestlich gelegenen Hang. Das Erbe seiner früh verstorbenen Eltern hatte gerade mal die Kosten für sein Studium in Tübingen abgedeckt. Sogar sein Elternhaus war dabei draufgegangen. Also warum kehrte er überhaupt in seine Heimatstadt zurück?
Wie intensiv er auch in sich hineinhorchte – noch immer fand Gernot darauf keine Antwort, ließ schließlich seine Gedanken mit einem Vogel zum Himmel ziehen. Sehnsuchtsvoll folgte ihm sein Blick, bis er hinter den Weinbergen entschwand.
Die nächste Nacht, die sie den ganzen Tag über gefürchtet hatte, war hereingebrochen. Anna lag, umgeben vom Dunkel, in ihrer eng vom Mauerwerk begrenzten Schlafkammer – die Decke bis ans Kinn gezogen, verkratzt vom groben Wollstoff. Beide Hände hatte sie ineinander verkeilt, als drohte sie jemand voneinander zu lösen. Seitlich gekrümmt, die nackten Beine aneinandergepresst, so dass die Haut sich zusammenschweißen möge, zitterten ihre Lippen ein Gebet und flehten Gott an, seine Allmacht walten zu lassen. War sie dessen unwürdig, zu gering vielleicht? Dann möge er sie doch unsichtbar werden lassen, verbergen im Nichts – unauffindbar, unspürbar für sich selbst. Schlimmstenfalls möge sich sogar ihr Leib auflösen, nicht mehr der Sünde verfügbar sein.
Anna verwehrte sich das Atmen, das ihren Leib mit Leben füllte – und spürte ihn wieder, den Atem über sich. Sein Hauch bedeckte ihr Gesicht wie ein schmutzigfeuchtes Tuch.
Dann endlich ließ Anna alle körperliche Schwere unter sich zurück, stieg auf. Sie entstieg dem Dunst und sah auf ihn herab, auf ihren Leib – sah zu, was dort unten mit ihm geschah. Er gehörte ihr nicht mehr, war nur noch seelenloses Fleisch. Verlassen lag er auf seinem Laken, dargeboten zum Gebrauch, Anna fern und fremd. Sie fühlte nichts mehr, sah nur zu und wusste nicht einmal, was sie sah noch was sie hörte.
Doch es gab kein wirkliches Entrinnen für sie, denn sie musste zurückkehren in diesen Leib, den sie nicht verteidigt hatte – wie in ein beflecktes Kleid. Sie musste doch, auch wenn Gott ihr böse sein würde und der verleugnete Leib sich rächte. Sein Schmerz besaß wieder eine Stimme, schwieg nicht mehr, verklagte Annas untreue Seele. Hilflos steckte sie in diesem gemarterten Körper und musste die Klagerede über sich ergehen lassen. Sie wollte sich verteidigen, etwas sagen, doch sie fand kein einziges Wort. Mutter, wollte sie sagen – Mutter, hört mich an, steht mir bei. So glaubt mir doch, ich habe es nicht gewollt.
Aber Anna sah, dass die Mutter ihr nicht glaubte. Sie sah, wie das mütterliche Gesicht sich voller Verachtung dunkel färbte und zurückwich. Anna blieb allein auf der Anklagebank und hörte lauter denn zuvor die Klagerede auf ihr Haupt hernieder prasseln, gleich einem zornerfüllten Gewitterregen. Gott selbst klagte sie an, denn sie hatte dem Bösen nicht widerstanden. Aber Gott ließ Gnade vor Recht ergehen in seiner Güte, noch einmal. Er fällte keinen Urteilsspruch. Doch Anna wusste, dass er sie weiterhin prüfen würde. Vorerst musste ihre Seele ausharren in diesem Leib, in diesem Verlies.
„Du gehst heute zur Schule, der Pfarrer will es so haben.“
Anna saß am Tisch und löffelte ihre Morgensuppe. Gehorsam nickte sie dem Vater zu. Dann sah sie zur Mutter, die ihr gegenüber saß, wunderte sich und wusste nicht, warum. So tief war Annas Traumbild auf den Grund ihrer Seele gesunken.
Jetzt leuchtete die Morgensonne herein und erhellte Mutters Gesicht. Anna konnte sich nicht daran freuen und verstand auch das nicht. Die Mutter lächelte, oder lächelte nur der Sonnenschein auf ihrem Gesicht?
„Iss deine Suppe. Warum isst du nicht weiter?“
Anna durfte ihren Eltern niemals eine Antwort schuldig bleiben. „Ich hab’ nachdenken müssen, Mutter.“
„So, nachdenken.“ Das klang, als wäre es höchst ungewöhnlich, dass ein kleines Mädchen nachdachte. „Worüber denn?“, wollte die Wagnerin wissen.
„Ich weiß nicht, worüber.“ Anna senkte beschämt den Kopf, doch die Mutter gab sich zufrieden mit dieser Antwort. Ja, sie wirkte geradezu beruhigt.
„So töricht kann eben nur ein Weib daherreden.“ Wagners Schritte knarrten über den Holzboden. Die Tür quietschte und fiel ins Schloss.
„Mutter, braucht Ihr mich nicht, um das Vieh auf die Weide zu führen?“ Angst kratzte in Annas Kehle.
Doch die Wagnerin wiederholte, was ihr Mann bereits angeordnet hatte, dass Anna zur Schule gehen müsse, weil der Pfarrer es wünsche.
„Und Ihr, Mutter, wollt Ihr nicht lieber, dass ich das Vieh hüte?“
Die Wagnerin wandte sich ab. „Was ich will, tut nichts zur Sache.“
„Ich kann so schlecht reden in der Schule.“ Auch jetzt kratzte Annas Stimme wie zum Beweis dafür. „Manchmal will mir kein Wort herauskommen.“ Sie steckte den letzten Löffel Suppe in den Mund, und die Mutter schob ihr noch ein Stück Brot zu. „Hier, iss und sei still. Du sollst nur aufsagen, was im Katechismus steht, sonst schweig. Dann wird der Herr Pfarrer zufrieden sein und dich wieder aus der Schule herauslassen.“
Anna kaute lange auf dem Brot herum, bevor sie es schlucken konnte.
Der Junge stand vor der Tür zu jenem Raum, der, wie sein Vater zu sagen pflegte, eine Art Vorzimmer zur eigentlichen Menschwerdung darstellte. Heinrichs Blick glitt allerdings den von wenigen Patrizierpalästen gesäumten Schulberg hinab. Unten sah er ein paar Köpfe auftauchen und wieder verschwinden wie hinter einer Welle.
Er wünschte, die Straße würde sich in einen glitschigen Wurm verwandeln, der sich wand und sie nicht hinauf ließ. Verschlingen sollte er sie nicht. Das wäre dann doch ein zu sündhafter Wunsch, zumal Heinrich als Pfarrerssohn natürlich allen Kindern sündenfrei vorauswandeln sollte. Die anderen schienen zu glauben, dass er das immer schaffte.
Heinrich seufzte. Wenn sie doch nur ein bisschen an ihm zweifeln würden, nur ein kleines bisschen. Es wandelte sich so einsam ganz vorn an der Spitze. Nicht selten bekam er auch noch empfindliche Sticheleien in den Rücken und durfte sich nicht einmal nach den anderen umdrehen.
So, dass keines es richtig merkte, sollte schon ein zukünftiger Hirte Gottes seine „Schäfchen“ im Auge behalten. Wer sich stets beobachtet fühlte, der lernte nicht wirklich, den Versuchungen der Sünde zu widerstehen und war nicht gottgewollten Prüfungen durch den Teufel ausgesetzt. Er lebte in der Gefahr, christlichen Lebenswandel vorzuheucheln. Irgendwann, sobald sein Hirte ihn doch einmal einen Moment aus den Augen ließ, drohte er Satan auf einen Schlag rettungslos zu verfallen, weil er überbehütet und verweichlicht war.
So hatte Vater Lammer es seinem Sohn eingebläut, wenn nötig, auch mit der Rute.
Heinrich war inzwischen zu einem verschlagenen Bürschchen von zwölf Jahren herangewachsen. Nun gut, er hielt seine verstohlenen Blicke auf die anderen Kinder. Wehe dem, der sich von ihm unbeobachtet glaubte, etwas anstellte und sich daraufhin weigerte, mit ihm zu spielen.
Geschwind schlüpfte Heinrich durch die Tür, bevor eines der herannahenden Kinder ihn sehen konnte. „Jungfer Rotnagel, die Mägdlein kommen.“
In der Ecke neben dem Fenster, vor der Tafel, erwartete Reinhild Rotnagel ihre Schülerinnen, das Gesicht so ausdruckslos wie immer. Das Leben war an ihr vorbeigegangen, ohne sie merklich zu streifen – ein ungelebtes Leben. So kam es, dass die üblichen Altersspuren seltsam deplatziert auf ihrem Gesicht wirkten. Irgendwann würde sich der Tod gnädig ihrer annehmen, sie zum ersten Tanz ihres Lebens auffordern und sich mit ihr vermählen. Bis dahin war sie entschlossen, sich ein erfülltes Leben im Jenseits zu verdienen. Die Kindlein mussten vorbereitet werden auf ein Dasein zum Wohle der Gemeinschaft. Manch eines irrte noch im Glauben umher, es dürfe seinem Eigenwillen folgen, wenigstens außerhalb des Schulhauses. Diese Irrlehre auszumerzen, die auch sie einst bedrohte wie jedes Kind, war ihre Lebensaufgabe geworden. Konnte es etwas Schöneres geben, als wachsweiche Kinderseelen nach dem Vorbild Gottes zu formen, auf dass sie ihm zu Ehre leuchteten gleich Kerzen? Wenn Reinhild sich dabei gemartert fühlte, nahm sie es hin wie einen Bonus auf dem Weg zur Seligkeit.
Nach der Größe geordnet, traten die Mädchen in ihren Schulraum, zuletzt die Kleinsten, jedes mit unbewegtem Gesicht, die Mundwinkel herabgezogen. Jungfer Rotnagel hatte die Ordnung so eingeführt und wachte sorgsam darüber. Hinter ihrem trüben Blick lauerte die Gefahr wie ein Hecht im Karpfenteich, der jederzeit vorschnellen konnte.
Die Kinder sortierten sich an ihre Plätze, wo sie stocksteif zu morgendlichem Gruß und Gebet stehen blieben. Jungfer Rotnagel erteilte den Befehl zum Setzen und ließ ihren Blick durch die Bänke schweifen. Baumelnde Beinpaare, auch die der Jüngsten, erstarrten augenblicklich.
Befriedigt nickte die Lehrerin. Dann stieß ihr Blick auf eines der geradeaus gerichteten Augenpaare.
„Anna Wagner.“ Bedächtig wiegte Jungfer Rotnagel den Kopf. Anna stand auf und erwartete, dass sie vortreten müsste, einige Tatzenschläge empfangen für ihr Fehlen oder zumindest eine Strafpredigt. Waren ihre Ohren taub geworden, oder ruhte Jungfer Rotnagels Blick noch immer still auf ihr? So hatte sie Annas Namen noch niemals ausgesprochen, fast feierlich, wie bei einem wichtigen Anlass – keinem erfreulichen allerdings. Tief in Anna rief er eine Erinnerung an. Aber sie folgte nicht, blieb dort verborgen. Anna spürte nur ein flaues Gefühl von Schuld in sich aufsteigen. Sie verstand nicht, warum. Beinahe hätte sie nachgesehen, ob irgendwo an ihrem Kleid Schmutz klebte.
„Anna Wagner“, wiederholte die Lehrerin in gleichem Tonfall, „was hat dich in letzter Zeit vom Unterricht fern gehalten?“
„Iiich haaabe uunser Vieh hü-hüüten müssen.“ Endlich waren die Worte heraus. Warum brauchte sie so lange für diese einfache Antwort? Jungfer Rotnagel stellte sich dieselbe Frage. Der Verstand antwortete ihr, dass aus dem Mädchen die Wahrheit sprechen müsse – aber die Wahrheit, gekleidet in den Klang der Lüge? „Warum musst du stottern, wenn du die Wahrheit sagst?“
Anna mühte sich zu antworten, doch was sie sagen wollte, erschien ihr zu unglaubwürdig. Hatte sie gerade gestottert? Es war ihr nicht aufgefallen.
„Nun?“ Die Lehrerin räumte ihr weitere qualvolle Bedenkzeit ein. „Ist dir jetzt die Stimme gänzlich abhanden gekommen?“
Ein bislang unterdrücktes Kichern platzte hinter der auf den Mund gepressten Hand der frechen Paula hervor. Die Mundwinkel der anderen hoben sich ein wenig.
„Sage mir, was Gott im achten Gebot von dir fordert.“
Anna musste daran denken, dass sie nicht stottern durfte und konnte nur dastehen mit offenem Mund.
„Ist dir denn alles abhanden gekommen? Paula“, forderte die Lehrerin die immer noch Kichernde auf, „nenne du Anna Gottes achtes Gebot.“
Das Mädchen schoss in die Höhe und sprudelte heraus: „Du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten!“
Anna zitterte. Hatte sie das etwa getan? Hatte sie jemanden verleumdet?
„Und was heißt das?“
Die Frage war eigentlich an Anna gerichtet, doch Paula konnte ihren Eifer so schnell nicht stoppen. „Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsern Nächsten nicht belügen oder verleumden, sondern jederzeit die Wahrheit reden und des Nächsten Ehre und guten Namen retten und bewahren.“
„Setz’ dich, Anna“, gebot die Lehrerin.
Anna hätte nun doch etwas sagen können, dass sie ihr Stottern nicht bemerkt hätte, dass sie die Wahrheit gesprochen hätte. Sie holte gerade Luft. Doch Jungfer Rotnagels Befehlen war nichts entgegenzusetzen, auch nicht, wenn es angebracht war.
So gehorchte Anna, schluckte und redete sich ein, dass sie froh sein müsse, weil sie nicht weiter gestraft wurde.
Doch die Erleichterung blieb aus. Es war ein Seufzer in Jungfer Rotnagels Stimme gewesen, so ein ergebener Seufzer. Anna fühlte, dass sie nicht einmal einer Strafe mehr würdig war.