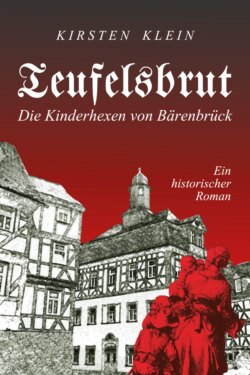Читать книгу Teufelsbrut - Kirsten Klein - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеEr wolle seine Hacke vom Gottesacker holen, habe sie dort vergessen, sagte Schaffners Gehilfe Jörg zum Wächter am Tor, von wo aus die Landstraße Richtung Tübingen aus der Stadt führte.
„Jetzt noch, bei Sonnenuntergang?“, wunderte sich der Wächter.
Das habe doch Zeit bis morgen.
Aber weil Jörg darauf bestand, ließ ihn der Wächter passieren. Bei einem Fremden hätte ihn der Argwohn beschlichen. So schüttelte er nur den Kopf und dachte an etwas anderes.
Jörg wäre gern schneller gegangen, aber es plagten ihn wieder die gichtkranken Füße. Oft in letzter Zeit hatte er beim Bestellen des Gottesackers befürchtet, dass sie ihn eines Abends nicht mehr heimtragen könnten. Und nun kehrte er also nach Feierabend noch mal zurück, obwohl es keiner von ihm verlangt hatte.
Schwer und düster hingen Wolken über dem südwestlichen Horizont. Bäume, deren knospendes Grün in der Dämmerung ergraute, standen zwischen Grabsteinen und Totenbrettern und reckten ihre skelettartig anmutenden Äste einander zu. Jörg hörte den Wind in ihnen wispern und bemerkte, wie ein Zweig sich sacht bewegte, als winke er ihn herbei.
Alles sah so verändert aus. Jörg blieb stehen und versuchte zu überlegen, wo er sie liegengelassen hatte, seine Hacke. Er brachte keinen klaren Gedanken zustande, aber er musste sie wiederfinden, unbedingt, noch ehe die Nacht endgültig hereinbrach. Niemals mehr würde er sie sonst anrühren können. Wohin er auch sah und seine Augen auf einen Baum trafen, war es ihm, als sei dort vorhin noch keiner gestanden, und als sein Blick sich an einen vertrauten Ast klammern wollte, fiel er ins Leere.
Jörg stolperte vorwärts. Etwas hatte seinen Rücken gestreift – ein Windhauch? Eine Gänsehaut überzog Jörgs Körper. Jedes Härchen spreizte sich wie die Stacheln eines eingerollten Igels. Wie viel Zeit wohl vergangen war? Ging es womöglich gleich los? Steckte er schon rettungslos inmitten verwunschener Gestalten? Abermals glaubte er zu spüren, dass etwas über ihn hinwegstrich, duckte sich, hielt beide Hände über den Kopf und schielte argwöhnisch nach oben.
Wind wehte auf und fegte die lose Erde wie mit mächtigen Besen über die Gräber. Verschleierten sich da nicht Unholde mit Staubwirbeln? Der Wind säuselte und wisperte nicht mehr in Ästen und Zweigen. Er heulte auf, schüttelte und rüttelte sie. Begann jetzt der Tanz der Bäume, wie es ihm das Mariele heute Mittag geschildert hatte, als es das Essen hinausbrachte? Kamen jetzt gleich die Hexen, tanzten zwischen den Bäumen herum und verzauberten sie, so dass sie in den Reigen einfielen?
Jörg schauderte, als er daran zurückdachte, an das Lachen der Kleinen bei dieser Vorstellung. Seinen Atem schien es gelähmt zu haben, so dass er nicht einmal nach Schaffner rufen konnte, der etwas entfernt noch grub.
Jörg vergaß seine kranken Füße und spürte den Schmerz umso schneidender. Ein Schrei, der jedem in der Nähe Weilenden das Knochenmark hätte gefrieren lassen, gellte über den Gottesacker.
Fast tröstlich fühlte Jörg etwas neben sich auf der Erde liegen – den Stiel der gesuchten Hacke. Er befühlte ihn zuerst vorsichtig, als handele es sich um ein unberechenbares Tier, und richtete sich endlich mühsam an dem Gerät auf. Seine Augen auf die Stadtmauer gerichtet, hastete er davon, und seine Füße gehorchten, als sei eine Zauberkraft in sie gefahren.
Am nächsten Morgen suchte Schaffner seinen Gehilfen vergeblich, rief nach ihm durch das ganze Haus.
Marie hatte sich den Hütekindern angeschlossen, sollte aber zum Sonnenhöchststand zurückkommen, um ihrem Vater und Jörg das Essen hinaus zu tragen, wie die Tage zuvor.
Die Magd trug die Morgensuppe auf und zitterte dermaßen, dass sie beinahe alles verschüttete. Ihre Miene verriet innere Anspannung.
Schaffner setzte sich an den Tisch in der Küche zur Großmutter und löffelte seine Suppe. Er wähnte sich von der Seite betrachtet und hielt nach mehreren Löffeln inne. „Was zum... Was ist heute Morgen los in diesem Haus? Wo steckt der Jörg?“
Die Wut hatte seine Stimme so anschwellen lassen, dass die Großmutter ihn sofort verstand.
„Ich hab nichts gehört des Nachts“, meinte sie. „Ich hab meine Warnungen oft genug ausgesprochen.“ Damit verstummte sie, und Schaffner wollte auch nichts weiter von ihr hören. Er gab nichts auf ihr ungereimtes Gerede.
Als die Sonne ihren Höchststand erreichte, lehnte er sich an eine Buche neben das frisch ausgehobene Grab und unterdrückte mühsam einen Fluch. Jörg war noch nicht gekommen. Hinter Schaffners Unmut keimte allmählich Sorge um den Knecht. Es war nicht Jörgs Art, sich in Wirtshäusern herumzutreiben, vollzusaufen und dann irgendwo in einem Gassenwinkel zu nächtigen. Selbst in diesem Fall müsste er inzwischen wieder aufgetaucht sein. Trotz seiner zunehmenden Beschwerden war Jörg noch ein braver, brauchbarer Gehilfe.
Schaffner blinzelte in die Sonne und sah hinter vorgeschützter Hand eine kleine Gestalt auf sich zukommen – Marie. Wieder einmal bedauerte er, dass seine Frau im Kindbett verstorben war und ihm bloß ein Mädchen geboren hatte. Wer sollte nach ihm das Amt des Totengräbers bekleiden? Niemand riss sich um eine Arbeit, die ihn abseits der ehrbaren Gesellschaft stellte und in die Einsamkeit trieb. Dahinein, so meinte Schaffner, musste man geboren werden und so aufwachsen wie er, nämlich ohne etwas anderes kennenzulernen. Also hatte Schaffner die Einsamkeit lieben gelernt und die Gesellschaft der Toten. Wortkarg war er dabei geworden, beinahe so still wie sie. Manchmal allerdings, wenn er besonders lange hier draußen war, glaubte er sie mit dem Wind wispern zu hören. Dann antwortete er und redete sich zuweilen so ein, dass ihm der Mund ganz austrocknete und er zu Hause noch weniger sprach als gewöhnlich.
Marie war inzwischen herangekommen und stand schnaufend vor ihm, die Kanne mit Wein noch schlenkernd in der Hand, Hirsefladen und Salzfleisch in der anderen. „Gott zum Gruß, Vater, ich bring’ Euch Euer Mahl.“
Schaffner zwang sich ein Lächeln auf die dünnen Lippen, die nicht aussahen, als seien sie zum viel Reden gemacht, und biss in das Salzfleisch. „Ist der Jörg noch nicht gekommen?“
Das Kind sah ihn an, als staune es darüber, dass er nichts wusste. „Nein Vater, der ist doch heute ganz in der Früh’ schon aufgestanden. Der hat sich die ganze Nacht im Bett herumgewälzt und gemurmelt“, fuhr sie fort, als der Vater sie stumm anstarrte. „Und dann hat er immer nach seiner Hacke gegriffen.“
„Nach seiner Hacke?“ Schaffners Frage fuhr so laut heraus, dass Marie zusammenzuckte und erst Luft holen musste, ehe sie weitersprach. „Ja, er hat doch seine Hacke mit heraus genommen in die Schlafkammer. Dann hat er sie ans Bett gelehnt. Vielleicht“, überlegte sie, und ihre Augen funkelten, „hat er mit hinausfahren wollen. Aber nein, das glaub’ ich doch nicht.“ Sie verwarf den Gedanken sofort. „Der hat sich ja so gefürchtet.“
Schaffner blieb der Bissen ungekaut im Mund liegen. „Was soll das, warum nimmt er seine Hacke mit in die Schlafkammer?“
„Weil – ich glaub’, er wollte nicht, dass wir damit hinausfliegen, die Großmutter und ich. Ich hab nämlich gemeint, dass seine Hacke bestimmt gut fliegen könnte. Da hat er gesagt, er würde nicht mit einer verhexten Hacke arbeiten. Er wollte schon aufpassen.“
Schaffner verstand immer weniger. „Was soll das heißen? Wann hat er das zu dir gesagt, und wie kommt er überhaupt darauf?“
In Maries Kopf purzelten die Fragen wild durcheinander. Der Vater hatte offenbar wirklich von alldem nichts mitbekommen. Sie deutete auf eine wenige Schritte entfernte Eiche. „Dahin hab ich ihm sein Essen gebracht.“
Schaffner erinnerte sich, dass er tags zuvor etwas entfernt geschwind noch ein Grab fertig ausgehoben und seinen Knecht reichlich verstört mit dem Essen vorgefunden hatte. Da Schaffner nicht sehr auf Lebende achtete, maß er auch dem keine Bedeutung zu.
„Auf einmal hab ich dann alles wieder so gesehen wie in der Nacht.“ Maries Stimme klang verklärt, als sie ihrem Vater nun dasselbe erzählte wie Jörg. Der habe es aber gar nicht so lustig wie sie gefunden.
Schaffner hatte die Augen von seinem Kind abgewandt. Entsetzt stierten sie in die Luft.
Marie betrachtete ihn verunsichert. „Ihr findet es auch nicht lustig, nicht wahr, Vater?“
Schaffner wich ihrem Blick aus. „Was hat Jörg gemurmelt? Wohin ist er gegangen so früh?“
Marie schüttelte den Kopf. „Ich hab nichts davon verstanden. Er hat sich über mich gebeugt, und dann bin ich aufgewacht.“
„Und – hat er dann etwas gesagt?“
„Ja, aber ich hab nicht verstanden, was er damit gemeint hat. ‚Armes Kind’, hat er gesagt, und dass er zum Herrn Pfarrer gehen würde, und dass ich keine Angst haben müsste. Aber – Vater – ich hab doch gar keine Angst.“ Noch während sie sprach, war sich Marie dessen nicht mehr sicher. Sie ärgerte sich. Gelegentlich hatte sie aufgeschnappt, dass der Vater sich einen mutigen Buben wünschte.
Marie krauste ihre Stirn. „Vater, warum bin ich ein armes Kind?“
Schaffner hielt beide Hände vor sein Gesicht und wiegte den Kopf hin und her. Anstelle einer Antwort schweifte sein Blick zwischen den gespreizten Fingern hindurch zum frisch ausgehobenen Grab. Tief atmete er den feuchten Duft der Erde.
Jörg folgte dem grauen Licht, das die Dämmerung am östlichen Horizont ankündigte. Alle paar Schritte blieb er stehen und wandte sich um, nicht nur, weil ihn die Füße schmerzten. Denn wie unter Zwang betrachtete er die windgerüttelte Fassade des Schaffnerhauses und überlegte, ob er jemals wieder nach dorthin zurückkehren würde. Schon dem verstorbenen Totengräber hatte er gedient und zugesehen, wie der Sohn ausgerechnet jenes Weib ehelichte. Dann war aber nichts Verdächtiges geschehen, all die Jahre über.
Jetzt konnte Jörg nicht mehr zusehen. Seine Nerven versagten ihm den Dienst. Dieses Haus – müsste es nicht längst in sich zusammengestürzt sein, so schlecht, wie für seine Erhaltung gesorgt wurde? Welche Kraft hielt es aufrecht? Jörg schloss den Mantel enger um seinen Leib und schleppte sich so schnell vorwärts, dass er mit dem Atmen kaum nachkam.
Als er das Neue Kirchgässle hinaufkeuchte, fühlte er sich mit jedem Schritt schrumpfen. Das Pfarrhaus ragte wie ein gewachsener Felsen auf dem Schulberg empor. Seine sorgfältig gezimmerten Fensterläden verrieten nicht, ob sich dahinter Leben regte. Die Sonne kündigte ihren baldigen Aufgang mit einem Lichtschein an, der den Hexenturm am nordöstlichen Tor erhellte.
An der Abzweigung zum Schulberg blieb Jörg stehen, atmete durch und beschloss, Gottes Diener nicht so früh zu stören. Er suchte Zuflucht in der stillen Kirche, auf der hintersten Bank, wie es ihm beim Gottesdienst anstand. Grau zeichnete sich der gemäß lutherischem Glauben von Götzenfiguren gereinigte, weißgekalkte Chor um die Kanzel herum ab, welche den Altar beiseite gedrängt hatte und nunmehr im Mittelpunkt stand. Jörg sah zu ihr hin und rang mit dem Schlaf, wie sonst während des Gottesdienstes.
Er fand gerade noch Kraft, sich darüber zu wundern, warum sie vor seinen Augen mit dem Hintergrund verschmolz, ehe er sich dem Schlaf preisgeben musste. Sein Kopf sank auf die Brust, und die ineinandergefalteten Finger lösten sich.
Lange schlief Jörg so tief, dass er nicht träumen konnte. Erst am späten Vormittag begannen seine Lider zu flackern. Er sah sich in der Kirche auf der Bank sitzen, aber nicht mehr allein. Betende waren um ihn, in langen, weißen Gewändern, und die Sonne erleuchtete ihre gelockten Häupter. Sie rührten nicht einmal ihre in die Andacht versunkenen Gesichter, die ihn wachsweiß und durchsichtig anmuteten, wie ihre Hände. Jörg versuchte sie förmlich mit den Augen zu begreifen, doch je eindringlicher er sie betrachtete, je gläserner wurden sie und schwanden endlich, ohne sich erhoben zu haben.
Eine der Gestalten musste aber an ihm vorbei gegangen sein, ihn nur mit dem Windhauch einer Bewegung berührt haben. Jörg hob seine Lider – einen Augenblick zu spät, wie er meinte, um die Gestalt noch sehen zu können.
Das Portal war geöffnet worden, und durch den Mittelgang, über die Kanzel hinweg, flutete ein Lichtstrahl. Jörg sah ihm nach und faltete verzückt seine Hände. Auf dem Seitenaltar neben der Kanzel steckten jetzt hohe, weiße Kerzen in einem sechsarmigen Lüster. Sie waren doch nicht hinausgegangen, seine Engel.
Die Sonne näherte sich dem Zenit, prallte auf das Haupt des Jungen und auf die Rebstöcke. Er befühlte eine der Knospen, nahm sie zwischen Daumen und Zeigefinger und rieb sie, zerrieb sie, bis ihr noch ruhendes Innenleben zwischen seinen Fingern verblutete. Heinrich wischte sich die Hand an der Hose ab und sprang weiter zwischen den Reben hindurch, bergauf zur Vogelscheuche, die über alles wachen sollte. Unterwegs knickte er ein Zweiglein ab und hüpfte lachend und damit wedelnd um die Scheuche herum, dass ihr fast der Schlapphut vom Strohkopf fiel. Alsdann zog der Junge seine Schleuder aus der Hosentasche, legte ein Steinchen ein und zielte auf einen Star. Wütend umklammerten seine Finger das Holzstück – daneben. Beinahe hätte er vorhin in der Kirche auch die Kerzen so gedrückt, konnte sich aber gerade noch beherrschen. Heinrich quetschte seine Schleuder zurück in die Tasche, hob den Kopf und sah über die Mauer den Abhang hinunter auf die Stadt. Ein schwarzer Punkt überquerte eben den Fischersteg. Heinrich schoss davon, betrat die Stadt durch das nördliche Tor und sauste die Turmgasse hinab, vorbei an der Lateinschule, bis er auf die parallel zur Glutach verlaufende Kronengasse stieß. Von da an schlenderte er betont gemächlich zum Pfarrhaus, als hätte ihn nichts zur Eile angetrieben, und erreichte es kurz vor seinem Vater. Heinrich grüßte und folgte ihm in die Stube. „Ich habe den Leuchter in der Kirche mit Kerzen bestückt, wie Ihr mir aufgetragen habt, Herr Vater.“ Heinrich fürchtete, dass der Ärger, der aus seines Vaters gerunzelter Stirn sprach, ihm gelten könnte. Eigentlich wollte er berichten, das er den alten Jörg in der Kirche gesehen hatte, doch dann wäre vielleicht herausgekommen, dass Schulmeister Kurzhals ihm die letzte Unterrichtsstunde erlassen hatte, weil er anstelle des erkrankten Kirchendieners die Kirche herrichten sollte, angeblich vor Schulschluss.
„Was hast du?“ Lammer hatte nicht richtig hingehört. Heinrich wiederholte, was er gesagt hatte, doch Lammer unterbrach ihn und winkte geistesabwesend ab. „Ja, schon gut.“
Heinrich atmete auf. Der Ärger galt offenbar nicht ihm. Sicherheitshalber wollte er seinem Vater doch noch einen Bissen reichen. „Herr Vater, die Anna – ich hab gehört, dass sie wieder gestottert hat.“
„So, hat sie das?“ Lammer wirkte verstört. Hinter ihm lag eine Auseinandersetzung mit Gernot Weiß, der vehement behauptete, jene armselige Pfründnerin nicht mehr bevorzugt behandelt zu haben. Lammer argwöhnte dennoch, er würde sie nach wie vor stundenweise in ein Einzelzimmer legen lassen. Doch solange er Weiß nicht dabei ertappte, konnte er schwerlich etwas dagegen tun, ja, den Ungehorsamen nicht mal gehörig maßregeln.
Missmutig befahl Lammer seinem Sohn, der Köchin auszurichten, dass er noch keinen Appetit auf weltliche Speise verspüre, ließ ihn stehen und schritt hinab zur Kirche. Als er eintrat, stieß er gegen Jörg, der jegliche Gedanken an leibhaftige Menschen beiseite geschoben hatte und, beflügelt vom Rausch himmlischen Trostes, das Gotteshaus verlassen wollte.
Als wäre er ein Eindringling in seine überirdischen Gefilde, starrte der Alte den Pfarrer an und fand kein Wort, nachdem er ihn gegrüßt hatte wie einen ungebetenen Gast.
Lammer musterte ihn verwundert. „Du bist doch der Jörg, Schaffners Gehilfe.“
„Steht das Gotteshaus nicht auch unsereinem immer offen, Herr Pfarrer?“ Jörg staunte selbst über seinen aufmüpfigen Ton.
„Gewiss doch. Gott will aber, dass wir arbeiten und nur zu gegebener Zeit feiern. Ich muss vermuten, dass du dich betrunken und im Tag geirrt hast. Morgen ist Karfreitag.“
Der Alte weitete die Augen und überlegte, wie er diesen Verdacht von sich weisen könnte. Gerade wegen des Osterfestes hatte er umkehren und sich zuerst mit Schaffner beratschlagen wollen, damit dieser auf die bevorstehende Schande gefasst sein würde. Nun fiel ihm nichts ein als ein hilfloses Kopfschütteln.
Lammer legte ihm väterlich eine Hand auf die Schulter. „Ich sehe dir an, Jörg, dass dich etwas bedrückt. Freilich bist du nun erleichtert nach der Zwiesprache mit Gott. Bedenke aber, dass ich von ihm zum Tragen irdischer Lasten beauftragt bin. Durch mich erfahren die Menschen sein Wort. Nicht alle können es allein durch das Gebet aufnehmen – so wie offensichtlich du, Jörg.“
Der Alte fühlte sich in seine Verklärung zurückversetzt. Ja, er glaubte wahrhaftig, Gottes Boten gesehen und ihre Kraft in sich aufgenommen zu haben.
Einladend fasste Lammer ihn am Rücken. „Folge mir in mein Haus und lasse dir ein Linsengericht schmecken, denn auch der Leib will gespeist sein.“
Jörg fühlte augenblicklich so viel Speichel auf seiner Zunge, dass seine Stimme wässrig klang. „Sehr wohl, Herr Pfarrer, zu gütig von Euch. Noch keinen Bissen hat mein Magen heute erhalten.“
Vielleicht war tatsächlich Beunruhigendes vorgefallen. Während er ihn zum Pfarrhaus geleitete, überlegte Lammer, mit welcher Nachricht der Alte ihn wohl speisen würde.
Unterdessen war auch Schaffner in sein Haus zurückgekehrt, obwohl er noch ein Grab auszuheben hatte. Böse Ahnungen begleiteten ihn, dazu sein Töchterlein, das um ihn herum sprang und den Blicken der Leute lachend begegnete. Der Vater hatte nicht gescholten, und sie machte sich keine Gedanken mehr darüber, warum Jörg sie für ein armes Kind hielt.
Drinnen im Haus wirkte beim Eintreten alles wie sonst. In der Ecke auf ihrem Stuhl saß die Großmutter in der Stube und murmelte leise vor sich hin. Von der Küche drangen die Arbeitsgeräusche der Magd herüber.
Marie stürmte zu ihr an den Herd. „Erna, warum singst du nicht?“
„Die Alte hat’s verboten“, hörte Schaffner die Magd von der Stube aus antworten und sah zu seiner Schwiegermutter hinüber. Stumm suchte er in ihrem Gesicht nach Antworten auf Fragen, die Marie in ihm aufgeworfen hatte, als das Kind aus der Küche kam, neben dem Stuhl auf den Boden schlitterte und zu der Greisin aufsah. „Großmutter, warum darf die Erna nicht mehr singen?“
Schaffner unterbrach sie barsch. „Weil’s nichts zu singen gibt in diesem Haus.“ Er trat herbei und zog das Kind weg. Die Alte nickte und deutete zur Küche. „Nicht so ein gottloses Zeug, was die immer singen will.“ Damit sang sie selbst und lobpreiste Gott in hohen Tönen.
Schaffner starrte sie ungläubig an und unterbrach das Lied nach der ersten Strophe. „Das aus Eurem Munde! Es klingt wie Hohn. Ich weiß Bescheid über Eure Machenschaften.“
Die Greisin murmelte wieder vor sich hin. Schaffner hielt abwehrend beide Hände vor sich, als wollte sie ihm im nächsten Moment ins Gesicht springen. „Was murmelt Ihr da? Seid still!“ Nun verstummte sie ganz und stierte mit unbewegter Miene wie durch ihn hindurch.
Unruhig ging Schaffner vor ihr auf und ab. „Wohin geht Ihr? Immer seht Ihr so drein. Jetzt fällt es mir auf.“
Sie antwortete nicht gleich. „Ich sehe kaum noch etwas, nur das, was ich nicht vergessen kann. Das muss ich immer sehen.“
Marie stand neben ihrem Vater. Er wurde ihr mit jedem Wort fremder, denn sie war es nicht gewohnt, dass er so viel redete. Auch Schaffner selbst kannte sich kaum wieder, was die Erregung in seiner Stimme nur noch steigerte. „Dass Ihr so eine seid... Aber wie konntet Ihr das arme Kind zu derlei Dingen anleiten, es auf dem Besen mit hinausfahren lassen...?“ Schaffner brach ab, als er den entsetzten Blick der Alten gewahrte und schaute zu Marie. Die Kleine hatte nur wieder herausgehört, dass sie ein armes Kind sei, und die Stirn gekraust.
Tränen rannen der Großmutter aus den Augen, die so trocken waren, dass das Weinen brannte. Ohne sich noch mal unterbrechen zu lassen, faltete sie die Hände und begann zu beten. Auch aus Maries Augen flossen Tränenströme. „Weint nicht, Großmutter, ich bin doch gar kein armes Kind.“ Immer noch klang es eher trotzig als traurig.
Der Vater zog sie abermals fort. Sie folgte ihm bis in die Mitte der Stube und blieb dort stehen. An der entgegengesetzten Wand ließ er sich auf die rund um die Stube führende Bank sinken. Nach einer Weile gesellte sich Marie an seine Seite. „Müsst Ihr heute kein Grab mehr schaufeln, Vater?“
„Sei still, alles soll still sein“, gebot Schaffner, worauf auch die Küchengeräusche erstarben. Nur die Großmutter betete unentwegt weiter. Doch die Gedanken in Schaffners Kopf brodelten so hitzig, dass er nichts anderes mehr wahrnahm. Was hatte er hier untätig zu sitzen am helllichten Tag? Das Grab – er musste doch noch ein Grab schaufeln. So forderte es eine Stimme in ihm, erst die eigene und dann eine andere, lautere. Er kannte sie. Es war die Stimme des Pfarrers. Sie fragte ihn, was er hier mache.
‚Ich werde es schaufeln, das Grab – mein Grab’, antwortete Schaffner in Gedanken, aber die Stimme gab sich nicht damit zufrieden. Der Totengräber rieb sich die Augen und fuhr hoch. Da stand er leibhaftig vor ihm, der Herr Pfarrer. Marie hatte ihn hereingelassen. „Ich gehe schon, das Grab schaufeln“, hörte Schaffner sich sagen, doch der Geistliche sah ihn verständnislos an. Jetzt bemerkte Schaffner, dass er in Begleitung zweier Schergen gekommen war, die nicht länger müßig herumstehen wollten, sich überall nach verdächtigen Indizien umsahen und die Großmutter von ihrem Stuhl hochzerrten.
Mit kritischen Blicken folgte Lammer jeder Bewegung. „Nicht so grob, es ist bisher nichts bewiesen.“ Mitleidig lächelnd beugte er sich zu Marie hinab. „Armes Ding – du kommst mit und erzählst uns alles.“
Marie nickte. Natürlich wollte sie erzählen, am liebsten gleich und vor allem, dass sie nicht arm sei, aber der Pfarrer hatte sich zur Tür gewandt. Widerspruchslos ließ sich die Großmutter von den Schergen hinausführen. Mit dem Kind an der Hand folgte Lammer. Auf der Schwelle drehte sich Marie noch einmal zu ihrem Vater um, der wieder auf der Bank saß. Licht fiel durch die Tür auf sein Gesicht.
Lammer sah, dass er nicht zu ihm durchdrang und musste dennoch ein paar Worte an ihn loswerden. „Ihr seht aus, als hättet Ihr von alldem nichts gewusst. Euer Unglück dauert mich. Lasst Euch durch die Arbeit ablenken. Richtet die Gräber.“
Der Schlag, mit dem die Tür ins Schloss fiel, zerschlug auch Schaffners Traumblase, in die er sich zum Schutz vor der Wirklichkeit gehüllt hatte. Er fand sich allein in der Stube und sah jetzt mit ungnädig wachen Augen die umgeworfenen Stühle, die durchwühlte Truhe, aus der die Kleider hingen, und den zerrupften Besen.
„Herr Pfarrer, sie kann noch allein gehen, die Großmutter.“ Marie sah auf ins Gesicht des Geistlichen, der sie an der Hand führte und ihre Finger drückte.
Er lächelte zu ihr herab. „Wie du sagst, kann sie ja noch viel mehr, als einfach nur gehen.“
Marie wich seinem Lächeln aus und betrachtete den Rücken der Greisin, die gebeugt an der Mauer entlang flussabwärts trottete, die dürren Beine nach außen gekrümmt und an den Armen beidseits von den Schergen gehalten, als könnte sie sonst davonfliegen. Hoch wölbte sich ihr Buckel über den Kopf, der von hinten kaum sichtbar war.
Marie konnte die Augen nicht von ihr lassen. So anders mutete sie die Großmutter im hellen Tageslicht an, wahrhaftig wie verzaubert.
Noch ehe er ein Wort mit der Verdächtigen gesprochen hatte, sah Lammer die Anschuldigungen glaubhaft dargeboten. Er brauchte ja nur dieses Kind unauffällig von der Seite her zu beobachten. Wie gebannt es auf die Alte starrte.
Maries Augen glotzten freilich nicht allein. Die meisten Anwohner hatten eben ihr Mittagsmahl verzehrt, und das fast täglich genossene Kraut rumorte in ihren Mägen, während sie mit aufgerissenen Mündern und ebensolchen Augen verharrten, wo immer sie gerade standen oder saßen. Das Schweigen schien die Botschaft auch jenen zuzutragen, die noch nichts mitbekommen hatten. Der Herr Pfarrer ließ die greise Schwiegermutter des Totengräbers abführen.
Kurz vor der Täuferbrücke ließen Maries Blicke geschwind von der Großmutter ab und schweiften durch die Büßergasse zur Schmiede. Das Hämmern war verstummt.
„Anna!“ Marie hatte eben noch einen Schürzenzipfel erhascht. Die Alte, schon auf der Brücke, zuckte mit dem Kopf, als der Ruf auch sie ereilte, und lenkte Lammers Gedanken zu sich.
Marie wandte sich nur noch einmal im Gehen um. Zu aufgeregt folgte sie auf die andere Seite, dem Marktplatz zu mit den feinen Häusern, dem Brünnlein in der Mitte, wo sie nur einmal in ihrem Leben gewesen war. Angst – nein, sie wollte nicht ängstlich sein. Der Vater würde sich freuen über sein Mägdlein, das kein Bub an Mut übertreffen könnte.
Mitten über den Platz schritten sie, zum feinsten aller Häuser, das in der Sonne prunkte, als würde es sie erwarten. Marie begann zu hüpfen an der Hand des Pfarrers, ließ es aber sofort wieder sein. Lammer wies sie auf die Menschen ringsumher hin, deren Lippen zitterten. Marie tat es ihnen gleich und murmelte ein Gebet. Was die Leute bloß für ängstliche Gesichter zogen, all die Erwachsenen und sogar die Männer. ‚Wenn das nur der Vater sehen könnte’, dachte Marie und fühlte einen Stolz in sich aufglühen, der Stirn und Wangen rötete. Ihr Herz hämmerte in der Brust, als sie an Pfarrer Lammers Hand dieses Haus betrat, das auf sie gewartet hatte. Breit führte eine Treppe aufwärts, nach einem riesigen Saal mit hohem Gewölbe, fast so hoch wie in der Kirche. Marie reckte den Kopf, schon als sie das Portal durchschritt. Ihr Herz hüpfte so wild, als wolle es dieses Gefängnis aus Rippen sprengen, das es an die Erde bannte. Mit der freien Hand erfühlte sie die Schnitzereien des Treppengeländers und schaute darüber hinweg an die Wand, von welcher ehrwürdige Herren streng auf sie herabsahen – ehemalige Bürgermeister von Bärenbrück. Dabei bemerkte sie nicht, wie die Großmutter im ersten Stock hinter einer Tür auf dem Gang verschwand.
Der Pfarrer führte das Kind über den Gang in ein Zimmer, worin es sich erst umsehen musste. Staunend schweiften seine Blicke die holzgetäfelten Wände entlang, über die leeren Bänke. Erst nachdem Lammer sie angeheißen hatte, sich auf das Anklagebänkchen zu setzen, entdeckte Marie hinter einem langgestreckten Pult, das auf erhöhter Ebene stand, die drei Herren vor sich, kostbar gekleidet wie die auf den Wänden, mit rotsamten abgesetzten schwarzen Roben und in ihren Kinderaugen uralt. Dabei hatte noch keiner von ihnen die Fünfzig überschritten.Marie sah weg und suchte nach dem Gesicht des Pfarrers, das zwar meist genauso streng wirkte, ihr aber wenigstens vertraut war. Doch Lammer hatte den Gerichtssaal verlassen. Er musste noch die Predigten für das Osterfest vorbereiten.
Einer der Männer hinter dem Pult war weniger prachtvoll gekleidet, merklich jünger und saß auch noch abseits, weshalb Marie nun zu ihm hinschaute. Er schien ihren Blick aber nicht erwidern zu wollen, sondern hielt seinen Kopf tief über ein Blatt Papier gebeugt. Seine Finger umklammerten eine Schreibfeder. Plötzlich fiel Marie ein, dass man solch hohe Herren besonders höflich zu begrüßen hatte, vor allem, wenn man selbst ein kleines Kind war. Sie wusste aber nicht, wie, und weil es sie hier ähnlich anmutete wie in der Kirche, faltete sie die Hände.
Der Vogt zwischen Schultheiß und Apotheker, die sich, ebenso überrascht wie er von der Meldung des Pfarrers, heute zu dieser Befragung eingefunden hatten, räusperte sich. „Es ist gut, dass du die Hände zum Gebet faltest, Kind. Ich sehe wie der Herr Pfarrer, dass man dich wohl wieder auf den rechten Weg zurückführen kann.“
Marie verstand nur, dass sie sich richtig verhielt und nickte artig. Dann stellte der Vogt fest, dass sie die Marie Schaffner sei, die Tochter des Totengräbers und forderte sie auf, zu erzählen, was sie in der Nacht so alles treibe.
Marie sah ihn erstaunt an. „Schlafen tu’ ich in der Nacht.“
Der Vogt grinste, warf aber den anderen mahnende Blicke zu, als sie es ihm gleich taten, und strich über seinen Kinnbart. „So so, also nur schlafen?“
Marie schüttelte den Kopf. „Oh nein, hoher Herr, nicht nur schlafen. Ich schlafe ein, und dann weckt mich die Großmutter.“Der Vogt unterbrach sie. „Jede Nacht?“
Marie musste überlegen und bejahte endlich eifrig, worauf der Vogt wissen wollte, ob sie denn dann morgens nicht viel zu müde sei, um mit auf die Weide zu gehen und wie sie überhaupt mit dem Vieh zurecht käme.
Enttäuscht dachte Marie, dass auch dieser gelehrte Mann sie offenbar noch für zu klein hielt zum Hüten und berichtete ihm von der Zaubersalbe ihrer Großmutter. Die müsse man nur auf die Gerte streichen, und flugs gehorche das Vieh und wage nicht mehr auszubrechen.
Davon wollte Marie noch weiterreden, aber der Vogt unterbrach sie erneut und fragte, was denn die Großmutter nachts mit ihr mache, nachdem sie sie geweckt habe.
Marie erzählte, und nun unterbrach sie niemand mehr. Wenn sie Luft holen musste, wurde nur das Kratzen der Feder hörbar. Nicht schnell genug konnte der junge Gerichtsschreiber alles notieren, was dem Kindermund entsprudelte. Alle Striche, die vor ihm auf dem Papier entstanden, stachen ihm in die Augen wie Nadeln.
Schweißtropfen perlten von seiner Stirn und klecksten auf die Schrift, während die Federspitze sich mit schwarzer Tinte vollsog. Oder war sie dunkelrot wie die des Teufels, von dem das Kind gerade erzählte?
Die hohen Herren saßen still. Der junge Schreiber riskierte einen Seitenblick und meinte, sie wären näher zusammengerückt. Die mussten nur zuhören, nicht alles hastig niederschreiben. Er bedachte nicht, wie mächtig Maries Worte ihre Fantasie verführte, wenn sich auch allen die Frage stellte, ob diese Stimme, die unzweifelhaft einer Fünfjährigen gehörte, ihre Ohren narrte. Allein der Klang ihrer Stimme schien noch kindlich zu sein an Marie. Der Schreiber musste auf seine Schrift achten, aber auch die anderen sahen kein Kind mehr vor sich sitzen. Marie hatte ihre Augen nach innen gelenkt, ihre Gedanken entführt, zum Nachtflug durch das Fenster. Sie flogen mit ihr in einem Boot durch das Wolkenmeer und ließen die Stadt mitsamt ihrer Mauer hinter sich. Draußen auf der Weide feierte ein Herr sein Fest. Marie wusste, dass es der Teufel war, denn die Großmutter hatte ihn immer und immer wieder beim Namen genannt, damit er niemals in Vergessenheit geriete. Schon von oben, noch bevor sie landeten, drang ihnen fröhlicher Gesang in die Ohren durch das Rauschen des Windes. Kaum konnten sie es erwarten, sich einzugliedern in den Kreis, der den Teufel nackt umtanzte. Die Großmutter hatte ihn Marie auch schon vorgestellt. Er führte sie beide zur Tafel, wo sie sich mit vielen anderen an Leckereien laben durften und nach Herzenslust schmatzen, schlürfen, rülpsen und furzen. Das gefiel dem Teufel, und er gab darin meist den Ton an.
Die Feder des Schreibers kratzte noch eifriger über das Papier. Sein Atem beschleunigte sich, als erregte ihn etwas, und nahm dabei zwangsläufig einen ausgestoßenen Leibesdunst auf. Verstohlen schielte er zu den Ratsherren hinüber und fragte sich, ob diesen die Gedanken entglitten sein mochten wie ihm. In ihren Gesichtern glaubte er seine eigenen Gefühle gespiegelt zu sehen. Wahrhaftig, so dachte der Apotheker im selben Augenblick, musste aus diesem unschuldigen Kindermund der Teufel sprechen und voller List wagen, sogar der Obrigkeit sein zügelloses Treiben schmackhaft zu machen.
Gerade noch rechtzeitig wischte sich der Schultheiß den übergelaufenen Speichel vom Mund. Noch sah er es vor sich, das im Mondlicht schimmernde, milchweiße Fleisch entblößter Leiber – wogende Brüste, feiste Hinterbacken. Flüchtige Blicke bestätigten ihm, dass auch die beiden anderen ihrer Fantasie die Fesseln gelöst hatten, sich mit ihr treiben ließen und in ihr schwelgten.
Ein paar mal setzte der Vogt dazu an, Maries Zunge zu zügeln, weil er fürchtete, der Teufel könnte sich allzu heimisch in ihrer Stimme fühlen. Aber dieses Kind musste doch berichten, alles offenlegen und die Machenschaften seiner Großmutter verraten. Marie hörte auf zu erzählen, und die Feder des Schreibers kratzte ihre letzten Äußerungen nieder, ehe auch sie verstummte. Räuspernd brach der Vogt das Schweigen und schaute auf Marie, als staunte er, sie hier vor sich zu sehen. Er konnte nicht fassen, dass diesem Kindergesicht eben noch entsprungen war, was kein Erwachsener öffentlich auszusprechen wagte, sofern er überhaupt so viel davon wusste. Um seinen Gedanken noch etwas Raum zu lassen, dehnte er seine Stimme. „Du hast gesagt, der Teufel hätte ein Tintenfass gehabt und eine Schreibfeder, genau wie unser Gerichtsschreiber hier.“
Der Genannte schreckte auf. Marie stimmte eifrig zu. „Die Tinte war aber aus Blut.“
„Und dann musstest du dich dem Teufel verschreiben?“
Marie schüttelte den Kopf. „Ich kann doch noch nicht schreiben.“
Die Herren sahen einander fragend an und tuschelten, bis es Marie langweilig zu werden begann. Sie überlegte, was sie noch erzählen sollte, womit sie ihre Heimkehr hinauszögern könnte. Keineswegs war ihr der Glanz in den Augen dieser Mächtigen entgangen, während sie ihr so aufmerksam zugehört hatten. Marie wünschte sich, dass sie ihr noch mehr Glauben schenkten, ja, ein wahrer Heißhunger darauf breitete sich in ihr aus.
Die Herren konnten sich nicht einigen. Ihre Stimmen wurden lauter, und Marie hörte heraus, dass sie von ihrer Großmutter sprachen. Sie überlegte, wo die Großmutter wohl sein mochte und was das alles überhaupt für ein merkwürdiges Spiel sein sollte. Aber solange sie Spaß daran fand, wollte sie gern mitmachen. Nun sprachen sie auch von ihrem Vater. Marie erinnerte sich, dass er plötzlich viel mehr geredet hatte als sonst. Als beide Herren neben dem in der Mitte meinten, man solle sie doch gleich nach Hause schicken, zu ihrem Vater, der dem Pfarrer arglos erscheine, verzog Marie das Gesicht und lauschte, was der Herr in der Mitte darauf sagen würde.
Missmutig vernahm sie, dass er dem Vorschlag zustimmte, weil sie ein armes Opfer sei, noch dazu als Mägdlein besonders leicht verführbar. Man könne sie aber bestimmt wieder auf den richtigen Weg zurückführen. Sie sei ja noch so klein.
Marie wusste, dass Kinder Erwachsenen niemals ins Wort fallen durften, aber sie kam nicht umhin, die Stirn zu krausen. Offenbar hielt sie nicht nur der Vater für arm und ängstlich, nur weil sie ein Mägdlein war. Zornig stampfte Marie auf, so dass die hohen Herren aufsahen, und funkelte sie an. Wenn sie schon kein Bub sein konnte, dann nicht einfach nur ein Mägdlein – dann wenigstens eine Hexe.
Im Nebenraum wartete die Großmutter auf ihre Vernehmung. Still horchte sie in sich hinein und glaubte, Stimmen zu hören, auch die ihrer Enkelin – auffallend lange nur ihre. Sie fragte sich, ob Gott ihr durch die altersschwachen Ohren zusätzliche Pein ersparen wollte und ob der junge Scherge an der Tür etwas verstünde. Sorgsam vermied er jeden Blick zu ihr, obwohl er sie nicht aus den Augen lassen sollte. Die Alte fragte ihn nichts. Sie spürte, dass sie keine Antwort bekäme.
Je länger sie so saß und wartete, umso mehr festigte sich ihr Glaube, dass der Teufel Marie nur als Werkzeug benutzte, um sie, die Großmutter, endlich doch noch einzufangen nach all den Jahren. Offenbar hatten die Schilderungen der Vergangenheit am Kaminfeuer sowie das eindringliche Beten nicht ausgereicht. Furchtsam kreisten ihre Gedanken um die Frage, ob etwa ihr eigener Glaube zu schwach gewesen sei – wie damals, als das Verhängnis seinen Lauf genommen hatte. Um wie viel stärker hätte er jetzt sein müssen, nachdem die körperlichen Kräfte täglich mehr nachließen? Wichtige Einzelheiten konnten ihren Augen entgangen sein. Womöglich hatte das Kind nicht ordentlich die Hände gefaltet beim Beten, sondern stattdessen mit seinem Schürzenzipfel gespielt.
Die Greisin betrachtete den Wächter an der Tür, faltete ihre Hände und murmelte lauter als üblich das Vaterunser, nachdem der Bursche immer noch nicht gewillt war, sie zu beachten. Er sollte nicht nur hören, dass sie betete. Er sollte es sehen und allen anderen kundtun, welch gottesfürchtige Frau sie war.
Sie wusste nicht, wie viele Vaterunser sie gesprochen hatte, als man sie endlich abholte und nach nebenan führte. Dort saß der hohe Rat mit dem inzwischen zurückgekehrten Herrn Pfarrer beisammen, etwas abseits ein junger Herr, den das Handgelenk schmerzte – der Gerichtsschreiber.
Die Beschuldigte wurde zur Anklagebank geführt, hielt weiterhin ihre Hände gefaltet und versuchte, sich im Raum zu orientieren. „Bitte, wohlweise Herren, was ist mit meiner Enkelin?“
Die Beratschlagenden hoben die Köpfe und sahen die Frau an, als habe sie einen Zauberspruch auf sie losgelassen, was ihr Gelegenheit zum Weiterreden einräumte. „Sie weiß nicht, was sie sagt, ist doch nur ein unvernünftiges Kind. Der böse Feind muss sich ihrer bemächtigt haben, obwohl ich wohlweislich vorgesorgt hab in all den Jahren.“ Sie warf einen Blick zur getäfelten Decke. „Gott ist mein Zeuge.“ Bei den letzten Worten war sie aufgestanden, fühlte sich von Schwindel befallen und setzte sich, ehe sie das Gleichgewicht verlor.
Den Männern war nichts entgangen. Lammer sprach ein Gebet, und die anderen stellten ihr Getuschel ein. Der Vogt deutete auf die Frau. „Meine Herren, seht, dass die Angeklagte nicht aufrecht stehen kann, wenn sie Gottes Namen missbraucht. Er warf sie soeben auf ihren Platz zurück, als Zeichen ihrer Schuld. Ein Werkzeug war das Kind in ihren Händen.“
Die Alte, erschöpft vom ungewohnt lauten Reden, murmelte kopfschüttelnd vor sich hin. Der Schultheiß neben dem Vogt ließ durch seine blecherne Stimme verlauten, was sich die anderen fragten. „Was murmelt sie, was wir nicht hören sollen?“ Lammer fühlte sich angesprochen, trat zur Anklagebank und zerrte die Greisin hoch. „So treibst du es wohl seit jeher – mit Sprüchen, die an kein rechtschaffenes Ohr geraten dürfen. Sag’, hat nicht die Zauberei eine traurige Tradition in deiner Sippe? Ward nicht einst die Schwester deiner Mutter, welche dich aufgezogen, ebenfalls der Hexerei überführt worden?“
Die Angesprochene verstummte und starrte vor sich hin, als sähe sie das Gesicht des Pfarrers nicht, als sähe sie überhaupt nichts Weltliches mehr.
Unbeirrt fuhr er fort. „Hast du sie nicht selbst damals angezeigt und warst auch noch ein ‚unvernünftiges Kind’, wie deine Enkelin jetzt?“ Während er sprach, umkreiste Lammer die Angeklagte, blieb endlich hinter ihr stehen und sah ihr über die herabhängende Schulter von der Seite her ins Gesicht. Sein Ton hatte sich dermaßen erhoben, dass sein Speichel Wange und Stirn der Bedrängten traf. Schwankend wahrte sie ihr Gleichgewicht, verkrampfte die Finger ineinander und erschrak insgeheim – nicht, weil sie wieder dieses Jucken und Brennen im Gesicht ertragen musste. Schuld daran war der Zorn, der in ihr aufwallte, ihr stummes Gebet durchdrang und es wahrhaftig zu einem Fluch werden ließ. „Neun Jahre zählte ich damals.“ Ihre Stimme klang heiser. „Nicht erst fünf wie das Mariele. Ich hab sicher gewusst, dass meine Tante mich verführt hat, dass ich schuldig durch sie geworden bin. Mein Lebtag hab ich dafür bezahlt und gebüßt, hab mein einziges überlebendes Mägdlein verloren, als es im Kindbett lag. Nur das Mariele hat Gott mir gelassen. An ihm hab ich alles wiedergutmachen wollen.“
Lammer trat einen Schritt beiseite und ließ zu, dass die Alte sich wieder setzte. Ihre Beteuerungen drohten ihn selbst innerlich zu erschüttern, und Vogt, Schultheiß sowie Apotheker standen ihm nicht bei mit ihrem ratlosen Schweigen. Sogar die Feder des Schreibers verstummte.
Unruhig trat der Geistliche von einem Bein auf das andere. „Nur Gott kann uns zeigen, ob du uns nicht auf Irrwege führen willst.“
Schlagartig fand auch der Vogt seine Stimme wieder. „Weil das gütliche Verhör nichts zutage bringt, was für die Unschuld der hier anwesenden Beklagten spricht, muss sie also peinlich verhört werden.“ Er schaute zu Lammer und seufzte ausgiebig. „Allerdings halte ich es in Anbetracht ihres fortgeschrittenen Alters für möglich, dass bereits eine Nacht im Hexenturm genug Tortur für sie bedeutet, um jegliches Leugnen abzulegen. Überdies soll man sich während der bevorstehenden Osterfeierlichkeiten nicht zu viel mit ihr beschäftigen und sie dadurch etwa hervorheben.“ Er nahm die Greisin ins Visier. „Es sei ihr geraten, sich alles noch mal gut zu überlegen und sich nicht selbst das Strafmaß durch hartnäckiges Leugnen und Nasführen des Gerichts unnötig zu verschärfen.“
Durch den rückwärtigen Ausgang des Rathauses, um zu viel Aufsehen zu vermeiden, wurde Maries Großmutter von ihrem Türwächter und einem älteren Schergen die Turmgasse hinauf zum Hexenturm geschleppt. Sie führten sie über eine enge Treppe in eine Zelle und drückten sie nieder auf dünn dahingeschüttetes Stroh, um ihr die Ketten anzulegen.
Karl, der Jüngere, hatte erst kürzlich seinen Dienst angetreten und sah dem erfahrenen Hans-Peter zu. Der stieß die Frau, weil sie nicht schnell genug in die Knie ging, und las Mitgefühl in den Augen des Jüngeren. „Spar’ dir dein Mitleid für die Opfer auf. Oder willst du etwa zu ihr halten?“
Karl schüttelte erschrocken den Kopf.
Fachmännisch schloss Hans-Peter ihr die Ketten um Hand- und Fußgelenke. „Glaub’ mir, das sieht nur grausam aus, hat mich anfangs genauso entsetzt. Und am Ende gestehen sie doch alle, die auch.“
Karl nickte und dachte an sein Weib, mit dem er sich erst kürzlich vermählt hatte. Auch sie lebte hier in dieser Stadt und könnte ein Opfer neu aufflammender Hexerei werden. In diese Vorstellung steigerte er sich dermaßen hinein, dass Hans-Peter ihn zweimal ansprechen musste, ehe er reagierte. „Das Brot und den Wasserkrug!“
Karl reichte ihm beides, stellte sich an das Gitterfenster außerhalb der Zelle und wartete. Erst als er ein Stöhnen hinter sich vernahm, kehrte er um.
Hans-Peter kniete neben der Alten und prüfte nochmals die Fesseln. „Was starrst du mich so an?“ Er stand auf, stellte Brotkorb und Wasserkrug in eben noch erreichbare Nähe und schloss die Zelle hinter sich ab. „Du lernst es noch.“
Der junge Mann am Fenster nickte wenig überzeugt, warf einen letzten Blick durch das Eisengitter auf die Eingekerkerte und folgte dem anderen nach draußen. ‚Die sieht fast aus wie tot, obwohl sie die Augen offen hat’, dachte er bei sich. ‚Aber Hexen verstellen sich gut.’ Das hatte er schon als Kind in seiner Heimatstadt Tübingen gehört.