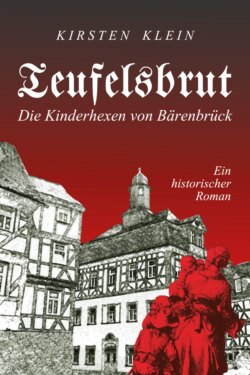Читать книгу Teufelsbrut - Kirsten Klein - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеBarbara wartete, bis ruhige Atemzüge im Raum bezeugten, dass allgemeine Nachtruhe eingekehrt war. Dann stand sie leise auf, zog Kleid und Mantel über und tastete sich durch die Dunkelheit zum Fenster. Vorsichtig öffnete sie die Läden und ließ langsam Luft und Mondlicht einströmen. Beim Rauschen flatternder Flügel fuhr sie herum und hätte das Fenster beinahe wieder geschlossen. Aber es war keiner aufgewacht, auch Michael nicht, der vorhin auf dem Heimweg von der Weide erst noch behauptet hatte, er bemerke immer, wenn sie sich wegschleiche. Barbara lächelte schelmisch in sich hinein und sah den Krähen hinterher, wie sie als schwarze Wolke den nachtblauen Himmel verdüsterten und einen kahlen Baum zurückließen. Als sie vorhin begonnen hatten, sich dort zu sammeln, musste Barbara an Marie denken, die letzte Nacht zwischen einem Krähenschwarm mit ihrer Großmutter zum Hexensabbat geflogen sein wollte. Besorgt hatte sie dem Kind immer wieder eingeschärft, auch heute, keine solchen Geschichten mehr zusammenzuspinnen und niemandem zu erzählen, dass sie nachts auf der Weide tanze. Eigentlich hatte sie noch weiter mit der Kleinen darüber reden wollen, war aber von Michael unterbrochen worden. Der Bruder gängelte sie damit, dass er dem Verbund der Knaben angehörte, und meinte, sie solle es selbst nicht übertreiben mit ihrer Tanzerei in der Spinnstube. Barbara hockte sich auf das Fenstersims, schwang beide Beine hinüber und sprang hinab auf den Lehmboden. Dann stellte sie sich auf die Zehenspitzen und lehnte behutsam die Fensterläden an. Ein Flüsterton, den sie erst für in den Zweigen wispernden Wind gehalten hatte, ließ sie herumfahren. „Franz“, zischte sie. „Warum kommst du hierher? Wenn uns nun doch einer sieht?“ Der Mann, durch seine knabenhafte Figur in der Dunkelheit verjüngt, schüttelte den Kopf. „Ich hab Acht gegeben, kann dich ja nicht allein durch die Nacht in die Spinnstube gehen lassen. Dahin wolltest du doch – um mich zu sehen, oder?“
Barbara verkniff sich mühsam ein Lachen. „Nacht – wir sind gerade erst schlafen gegangen. Und – bist du so sicher, dass ich wegen dir dorthin wollte?“
„Nur wegen mir.“ Franz umfasste ihre Taille. „Du hast mir ja schon deutlich gezeigt, dass du mir gehören willst. Ich will mich endlich offen zu dir bekennen, wie es einem ehrsamen Mann gebührt. Sie wissen doch längst über uns Bescheid.“
Barbara zog ihn weg vom elterlichen Haus. „Und wenn sie es nicht billigen?“ Sie entwand sich seiner Umarmung und warf scheue Blicke ins Dunkel. „Vielleicht sollte ich doch besser zurückgehen. Knaben wie mein Bruder sorgen mich nicht. Aber du weißt doch auch, wie die Burschenschaft mit solchen umspringen kann, die sich nicht lieben sollen, oder ist es anders dort, wo du herkommst?“
Er schüttelte den Kopf. „Gewiss nicht. Bei uns würde es auch keinem gefallen, wenn ein fremder Geselle den Angestammten eine Jungfer wegnähme, noch dazu...“ Er hielt inne, musterte Barbara begierig und räusperte sich verlegen, als sie sich seinen Blicken zu entziehen trachtete.
„Vielleicht kann uns die alte Trine helfen“, überlegte sie. „Sogar der Herr Pfarrer, der immer gemeint hat, die Spinnstube sei eine Lasterhöhle, billigt sie, seitdem Trine hinter ihrem Spinnrad über die Tugend wacht. Er hält große Stücke auf sie. Wenn wir Trine um Fürbitte beim Herrn Pfarrer bitten würden?“
Franz lachte auf. „Fürbitte – das klingt ganz nach altem Aberglauben, wird dem Herrn Pfarrer wohl gefallen.“
„Sprich nicht in solch spöttischem Ton von ihm.“ Barbara wandte sich ab. „Wir wollen hingehen, aber nicht gemeinsam. Geh’ du besser voraus.“
„Und du kommst auch wirklich nach? Nein, weißt du was“, fuhr er fort, ehe sie antworten konnte, „geh’ du vor, damit ich besser auf dich achten kann.“
Barbara nickte und drückte sich im Schutz vorspringender Giebel, die im Mondlicht ihre Schatten auf die Gasse warfen, an den Wänden entlang bis zum Eckhaus, wo die Spielmannsgasse in der Büßergasse endete. So ging sie weiter, die Büßergasse entlang zur Täuferbrücke, und warf dauernd Seitenblicke auf geschlossene Fensterläden, durch deren Ritzen Kerzenlicht schimmerte. Alle Sinne höchstgeschärft, erschrak sie manchmal durch die Schritte hinter ihr, dachte nicht an Franz. Auf der anderen Uferseite, nachdem sie vom nördlichen Rest der Büßergasse ins Neue Kirchgässle abgebogen und ein paar Schritte gegangen war, rannte er an ihre Seite und hielt sie an. Wie ein Fremder fühlte er sich einen Moment lang von ihr angesehen. „Warte, ich mag dich da nicht allein hineingehen lassen.“
„Warum? Was soll mir schon geschehen? Du wartest hier ein Weilchen und kommst dann langsam nach.“ Ehe er widersprechen konnte, ließ sie ihn stehen, raffte ihren Mantel und rannte an der Mauer entlang bis zum ersten Haus. Dort wich die Gasse von der Mauer ab und schlängelte sich zwischen eng stehenden Bauten hindurch. Drei Häuser weiter verschwand Barbara auf der Uferseite hinter der Türe zur Spinnstube.
Gelächter und munteres Geschwätz belebten die ruhende Stadt, bis die Tür hinter der jungen Frau ins Schloss gefallen war. Vorher schon suchten Barbaras Augen die hochbetagte Trine vergebens auf ihrem gewohnten Platz in der Ecke. Als wollte sie es nicht glauben, ging Barbara auf das verlassene Spinnrad zu und stolperte beinahe über einen Schemel.
Übermütig lachend tanzten zwei junge Paare an ihr vorbei. Sie wollte gerade wieder hinaus gehen, aber ein etwa gleichaltriges Mädchen, das mit anderen auf einer Bank am Kachelofen saß und stickte, hörte auf zu schwatzen und rief sie herbei. Barbara setzte sich daneben, hörte aber kaum zu, sondern suchte die Stube nach Trine ab. Überall hatten sich junge Burschen zu nähenden oder Flachs spinnenden Frauen und Mädchen gesellt. Nur oberflächlich betrachtet, wuchsen hier unter zartfühlenden Händen Bekleidungsstücke oder Tischdecken heran. Eifriger wirkten Augen und Lippen.
Barbara überlegte, ob sie das zum ersten Mal so empfand – jetzt, nachdem sie Trine nirgends entdecken konnte. In ihre Gedanken hinein öffnete sich die Tür. Zu spät bemerkte Barbara, wie augenfällig sie Franz ins Gesicht sah, als er eintrat. Wenigstens die Frauen auf der Bank mussten es mitbekommen haben. Beschämt und noch auffälliger senkte Barbara den Kopf. Franz hingegen hielt nach ihr Ausschau und schien sie nicht zu entdecken. Als sie den Kopf wieder hob, war er hinter Vorbeitanzenden verschwunden, die ihr ausgelassenes Gelächter entgegenschleuderten.
„Wo ist die alte Trine heut’?“
Eine der Schwatzenden neben ihr beäugte Barbara eingehend. Schon wollte sie die Frage wiederholen, als die Angesprochene dann doch antwortete. „Ja, weißt du das noch nicht? Die wacht doch bei ihrer Enkelin am Kindbett. Das Kleine hat nämlich der Teufel mitgenommen.“
„Hör’ auf“, fuhr eine andere Frau dazwischen, „red’ nicht so unsinniges Zeug daher.“
Barbara mühte sich zu verstehen, was diese Frau nun sagte, denn die Geräuschkulisse der Stube schwoll an. Zu ihrer mäßigen Erleichterung hörte sie etwas von einer stattgefundenen Nottaufe heraus. Von einem verstorbenen Säugling zu erfahren, war beinahe alltäglich, aber gerade jetzt erschien das Barbara wie ein böses Omen. Ein junger Bursche stand plötzlich vor ihr und zog sie an den Armen so überraschend schnell hoch, dass sie verdutzt aufstand.
„Los, komm, tanzen!“
Sie schüttelte den Kopf und wollte sich wieder setzen, aber er zerrte sie von der Bank fort. „Du stickst doch da sowieso nicht mit. Ich hab’s genau gesehen.“
Barbara dachte an Franz, als der Bursche sie wie eine Puppe durch die Stube führte. Sie schaute sich um und suchte sein Gesicht unter all den im Alltag so bekannten und jetzt so fremden.
„Bist nicht oft hier“, stellte der Bursche fest und drückte sie derb an sich. „Bist wohl lieber an verschwiegenen Plätzen, aber auch nicht ganz allein. Glaub’ bloß nicht, dass man dort immer ungesehen bleibt. Wer’s heimlich tut, der’s Unrecht sucht.“
‚Ich hab kein Unrecht getan’, dachte Barbara, brachte aber nichts heraus. Erneut musste sie an das tote Kind von Trines Enkelin denken. Dabei war ihr, als könnte der Herr Pfarrer doch recht damit haben, wenn er in der Spinnstube eine Lasterhöhle vermutete. Düsterer als sonst erschien sie ihr plötzlich, viel zu düster zum Spinnen und Sticken. Mit einer Kraft, die den Burschen überraschte, riss Barbara sich von ihm los, so dass er ihr nur verblüfft nachsehen konnte.
Wie ein Vogel im Käfig, der mit seinen Flügeln überall anstößt, torkelte sie durch den Raum und traf auf missbilligende Gesichter. Sie brachte selbst kein Wort heraus und wünschte doch, jemand würde etwas zu ihr sagen, irgendwas. Aber ringsumher las sie nur Anklage aus stummen Mienen.
„Bärbel, Bärbel, ich bin’s!“ Franz musste sie erst an den Schultern rütteln.
„Lass uns gehen, Franz, schnell.“ Barbara sah, dass seine Stirn von aufgekratzten Pickeln übersät war, klammerte sich an seinen Ärmel und zog ihn zur Tür.
„Jetzt gleich – zusammen? Das wird auffallen.“
Sie achtete nicht auf das, was er sagte, strebte nur fort. Erst dort, wo das Neue Kirchgässle wieder die Ufermauer entlangführte, konnte er ihr Einhalt gebieten. Sie atmete hastig, und ihr Herz flatterte. „Franz, wohin warst du so lange verschwunden?“
„Zwei aus der Burschenschaft haben mich nicht mehr zu dir lassen wollen und mit allerlei Fragen bedängt.“
„Franz, bring’ mich schnell heim, bitte. Ich hab so ein scheußliches Gefühl.“
Der Mann trat von der Ufermauer weg und warf einen Blick zurück. Er glaubte, dass eben die Tür zur Spinnstube zufiel, verschwieg es aber Barbara. „Wir hätten uns nicht so rasch davonmachen sollen. Das missfällt ihnen erst recht.“
Barbara war inzwischen weitergegangen. „Ich hab es nicht mehr ausgehalten, Franz. Sie haben alle so merkwürdig auf mich geschaut.“
„Das gehört zu ihrer Prüfung“, erklärte Franz. „Sie wollen sehen, ob du ihren prüfenden Blicken standhalten kannst. Wenn nicht, so werten sie das als Zeichen für ein schlechtes Gewissen.“
„Komm schneller Franz. Mir wird immer banger zumute.“
„Nicht laufen, Bärbel. Das wirkt gerade verdächtig, oder musst du ein schlechtes Gewissen haben?“
Das junge Mädchen blieb stehen. „Ach, urteile selbst, ob ich eines haben muss. Du warst ja bei allem dabei.“
Franz ließ besorgte Blicke die Fachwerkfassaden entlangschweifen, die den Marktplatz umschlossen, aber nirgendwo schien sich etwas zu rühren. Die Häuser hatten ihre Augen fest verriegelt vor der Außenwelt, und alle Kerzen waren gelöscht. Trotzdem – Barbaras ungutes Gefühl steckte ihn an, und er schaute auch in die klaffende Lücke zweier Häuser. „Franz, mir ist, als wollten diese feinen Häuser auf mich herabstürzen.“
„Dir ist nur schwindlig von der Aufregung, Bärbel.“ Er wollte sie stützen, doch sie wehrte ab. „Gib’ ihnen nicht noch mehr Nahrung für schlechte Gedanken.“
„Es ist niemand da, Bärbel. Keiner sieht uns.“
„Es ist immer jemand da, der einen sieht.“ Sie deutete zurück auf die Lücke zwischen den Häusern.
„Das ist nur das Vieh unten im Stall, Bärbel.“
„Mag sein“, räumte das Mädchen ein. „Vielleicht hat es aber auch was gehört und ist erschrocken.“
Begleitet von gemischten Gefühlen, bogen sie wieder in die Büßergasse ein und gingen auf die Brücke zu. Barbara blieb stehen. „Ich trau’ mich nicht weiter durch die finstere Gasse. Ich höre schon wieder was.“
Franz redete ihr zu. „Wir sind doch gleich drüben. Es ist nur der Fluss, der dir in den Ohren rauscht.“
„Und wenn...“ Barbara schüttelte den Kopf. „Ich muss plötzlich daran denken, wie ich damals hier mit dem Vater durchgelaufen bin, an seiner Hand dem Wagen mit dem Verurteilten nach. Ich war noch so klein, und so war mir nicht klar, was geschehen würde. Zuerst hab ich nur auf die wunderschön glänzenden, roten Pluderhosen des Scharfrichters geschaut und dann – auf dem Richtplatz , waren sie bespritzt vom Blut.“
Franz nickte. „Ich hab so was auch schon einmal miterlebt, als ganz junger Bursche. In die erste Zuschauerreihe hab ich mich gedrängelt. Als mir dann übel geworden ist, wollte ich es den anderen Burschen nicht zeigen und hab mich heimlich davongemacht. Die Leute haben später viel erzählt, dass sie den Scharfrichter beinahe niedergemetzelt hätten. Ein Stümper soll er gewesen sein und auch noch zu viel Geld gekostet haben.“
„Sei still Franz. Mit Reden über solche Scheußlichkeiten könntest du dich bei meinem Vater einschmeicheln. Der führt sie gern abends im Wirtshaus, wie ich gehört hab.“
„Du als Jungfer brauchst sie dir ja nicht anzuhören.“ Er griff nach Barbaras Hand. „Nun gehst du geschwind mit mir hier durch.“
Von der Mauer verborgen, gluckste und rauschte das Wasser. „Dorthin gehen wir, von wo er gekommen ist“, bemerkte Barbara. „Fast alle kommen sie von drüben, die Spitzbuben. Hörst du Franz, das Wasser flüstert.“
„Still Bärbel, jetzt ist es nicht das Wasser.“ Der Mann verharrte und verlangte seinen Augen ab, die Unebenheiten des Mauerwerks zu erkennen. Im fahlen Mondlicht schien es ihm, als habe sich dort ein Schatten abgezeichnet.
Barbaras Knie zitterten. Ein Eindruck blitzte in ihr auf. Nur einmal hatte sie sich damals von den Pluderhosen des Scharfrichters losgerissen und hoch zum Wagen geschaut, worauf der Delinquent mit zitternd eingeknickten Knien stand.
Sie drängelten, schoben einander und rückten voran. Sie brüllten sich ihre Stimmen heiser und sprühten sich ihren Atem in die Nacken. Das Mondlicht hatte ihre schäbige Kleidung verzaubert, breitete über alle seinen Silberschleier aus glitzernden Punkten. Und inmitten dieser Armee silberner Kämpfer war er, Martin Heiliger, um sie, seine Bärbel, zurückzuerobern.
Grausam hatte man sie ihm entrissen. Immer seltener konnte sie für kurze Zeit ihrem neuen Herrn entfliehen und zu ihm kommen, doch war sie niemals mehr dieselbe. Ein anderes Licht brannte in ihren Augen und trieb sie bald wieder fort. Nie sprach sie davon, wie es sich eben nicht ziemt, solches in den Mund zu nehmen. Sie sprach die vertrauten Worte und sang die gleichen Lieder. Aber wenn kein anderer es hörte – er hörte es heraus, das Verlangen nach dem Bösen. Martin wusste, sie selbst trug keine Schuld daran, denn wie hörte er die Erwachsenen reden: „Das Weib ist schwach und verführbar – dem Teufel untertan.“
Nun war Martin ausgezogen, um sie zu retten, und die ganze Stadt stand ihm bei. Noch war es Zeit, noch hatte sie den Bund nicht geschlossen. Doch als wäre sie sein Weib, sah er sie plötzlich neben ihrem Verführer stehen und erkannte ihn. Sah sie denn nicht, mit wem sie da ging?
„Bärbel!“, rief Martin, „kehr’ um zu mir.“ Wie kräftig seine Stimme klang, wie die eines erwachsenen Mannes. Und dennoch schien sie ihn nicht zu hören, sah nicht einmal in seine Richtung. Seine Gefolgsleute begannen die Trommeln zu schlagen, die Sackpfeifen zu blasen und die Schellen zu schütteln, dass die Stille der Nacht zerriss. „Bärbel!“, schrie Martin und erschrak. Seine Stimme – sie war wieder die Stimme eines Knaben. Der Teufel musste sie verzaubert haben. Martin verstummte. Er glaubte gefallen zu sein, richtete seinen Oberkörper auf und lauschte dem Getöse, das durch seine Ohren schrillte. Ein Schnarchen und Stöhnen mischte sich hinein. Neben sich sah Martin jemanden liegen und erkannte den Hausknecht. Der war also auch mit dabei, obwohl er sonst nie zu ihm hielt, ihn gar nicht ernst nahm.
Martin sah sich um. Wo war der Mond – und Bärbel, seine Bärbel? Er konnte sie nicht mehr sehen, auch nicht ihren Verführer. Aber er hörte doch noch die Trommeln, die Pfeifen, die Schellen. Er hatte nicht alles geträumt.
Martin stand auf und tappte verschlafen zum Fenster. Ausgesperrt war das Mondlicht, zwang nur dünne Strahlen zwischen den Latten der Läden hindurch. Martin entriegelte sie, stieß sie auf und beugte sich in die einströmende Lichtflut. Sein Körper glühte noch vom Traum, und so spürte er die Kälte der Aprilnacht nicht.
Er sah hinüber zum Nachbarhaus. Dort stand seine Bärbel auf der Gasse, vor dem Fenster zu ihrer Schlafkammer. Er erhaschte nur einen Arm oder eine Wade von ihr, eine wehende Locke. Um sie herum tanzten und lärmten die selbsternannten Musikanten, verborgen unter grellen Masken. Von der Büßergasse über die Täuferbrücke waren sie gekommen und in Martins Traum eingedrungen.
Er glaubte seine Bärbel jammern zu hören. Er wusste, dass ihr jämmerlich zumute sein musste bei dieser Schmach. Er fühlte sich hilflos, wie damals.
Auch damals hatte er ihr nicht helfen können, war erst recht kein wackerer Befreier gewesen, nur ein kleiner Junge, kaum den Windeln entwachsen. Vor dem Haus hatte er neben ihr in der Sonne gekauert, seine Füße wie ihre grau vom Straßenstaub. Unbeholfen hatten seine schmierigen Hände über ihr Haar gestrichen, das zottelig vom Kopf abstand. Die Mutter hatte es zuletzt gekämmt, so energisch, dass im Kamm anschließend Haarbüschel zwischen den Zähnen steckten.
Zärtlich streichelte Martins Kinderhand, und irgendwann hörte Bärbel tatsächlich auf zu schluchzen, hob den Kopf, nahm seine beiden Hände zwischen ihre und betete mit ihm. So tröstete sie am Ende wieder ihn.
Ihre Mutter sei in die Glutach gestürzt und ertrunken, hatte man der Zwölfjährigen erzählt und mit jedem Wortschwall Mitleid über sie geschüttet. Damals verstand das Mädchen noch nicht, weshalb einige dieses Mitleid mit dem Ton der Verachtung würzten. Sie wusste nicht, dass ihre Mutter denselben Ton in der Stimme der Leute vernommen zu haben glaubte, viel früher schon allerdings, und dass sie ihn endlich nicht mehr ertragen hatte.
Dabei war Barbaras Mutter einem unheilvollen Trugbild erlegen, denn niemand erahnte auch nur, was ihr im letzten Kriegsjahr widerfahren war. Mit ihrem Schicksal, das sie wie jede züchtige Frau verbarg, stand sie keineswegs allein. Nicht nur ihr Mann hatte sich unter dem Bett versteckt, als plündernde Soldaten ins Haus einbrachen, seinen so peinlich gehüteten Frieden störten und jede auffindbare Weibsperson schändeten.
Barbaras Mutter hatte sich immerhin noch etliche Jahre durchs Leben geschleppt, bevor sie ausgerechnet am abschüssigsten Uferteil wusch und strauchelte.
So saß also am Tag nach diesem Unglück Martin neben Barbara, an das graue Gemäuer gelehnt, und ließ sich von ihr trösten – wie noch oft. Martin bedurfte ebenfalls des Trostes, und auch an seinem Elend war der Krieg nicht schuldlos, obwohl die Obrigkeit ihn Jahre vor seiner Geburt beendet hatte. Sein Vater, einst ein vermögender Bauer vor den Toren Bärenbrücks, hatte Kriegsgewinnlern seinen Boden billig überlassen müssen und verdingte sich fortan als Tagelöhner. Als Martins Geburt nahte, suchte er lange vergebens eine Hebamme – zu lange. Sein tüchtiges Weib musste er nun gegen einen hilfsbedürftigen Säugling tauschen. Neben Barbara, deren zu selber Zeit geborene Schwester nach erfolgter Nottaufe starb, wuchs Martin wie ein Bruder heran. Ihre Mutter verrichtete Ammendienste an ihm, bis er feste Nahrung zu sich nehmen konnte. Dann wurde Barbara als Kindsmagd verliehen und schleppte den Kleinen bei allen Arbeiten, die sie sonst noch verrichten musste, mit sich herum.
Die äußeren Spuren des Krieges verblichen nur allmählich. Heute noch konnte Martin, wenn er sich weit genug aus dem Fenster beugte, Narben im Mauerwerk sehen.
Jetzt war nur Barbaras Jammern aus der Vergangenheit in ihm aufgeblitzt. Warum war er immer noch nicht groß und mächtig genug, um ihr zu helfen, sie aus der Pein zu befreien? Fest entschlossen war er gewesen, sie später zu heiraten, doch Barbara entwuchs ihm schneller und schneller. Er hielt nicht mit ihr Schritt. Könnte sie doch nur einhalten und ein Weilchen auf ihn warten.
Wenn Martin jetzt auch mit ihr litt – einerseits waren diese Burschen und Knaben seine Helfer, denn sie halfen, über Barbaras Tugend zu wachen. Andererseits war er erstmals erleichtert darüber, dass er erst zwölf Jahre zählte und somit noch nicht zu ihnen gehören durfte. Wie hätte er mithalten können, ohne seine Bärbel zu beschimpfen? So wie dieser elende Verführer sie verblendet hatte, sah sie ihn, Martin, überhaupt nicht mehr. Wie könnte er sie bloß wieder auf sich aufmerksam machen?
Während Martin so überlegte, sah er sie plötzlich aus dem Kreis ausbrechen, der sie vor dem Haus umtanzte. Zwei hatten eine zu große Lücke zwischen sich gelassen.
„Bärbel!“ schrie Martin, doch seine heisere Bubenstimme erstickte im Schellengerassel. Einen Augenblick lang war ihm, als werfe sie einen Blick zu seinem Fenster hinauf, als renne sie auf ihn zu. Burschen wollten ihr nachsetzen, wurden aber von den anderen zurückgepfiffen. Missmutig grölten sie ihr hinterher, bis sie um die Ecke im Ehgraben verschwand.
Längst hätte ihr Vater durch den Lärm erwachen müssen. Hoffentlich hatte er wenigstens die Hintertür für sie aufgeschlossen.
Was geschah mit dem Verführer? Martin hatte noch Barbaras Gesicht vor Augen, als sie ihm entgegen zu rennen schien. Nur das Weiß ihrer Augäpfel sah er aufblitzen, als wäre ihr übriges Gesicht vom Nachtdunkel verschluckt worden.
War das wirklich seine Bärbel? Martin sah zu, wie die Burschen den Verführer packten und hoch über ihre Köpfe stemmten. Erbost gellte sein Schrei durch die Nacht. Ja, sollte er doch schreien. Gar nicht mehr menschlich klang das. Martin gelangte mehr denn je zu der Überzeugung, dass nur der Teufel so böse sein konnte, ihm seine Bärbel wegzunehmen.
Siegreich machten sich die Burschen mit ihrer Beute davon, und Martin schloss vorsichtig die Fensterläden. Nachdem sich seine Augen an das schummrige Licht in der Schlafkammer gewöhnt hatten, gewahrte er, dass der Knecht immer noch schlief, unbekümmert vom Tumult. Lahmgelegt von abendlicher Zecherei, waren seine Gedanken für alles unempfänglich, was von außen einströmte.
Martin merkte jetzt, dass er fror und schlüpfte unter die grobwollene Decke.
Früher hatte er oft neben seiner Bärbel geschlafen, dicht aneinandergekuschelt, nicht allein der Wärme wegen, immer weniger deswegen. Er schob seinen Kopf unter ihr Kinn, schmiegte ihn an ihren Hals und lauschte dem Pochen ihrer Schlagader. Beruhigt rieb er seine Stupsnase an ihrer samtenen Haut und schlief ein – früher schnell, dann allmählich langsamer. Tief rutschte sein Leib, und sein Gesicht vergrub sich zwischen ihren Brüsten in der Mulde, die ihn wie ein Schoß aufnahm, jedes Mal tiefer, als könnte er endlich ganz hineinkriechen. Martin erinnerte sich, und die Sehnsucht nach Bärbels Wärme ließ ihn noch mehr frieren, trotz der Decke. Muffig roch sie, längst nicht mehr nach Bärbels Haut und Haaren, wie nach jeder Nacht, die sie mit ihm verbracht hatte. Meistens war sie schon auf den Beinen, wenn er aufwachte, aber ihr Duft, der blieb noch bei ihm.
In letzter Zeit musste er darum betteln, dass sie bei ihm übernachtete, und seit zwei Wochen half selbst das nicht mehr. Martin lag da und versuchte sich vorzustellen, dass sie gerade erst gegangen wäre und den letzten Hauch ihres Duftes noch hinterlassen hätte gleich einem unsichtbaren Gewand. Doch je mehr er sich anstrengte, es so zu empfinden, umso empfindlicher stach ihn der Fuseldunst des Knechtes in die Nase. Zusätzlich hallte das Geschrei der Burschen durch seinen Kopf, die Trommeln und Pfeifen, die rasselnden Schellen. Er mochte seine Ohren gegen das Kissen pressen wie er wollte – sie wichen erst, als der Hahn schrie.
Anna saß im letzten Abendlicht in der Stube am Fenster und half ihrer Mutter Wäsche ausbessern. Von der Schmiede herüber verkündete der Vater Geschäftigkeit. Jedes Mal, wenn ein Schlag auf den Amboss zu lange ausblieb, horchte das Kind auf und verharrte selbst in der Bewegung.
„Mach weiter, sonst bist du bis Ostern noch nicht fertig.“
Mit dem Zeigefinger fuhr Anna durch ein Loch des Bettlakens, das auf ihrem Schoß lag, und dachte an den Leidensweg des Heilands. Die Sünden aller Menschen hatte er versprochen auf sich zu nehmen – auch ihre? In einer Woche war Karfreitag.
Erschöpft vom Tagwerk strich sich die Mutter über die Lider. „Meine Augen lassen nach. Du wirst bald mehr an Arbeit übernehmen müssen.“
Anna starrte auf ihren Zeigefinger und nickte. „Auch morgens?“ Die Mutter zuckte mit den Schultern. „Wenn es mit mir so weitergeht...“ Versonnen streckte sie ihre Hände zum Fenster aus. „Die Dreißig hab ich gerade überschritten und seh’ schon aus, als stünde ich am Ufer des Jordans.“
Anna sagte nichts darauf. Sie wusste, dass die Mutter keine Antwort von ihr wollte, wenn sie so redete. Folgsam begann sie, das Loch im Laken zu stopfen. Könnte sie bloß alles, was das Böse in ihr zerriss, auch so zustopfen. Erst vorletzte Nacht hatte dieses Laken ihre Matratze überspannt. Anna wartete ab, doch die Mutter schien ihre merkwürdigen Betrachtungen beendet zu haben und bedachte ihre fleißige Tochter mit mitfühlendem Blick.
„Mutter“, hörte Anna sich fragen, „warum kann man eigentlich nicht alles so heil machen wie dieses Loch?“
„Was willst du denn heil machen?“
„Mich.“ Anna erschrak, denn das Wort war ihr einfach so über die Lippen gerutscht, wenn auch leise.
„Gib Acht, dass du im Kopf nicht verrückt wirst, wenn du solche Fragen stellst. Hast du dich schon wieder in den Finger gestochen? Zeig’ mal deine Hände her.“
Anna hielt der Mutter ihre Hände entgegen, ängstlich zitternd, als könnte sie an ihnen etwas ablesen.
Die Wagnerin ergriff sie und drehte mal Handrücken, mal Innenfläche ins Licht. Ihr Gesicht verdüsterte sich. „Freilich, wenn ich solche Hände noch hätte... Schau mich nicht an, als wäre ich deine Lehrerin und wollte dich schlagen. Schlägt sie dich oft mit dem Stock?“
Anna überlegte. „Nicht öfter als die anderen. Immer dann, wenn man das auswendig Gelernte nicht richtig aufsagen kann. Am schlimmsten ist es, wenn man den Katechismus nicht richtig kennt.“
„Und, kennst du ihn?“
Anna wunderte sich, weshalb die Mutter sich plötzlich für die Schule interessierte. „Ja, schon, nur manchmal kann ich ihn niicht rich-richtig aufsagen.“ Stotternd beteuerte Anna, dass sie den Katechismus fleißig auswendig lerne, weil er das Böse fernhalten helfe. So sage es immer der Herr Pfarrer. Wenn man nämlich alles aus dem Katechismus wisse und verstünde, so müsse das Böse weichen. Anna sah ihre Mutter fragend an.
Sie nickte und wollte wissen, ob der Herr Pfarrer oder die Jungfer Rotnagel sonst noch irgendwas gefragt hätten.
Anna verneinte. Nur, warum sie so lange nicht in der Schule gewesen sei, und darauf habe sie gesagt, dass sie das Vieh habe hüten müssen.
„Sonst hast du nichts erzählt?“
Anna schüttelte den Kopf und sah ihrer Mutter ins Gesicht. Sie wollte sagen, dass sie nichts weiter erzählen konnte, dass ihr die Stimme weggeblieben war. Aber der Mutter war es offenbar recht so.
„Zeig’ mir mal das gestopfte Laken. Soll ich dir nicht doch besser helfen?“ Die Wagnerin wollte danach greifen, aber Anna zog es geschwind an sich. „Lasst nur Mutter, ich bin gleich fertig damit.“ Geschäftig senkte sie den Kopf darüber, damit die Mutter das Misstrauen in ihren Augen nicht sah.
Bei Einbruch der Dämmerung ging Anna hinaus, um das Vieh zu füttern und wollte lautlos um die Ecke zum Stall huschen, im Rücken das vertraute Hämmern. Als es verstummte, blieb sie stehen. Der Vater rief sie. Noch ehe sie sich umwandte, spürte sie seinen Blick auf sich. „Anna, gehst du das Vieh füttern?“
Sie nickte erstaunt. „Ja, Vater.“
„Komm einmal her und schau dir das an.“ Die Hand halb hinter dem Rücken verborgen, stand er da mit feierlicher Miene und unverhohlenem Stolz in der Stimme. Neugierig trat Anna näher. „Wie wär’s, wenn ich dir für dein Schatzkästlein auch so einen schmieden würde?“
Das Mädchen betrachtete ein filigranes Meisterwerk, eingebettet in Vaters fleischgepolsterter Handfläche. Verzückt verlor sich ihr Blick in den unzähligen Schnörkeln des schmiedeeisernen Schlüssels.
„Für den Herrn Bürgermeister“, verkündete der Vater in gewichtigem Ton. „Was meinst du, ich schmiede dir genau den gleichen. Du darfst es aber niemandem weitersagen.“
Anna nickte. „Oh ja, Vater.“ Sie dachte an ihr Schatzkästlein, eine zierliche schmiedeeiserne Truhe, die zwar ein Schloss, bislang aber noch keinen Schlüssel besaß. Der Vater hatte sie ihr vor zwei Jahren geschenkt und gemeint, der Schlüssel dazu käme irgendwann nach. Für Heimlichkeiten sei sie ohnehin noch zu jung, ganz abgesehen davon, dass die Pfaffen solches nicht litten. Geheimnistuereien seien Brutstätten des Teufels, predigte Pfarrer Lammer schon immer von der Kanzel.
Wagner legte den Schlüssel in ein mit Seide ausgeschlagenes Kästchen, und Anna durfte ihn noch eine Weile betrachten. ‚Herr, verschließe mich vor dem Bösen’, betete sie insgeheim, ‚und vor allen, die mit ihm im Bunde stehen.’
Sie erschrak, als dieser Gedanke das Bildnis ihrer Mutter vor ihr inneres Auge rief.