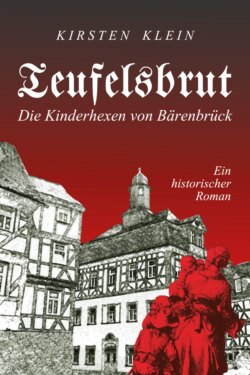Читать книгу Teufelsbrut - Kirsten Klein - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеAnna lag im Bett und wartete auf den Schlaf. Wenn er doch nur käme und sie entführte – weg von ihm, dem bösen Feind.
Die Mutter hatte sie hereingerufen, als sie sah, wie der Herr Pfarrer mit dem Mariele an der Hand nach den Schergen die Täuferbrücke betrat. Offensichtlich fürchtete die Mutter, von irgendjemandem gesehen oder vielleicht angesprochen zu werden.
Anna dachte an Maries Geschichten. Ihr war dabei nicht lustig zumute, aber sie zählte ja zehn Jahre und wusste, dass man mit dem Teufel keinen Spaß treiben durfte, dass er vielmehr welchen mit den Menschen trieb – wie Anna es am eigenen Leib erlebte. Wie gern hätte sie sich jemandem anvertraut, am besten Barbara. Aber die hielt Marie stets vor Augen, wie verloren vor allem ein Mägdlein sei, das sich mit dem Teufel einließe. Dann schämte sich Anna unsäglich und brachte nicht einmal mehr ein harmloses Wort heraus. Es könnten sich ja doch ungewollt ein paar verhängnisvolle darunter mischen.
Ob die Mutter mit dabei war auf dem Hexensabbat? Das Mariele könnte sie gesehen haben und es jemandem sagen. Dieser Beweis würde Anna bestätigen, dass sie ihre Mutter nicht zu Unrecht der Mithilfe des Teufels verdächtigte, und trotzdem wusste sie nicht, ob sie darauf hoffen sollte. Seit Wochen schon hatte Anna das Gebot Gottes übertreten, ihre Mutter zu ehren, und plagte sich mit dieser Schuld herum. Sie kannte alle zehn Gebote, wenn es ihr auch keiner zu glauben schien, weil sie nur stotternd über ihre Lippen kamen – wenn überhaupt, denn Jungfer Rotnagel verlangte dabei immer, dass man ihr in die Augen sah.
Was wohl mit dem Mariele und seiner Großmutter geschehen war? Anna zweifelte nun überhaupt nicht mehr daran, dass es die Wahrheit gesagt hatte, wenn schon der Herr Pfarrer sich seiner annahm. Ob sie die Kleine in den Kerker warfen, in den Hexenturm sperrten? Anna hatte mal irgendwo aufgeschnappt, dass man sogar mit jüngeren Kindern so verfahren würde, wenn kein Zweifel an ihrer Schuld bestand. Und das Mariele war ja obendrein stolz auf seine Abenteuer. Wenn es die Mutter beim Hexentanz gesehen hatte, dann kämen die Schergen bald und führten sie ebenfalls ab, überlegte Anna. Wollte sie das? Sie fürchtete noch mehr schlechte Gedanken und floh in ein Gebet. Allein, es gelang ihr nicht, dem Herrgott zu versichern, dass sie es nicht wollte.
Gekrümmt unter der Decke, wartete Anna noch immer auf den Schlaf. Als er endlich kam, bescherte er ihr Träume, in denen sie wieder auf die Anklagebank musste. Nein, sie sei dem Unhold nicht verfallen, versicherte Anna.
Sie sprach flüssig, und der Richter glaubte ihr. Dann sprach er über das Mariele. Es sei ein garstiges Kind und verbreite Lügen über Annas Mutter. Es behaupte, sie beim Hexensabbat gesehen zu haben. Ja, sie solle sogar geäußert haben, dass sie ihre Tochter in der Walpurgisnacht dem Teufel opfern wolle.
Anna sah das bärtige Gesicht des höchsten Richters über sich, helle Augen unter Brauenbüscheln. Er bedrängte sie. Ob sie etwas davon wisse, ob sie schon beim Hexensabbat gewesen sei. Anna wandte den Kopf beiseite. Das Gesicht kam näher. Der Bart berührte ihren Hals, kitzelte ihr Ohrläppchen. Anna versuchte, den Kopf zu schütteln. Nein, sie wisse von nichts und sei noch nie dort gewesen. Sie wolle auch nicht mit dem Teufel lustig sein. Er, der Herrgott, möge sie vor ihm beschützen.
Doch es war nicht mehr Gottes Antlitz über ihr. Er setzte sie abermals dem bösen Feind aus, um sie zu prüfen. Anna schloss die Augen vor seiner Fratze, presste die Lider zusammen und fand erneut keine Kraft, um ihren Leib zu verteidigen. Ihre Seele entwand sich ihm, stieg auf und war Zeuge dabei, wie der Teufel sein Werk an ihm verrichtete.
Als er fertig war, fand Anna sich wieder in ihrer Haut, streifte ihr Nachthemd herunter und stopfte es zwischen die klebrigen Schenkel. Jetzt, wo er fort war, glaubte sie seine speckigen Finger überall auf ihrer Haut zu fühlen – wie ein Versprechen für sein Wiederkommen. Und ab Walpurgis würde er sie wohl auf ewig bei sich behalten.
Nachdem die Schergen sie verlassen hatten, war Maries Großmutter tatsächlich eingenickt und schreckte erstmals mitten in der Nacht aus dem Schlaf, glaubte, das Mariele säße neben ihr im Stockfinstern und streichle ihr die faltige Wangenhaut. Sie fühlte sich zärtlich getröstet wie nach einem Alptraum, bis ihr bewusst wurde, wo sie sich befand und warum. Sie wollte sich selbst mit der Hand über die Wange fahren, doch die Kette riss sie kurz davor zurück. Darauf versuchte sie, den Kopf der Hand entgegenzubeugen und spürte einen Schmerz durch die Halswirbel bis unter die Haarwurzeln rasen. Sie riss den Kopf zurück, was den Schmerz nur verschärfte. Das Haupt gegen den kalten Mauerstein gelehnt, hörte sie ein Rascheln im Stroh. Sie war tatsächlich nicht ganz allein. Eine Ratte beschnupperte das Brot und knabberte daran. Nachdem die Alte erkannte, welchen Mitbewohner sie hatte, beruhigte sie sich einigermaßen und empfand es beinahe als tröstlich. Eine leibhaftige Ratte konnte sie nun nicht mehr schrecken.
Erst ein Sonnenstrahl weckte die Greisin wieder. Sie blinzelte und lächelte – bis der Schmerz ihre krummgeschaffte Wirbelsäule entlang in den Kopf aufgestiegen war, wo er bohrte, als malträtiere man sie noch immer mit Vorwürfen. Sie lebte also, war nicht erlöst worden vom Heiland.
Von außen drang Glockengeläut zu ihr hinauf in den Turm. Karfreitag musste es sein und die Wiederkehr der Erlösung nahe. Die Alte kniff ihre Augen zusammen. So glaubte sie das Glockenspiel besser in sich aufzunehmen. Auch konnte sie anders dem Licht nicht ausweichen, denn das ließen die Ketten nicht zu. Nach und nach erwachte die Erinnerung an das Verhör in ihrem müden Hirn. Als sie es wie zum zweiten Mal erlebt hatte, marterte sie ein neuer Schmerz – Hunger und Durst. Die nächtliche Besucherin hatte vom Brot nur Krümel übrig gelassen. Die Alte streckte ihre Hand aus und langte nach dem Griff des Tonkrugs. Zwar bekam sie ihn zu fassen, konnte ihn jedoch kaum anheben, schwer wie er war. Wie ein Tier musste sie den Kopf hinunterbeugen und mühsam ein paar Schlucke in sich hineinschlürfen, wobei ihr das Halseisen in die Kehle schnitt.
Draußen läuteten immer noch die Glocken den Karfreitag ein. Alle ehrsamen Stadtbewohner würden jetzt gleich in der Kirche sitzen, jeder nach seinem Rang. Ihr Platz war ganz hinten, beim gemeinen Volk. Trotzdem war es ein ehrsamer Platz im Hause des Herrn. Nun war sie davon ausgeschlossen worden und lag hier im Hexenturm auf einer Schütte Stroh. Gott wusste, dass sie keine Hexe war, und lieber wollte sie Christus, seinem eingeborenen Sohn, nachfolgen in seinem Leid, als jemals die Unwahrheit gestehen und ihren Glauben verleugnen.
„Bärbel, zieh’ nicht so ein Gesicht, dass jeder dir gleich alles ansieht.“ Michael biss die Zähne aufeinander. Angesichts der Leute verkniff er sich weitere Ermahnungen. Durch den Abstand, den er zu ihr wahrte, hatte die Schwester ohnehin nichts verstanden. Also ließ er sie stehen, folgte seinem Vater durch das Portal und drückte sich neben ihn auf die Kirchenbank. Immerhin war der Klang seiner Stimme bis zu Barbara gedrungen und rief sie aus einer Vision in die Wirklichkeit zurück. Dennoch – erlöst fühlte sie sich nicht davon. Vor Jahren hatte sie beim Kirchgang einmal eine junge Frau neben dem Portal stehen sehen, die jetzt plötzlich aus der Erinnerung vor ihr auftauchte und ihr wie eine Schwester vorkam. Sie war barfüßig, trug das Haupt entblößt und hielt eine Rute in der Hand, als Zeichen ihrer Schuld. Unzucht hatte sie getrieben, den Beischlaf mit einem verheirateten Mann vollzogen. Angeblich wusste sie nicht, dass er verheiratet war, was ihr nur wenige glaubten und was ihre Schuld kaum gemildert hätte.
In der Kirche verblasste das Bild dieser Frau nur unmerklich vor Barbaras Augen und wurde durch die Predigt wieder deutlicher hervorgerufen.
Nicht nur Barbara musste an diesem Ostersonntagmorgen die Aufmerksamkeit der Leute ertragen. Hinter vorgehaltenen Händen hatte sich herumgesprochen, dass die Schwiegermutter des Totengräbers verhaftet worden war. Immer wieder stahlen sich Blicke in die letzte Reihe zu ihm, der scheinbar unbeteiligt neben Jörg saß. Jeder suchte vergebens nach einer Gefühlsregung in seinem Gesicht, was ihn freilich noch geheimnisvoller werden ließ.
Obwohl Barbara wusste, dass sie selbst derzeit ein begehrtes Ziel darstellte, konnte auch sie ihre Blicke nicht zurückhalten. Nur wenige Reihen hinter ihr, auf der anderen Seite, sah sie das Mariele zwischen den Bänken versunken sitzen, still und verstört im Gesicht. Barbara schauderte bei dem Gedanken, dass seine Weidegeschichten doch wahr sein sollten und ihre Ermahnungen das Kind davon hätten abhalten können, sie weiterzutragen. Wer von Hexerei erfuhr und es nicht meldete, machte sich selbst verdächtig.
Das Mariele musste ihren Blick auf sich bemerkt haben, denn es reckte den Kopf und erwiderte ihn. Geschwind schaute Barbara weg, schämte sich dann aber und gönnte der Kleinen wenigstens ein flüchtiges Lächeln. Hoffentlich hatte es sonst keiner erhascht. Barbara spürte feuchtes Getuschel im Nacken und senkte den Kopf ein bisschen tiefer.
Durch den Mittelgang von ihr getrennt, saßen Vater und Bruder. Noch immer wusste Barbara nicht, ob ihr Vater in jener Nacht den Lärm unter seinem Fenster mitbekommen hatte. Selbst wenn er ihm entgangen war, so schien es unwahrscheinlich, dass nicht anderweitig die Schmach seiner Tochter zu ihm gedrungen war. Bestmöglich ging Barbara ihm seither aus dem Weg und versuchte es über Michael heraus zu bekommen. Überhaupt wurde der Bruder seit den letzten Tagen für sie mehr und mehr ein Bindeglied zur Außenwelt. Zwar wusste er, dass die Burschen, und auch die Knaben aus seinem Verbund, ein Auge auf seine Schwester hielten und ihre Beziehung zu Franz missbilligten. Vom Charivari in jener Nacht hatte man ihn aber ausgeschlossen.
Barbara bedauerte, dass sie ihren Bruder offenbar in einen Zwiespalt zwischen sich und die anderen gedrängt hatte und verzieh ihm, wenn er seinen Unmut darüber an ihr ausließ. Mit Mädchen und Frauen, die sie bei der Arbeit traf, schwatzte sie nur noch Unverfängliches und ging ihnen möglichst aus dem Weg, auch Franz. Sie fand zunächst nicht einmal Gelegenheit, ihm zu versichern, dass sie sich keinesfalls von ihm abwenden wolle und nur auf eine günstige Gelegenheit warte, die ihnen einen Weg zueinander bahne, einen von der Öffentlichkeit geduldeten. Michael führte seit Tagen allein das Vieh zur Weide und erzählte seiner Schwester abends bei der Hausarbeit, was er tagsüber aufgeschnappt hatte. Barbara seufzte, als sie daran zurückdachte, wie schwierig es gewesen war, ihn zu überreden, Franz eine Nachricht in die Schusterwerkstatt zu schmuggeln. Sie hatte Michael Geld für die Reparatur seiner Schuhe gegeben – ein geringer Lohn für das Wagnis, dabei von Freunden gesehen zu werden, wie er fand. Harmlos pfeifend trat er zu Franz, der auf einem Hocker saß und Leder zuschnitt, während der Meister die Schuhe begutachtete. Erst Michaels aufgeregter Atem ließ Franz aufsehen, und ehe er Barbaras Bruder erkannte, war der auch schon verschwunden. Franz fühlte ein Stück Papier in der Hand, Barbaras Nachricht, worin sie sich weiterhin zu ihm bekannte. Doch Michael hatte eine Warnung hinzugefügt. Er solle ihr nicht mehr nachlaufen.
Vorerst hielt sie sich meist hinter schützenden Mauern verborgen. Dass sie sich um Martin kümmerte, der sich in besagter Nacht am Fenster verkühlt hatte und mit einer Erkältung darnieder lag, werteten einige als Vorwand und meinten, Barbara verschanze sich im Krankenzimmer vor der Außenwelt. Die junge Frau kümmerte sich nicht darum, denn viel zu sehr beanspruchte sie die Pflege des ihr seit Kindertagen Vertrauten. Martins Vater hatte sie durch seinen Knecht holen lassen, als sein Bub nach der durchwachten Nacht beim Hahnenschrei nicht aufstand, sondern von Schüttelfrost gebeutelt unter der Decke lag. Selbst schlaftrunken, folgte sie dem Ruf des Knechts, der von der Gasse heraufbrüllte, schlüpfte in ihr Kleid und hastete mit leerem Magen ins Nachbarhaus. Was Barbara bereits vermutete, erzählte Martin ihr unfreiwilligerweise durch Fieberfantastereien. Nachdem sie wusste, wie er sich erkältet hatte, wich sie kaum mehr von seinem Bett und verdrängte jedes eigene Bedürfnis. Martin lag mit schweißnasser Stirn auf zerwühltem Laken und starrte sie aus fiebrig glänzenden Augen an, als habe er eine Erscheinung. Sie lächelte, innerlich bestürzt darüber, ihn elender vorzufinden als erwartet, hockte sich neben sein Bett und trocknete seine Stirn notdürftig mit dem Zipfel ihres Kleides. Der Junge tastete nach ihrer Hand und drückte sie, damit sie seinen feuchten Fingern nicht entglitt.
Barbara wollte sie behutsam lösen, aber Martin drückte so fest, dass sie Gewalt anwenden musste. Er verzog das Gesicht, und sie fühlte sich von seiner Verlustangst, die ihn schmerzte, tief ergriffen.
Die Karwoche war seit dem Charivari dahingegangen, und Barbara musste sich am Ostersonntag erstmals wieder unter Leute wagen. Morgens an Karfreitag war es Martin so übel gewesen, dass sie bei ihm blieb und ihm von den Leiden Christi bei der Kreuzigung an diesem Tag erzählte. Das machte Martin beinahe stolz auf sein eigenes Elend, worauf es ihm gleich ein bisschen besser ging.
Wahrscheinlich wäre jetzt in der Kirche mehr Verachtung auf Barbara gefallen, wenn sich nicht inzwischen mehr ereignet hätte. Sie bemerkte plötzlich, dass sie noch immer die Hände zum gemeinsamen Gebet gefaltet hielt, obwohl der Pfarrer bereits predigte. Trotzdem fügte sie die stille Bitte an Gott hinzu, Martin Heiliger nicht für ihre Sünden büßen zu lassen. Wie der Bader meinte, sei er noch nicht außer Lebensgefahr und könne jederzeit einen Rückschlag erleiden.
Barbara schaute den Mittelgang entlang, die Kanzel hinauf zu Pfarrer Lammer in seinem schwarzen Talar und versuchte, sich auf die Predigt zu konzentrieren. Erst als Lammers Ton sich erhob und dazwischen fuhr wie eine Anklage, gewahrte sie, dass ihre Gedanken erneut abgeschweift waren, diesmal zu Franz. Überhaupt passte Lammers Tonfall nicht recht zu dem, was er sagte. Von der Auferstehung predigte er, von der Erlösung, sprach davon, dass Christus alle Schuld der Menschheit auf sich genommen habe. Es klang, als frage sich Lammer, ob die Menschen das auch wirklich verdient hätten. Habe sich nicht gleich nach der Auferstehung der Unglauben ausgebreitet, zuerst unter den Jüngern? Hatte Christus sie nicht gescholten, als die Elf zu Tische saßen, weil sie denen, die ihn sahen, nachdem er auferstanden war, nicht glauben wollten? War seine Mahnung nicht deutlich gewesen, dass nur selig werde, der da glaubet und getauft wird, die Ungläubigen aber verdammt würden?
Ja, auch in Bärenbrück drohe er sich wieder auszubreiten, der Unglauben. Satan wandle durch die Gassen, um die Menschen vom rechten Weg, vom rechten Glauben abzubringen, in die Irre zu führen. Er wolle sie verführen zu gottlosem Aberglauben, Götzenanbetung, Unzucht und Hexerei!
Lammers Stimme steigerte sich Wort für Wort.
Allen waren in der vergangenen Woche solche Schlagworte durch die Köpfe gegeistert – unausgesprochen, als könnten sie sonst Gestalt annehmen. Nun standen sie im Raum, sichtbar in grellen Bildern, von der Fantasie herbeigerufen und greifbar in atemgeschwängerter Luft. Ein Pfarrer hatte sie herausgefordert, ein Gottesdiener, und ihnen den Kampf angesagt. Unweigerlich legte Barbara beide Hände auf ihren Leib und warf scheue Blicke um sich, als könnte es jemand bemerken und seine Schlüsse daraus ziehen.
Aber das Volk achtete nur auf seinen Prediger, die meisten mit erschrockenen Mienen, als schlüge er sie ins Gesicht. Ehe Unruhe aufkommen konnte, predigte er fort und verkündete Christus’ Aufruf nach seiner Auferstehung. „Gehet in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur.“ Das wolle auch er tun, jetzt und bis zu seinem Tode, wenn die Zunge ihm einst ihren Dienst versage.
Barbara spürte den Entschluss in sich aufbäumen, der seit Tagen in ihr gereift war. Nach dem Gottesdienst blieb sie unauffällig zurück und hoffte, dass Vater und Bruder draußen nicht auf sie warten mochten. In der leeren Kirche befiel sie ein Gefühl, als schauten tausend Augen auf sie herab, die ihr wiederum verborgen blieben.
Lammer hatte die Kanzel verlassen und wirkte plötzlich wie geschrumpft, verloren im Raum. Für die Dauer eines Augenblicks fühlte sich Barbara ihm seltsam verbunden, doch als er sie bemerkte und auf sie zukam, schwand dieses Empfinden mit jedem Schritt. Lammer schien wieder zu wachsen auf seinem Weg durch den Mittelgang des Langhauses.
Sie überlegte, wie sie beginnen sollte und versuchte den Wortwirbel in ihrem Kopf zu ordnen. Da hörte sie, wie hinter ihr das Portal wieder geöffnet wurde und fand sich im Lichtkegel stehend.
Auf Lammers Gesicht spiegelte sich Bedenken. Gebieterisch ragte er vor dem jungen Mädchen auf, sah an ihr vorbei und winkte mit dem Zeigefinger den Eingetretenen heran. Weit hing dabei der Ärmel seines Talars herab und wehte, leicht bewegt vom Luftzug, beim Zufallen der Tür. Barbara musste an einen Krähenflügel denken, was sie sofort verdrängte. Dieser Vergleich erschien ihr höchst unangemessen. Aus Ehrfurcht vor dem Pfarrer hatte sie sich noch nicht dem stumm Näherkommenden zugewandt. Als er an ihre Seite trat, erkannte sie ihn ungesehen, so vertraut war er ihr geworden.
„Bärbel, Bärbel!“ Martin hatte gerufen, und sie kam, so wie früher. Sie kühlte ihm die immer noch glühende Stirn, setzte sich zu ihm ans Bett und lächelte, als wäre alles gut.
Er wollte wissen, wie es beim Ostergottesdienst gewesen sei. Barbara staunte und berührte seine Wangen. Das Fieber sank. „Du kennst doch die Ostergeschichte, Martin.“ Trotzdem erzählte sie ihm davon, beschritt in Worten mit ihm den Leidensweg Christi.
Er hob den Kopf vom Kissen. „Werde ich auch wieder auferstehen?“
Barbara prüfte nochmals seine Temperatur. Das Fieber war eindeutig gesunken. „Freilich wirst du irgendwann auferstehen, aber vorher musst du ein gläubiges Leben führen.“
Martin versuchte sich aufzurichten, schlang seine Arme um ihren Hals und zog sie zu sich herab. „Ach Bärbel, ich hab mich ja so elend gefühlt – ich glaub’, geradeso wie der Heiland am Kreuz.“
Vorsichtig löste sich Barbara aus seiner Umklammerung. „Das darfst du damit nicht vergleichen.“
Martin begehrte auf. „Der Herr Pfarrer sagt doch immer, dass wir Gottes Ebenbilder sind und sein Sohn ein Mensch geworden ist.“ Dann erzählte er, an Karfreitag habe er geträumt, neben Christus am Kreuz zu hängen.
Barbara legte ihm die Hand auf den Mund und drückte ihn sacht in die Kissen zurück. Sie fürchtete, Gott könnte sich erzürnen über derartige Anmaßungen, selbst wenn sie aus einem Kindermund kamen. Aber das Fieber fiel weiter. Gesünder als er eingeschlafen war, erwachte Martin und verlangte nach süßer Milch. Barbara hielt ihm ein Schälchen an die Lippen, wischte den weißen Bart um seinen Mund herum ab, nachdem er getrunken hatte, und lächelte. „Gedulde dich noch ein Weilchen, dann wächst dir ein richtiger Bart.“ Beinahe bereute sie ihren Scherz, so begeistert war der Junge davon.
„Wirklich? Wenn mir ein Bart wächst, dann bin ich doch fast schon ein Mann und kann dich heiraten.“
Barbara streichelte ihm die flaumige Wange. „Ein Bart allein macht noch keinen Mann. Du musst warten wie alle anderen Buben und irgendwann...“
Er unterbrach sie, schlug nach ihrer Hand. „Geh’ weg, ich weiß schon, dass du mich nicht mehr magst.“
Barbara seufzte. „Ach Martin, warum sollte ich dich nicht mehr mögen?“ Sie versuchte ihm zu erklären, dass die Zeit der gemeinsamen Kindheit verronnen war, doch er hatte den Kopf weggedreht und hörte nicht hin. Als nach einer Weile ihre Stimme ganz verklang, schreckte er hoch.
Barbara saß mit einer Näharbeit auf einem Stuhl neben dem Bett und erschrak ebenfalls, denn sie glaubte, er wäre eingeschlafen und hätte schlecht geträumt. Er starrte auf den Stoff in ihren Händen. „Was nähst du da?“
Sie antwortete nicht sofort, lächelte verlegen. „Ein Hemdchen.“
„Für mich?“
Sie wiegte den Kopf und hielt es ihm hin. „Sieh’ doch, für dich wird es viel zu klein. Du willst doch auch immer ein großer Bub sein, oder?“
Martin beäugte misstrauisch das hingehaltene Hemd.
„Es wird für ein Kindchen“, beantwortete Barbara seine unausgesprochene Frage und fügte noch hinzu, dass sie schließlich nicht den ganzen Abend untätig hier sitzen könne. Er wisse doch, dass Gott keinen Müßiggang möge und wohin er führen könne.
Doch Martin schüttelte hartnäckig den Kopf. Nein, das wisse er nicht.
Dann solle er sich das jetzt für alle Zeiten merken, denn darauf warte der Teufel nur. Der begegne den Menschen meistens beim Müßiggehen, wenn ihre Gedanken nicht an nützliche Arbeiten gebunden seien.
Martin betrachtete den Nähfaden in Barbaras Händen und überlegte, warum sie ihm gerade jetzt so etwas erzählte. War sie nicht auch müßiggegangen, als dieser Franz ihr über den Weg lief? Wenn das so sei, platzte er heraus, dann solle sie nur immer hier bei ihm sitzen bleiben und Hemdchen nähen. Dabei käme sie nie auf den Müßiggang zurück.
Barbara sah sich unvermittelt auf einem Berg aus Hemden und anderen Kleidungsstücken sitzen und lachte laut heraus. Als Martin sein Gesicht verzog und sie sah, wie ernst ihm das gewesen war, brach ihr Gelächter ab. „Du bist ein sonderbarer Bub, Martin, hältst dich zu viel alleine auf. Du musst dich mehr den anderen Buben anschließen, dich nicht dauernd an mich klammern.“ Sie wollte weiterreden, ihm mitteilen, dass er das bald ohnehin nicht mehr könnte, weil sie sich vermählen wollte, dass der Herr Pfarrer ihr und dem Franz Hilber heute nach dem Gottesdienst seinen Segen gegeben hätte und nur noch die Erlaubnis des Vaters ausstünde. Aber als sie dazu ansetzte, begann der Junge zu stöhnen, betrachtete sie aus glasigen Augen und warf seinen Kopf von einer Seite auf die andere, wobei er unablässig „nein, Bärbel“ murmelte.
Besorgt legte sie ihm die Hand auf die Stirn, bis er sich beruhigte. „Ich bin doch hier, Martin.“ Sie dachte an die Mahnung des Baders. „Ich bleibe hier bei dir sitzen.“
An der Ostermette nach Mitternacht würde sie also nicht teilnehmen können. Aber sie gestand sich ein, dass es ihr so lieber war. Lammer hatte sie eingehend von Kopf bis Fuß beäugt und wollte erst seinen Segen zu dieser Verbindung geben, als Barbara beteuerte, dass sie Franz Hilber bereits die Ehe versprochen hätte. Dem konnte Lammer nichts mehr entgegensetzen, außer, dass sie nicht so voreilig hätte handeln dürfen. Aber das sei nun mal geschehen, und er werde mit ihrem Vater alles bereden. Die Hochzeit sollte natürlich erst im Mai stattfinden, nach der Fastenzeit.
Dem hätte Barbara gern widersprochen, wagte es aber nicht, weil es ihre Vermutung aus eigenem Munde hätte offenbaren können. Glich ein solches Verschweigen nicht einer Lüge? Vielleicht täuschte sie sich aber doch und somit nicht den Herrn Pfarrer. Barbara fand keine Ruhe, nahm ihre Näharbeit wieder zur Hand und betrachtete den eingeschlafenen Jungen, dessen Verstörung noch auf seinem Gesicht lag. Ein ungutes Gefühl beschlich die junge Frau. Sie versuchte an etwas anderes zu denken, summte ein Schlaflied für Martin und übertönte allmählich die warnende Stimme in sich.