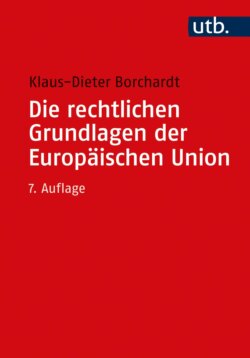Читать книгу Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union - Klaus-Dieter Borchardt - Страница 18
III. Die Gründung der Europäischen Gemeinschaften
Оглавление[12] Den Grundstein zur Bildung der EG legte der damalige französische Außenminister Robert Schuman mit seiner Erklärung vom 9. Mai 1950, in der er den von ihm und Jean Monnet entwickelten Plan vorstellte, „die Gesamtheit der deutsch-französischen Produktion von Kohle und Stahl unter eine gemeinsame oberste Autorität innerhalb einer Organisation zu stellen, die der Mitwirkung anderer Staaten Europas offensteht“15.
Hintergrund dieses Vorschlags war die Erkenntnis, dass es einerseits wenig sinnvoll war, Deutschland einseitige Kontrollen aufzuzwingen, andererseits aber ein völlig unabhängiges Deutschland immer noch als eine potentielle Friedensbedrohung empfunden wurde. Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma bestand darin, Deutschland politisch und wirtschaftlich in eine festgefügte Gemeinschaft Europas einzubinden.
[13] Mit Abschluss des Gründungsvertrages der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) durch die sechs Gründerstaaten (Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande) am 18. April 1951 in Paris und seinem In-Kraft-Treten am 23. Juli 1952 wurde der Schuman-Plan schließlich Realität16.
Von der Existenz dieser Gemeinschaft erhoffte man sich eine Initialzündung für eine dieser Gemeinschaft nachfolgende weitere politische Einigung Europas, die mit der Schaffung einer europäischen Verfassung konkrete Gestalt annehmen sollte.
[S. 44]
[14] Schon im Oktober 1950, also noch vor Unterzeichnung des Gründungsvertrages der EGKS, wurde auf französische Initiative die Idee einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) geboren. Vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen den Supermächten USA und der damaligen UdSSR entsprach es den Sicherheitsbedürfnissen der westeuropäischen Staaten, ihre Verteidigungsanstrengungen zu verstärken und die europäische Integration voranzutreiben, um auf diese Weise den Bedrohungen des Kalten Krieges entgegenzuwirken17. Die Lösung sah man abermals in einer auch Deutschland umfassenden supranationalen Gemeinschaft (sog. Plevenplan). Dieser Plan scheiterte jedoch im August 1954 an der Ablehnung durch die französische Nationalversammlung, deren Mehrheit nicht bereit war, einen so starken Eingriff in die französische Souveränität, wie ihn der Verzicht auf eine nationale Armee darstellte, mitzutragen18.
Mit dem Scheitern der EVG hatten zugleich auch die Bemühungen um eine politische Einigung Europas einen schweren Rückschlag erlitten. Einem Jahr der Resignation folgte aber bereits im Juni 1955 ein neuer Vorstoß der Außenminister der Mitgliedstaaten der EGKS zur „Schaffung eines Vereinigten Europas“.
[15] Auf der Konferenz von Messina beschlossen die sechs Gründerstaaten der EGKS, ihre Arbeit am europäischen Einigungswerk dort fortsetzten, wo man mit der EGKS begonnen hatte, nämlich auf dem weniger von nationalen Emotionen geprägten Gebiet der Wirtschaft. So war man zwar bescheidener geworden, kam aber dadurch der europäischen Wirklichkeit näher, die augenscheinlich mit den Plänen der EVG überfordert worden war. Die Untersuchung der Möglichkeiten einer fortschreitenden Integration übertrugen die sechs Außenminister einem Ausschuss, der unter dem Vorsitz des belgischen Außenministers Spaak tagte. Der Spaak-Ausschuss legte 1956 seinen Bericht vor, der als Grundlage für die Vertragsverhandlungen zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG) und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) diente. Die Verträge wurden im März 1957 unterzeichnet und traten am 1. Januar 1958 in Kraft19.