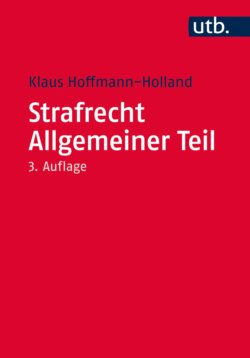Читать книгу Strafrecht Allgemeiner Teil - Klaus Hoffmann-Holland - Страница 66
4. Error in persona vel obiecto
Оглавление193Von der aberratio ictus abzugrenzen ist der error in persona vel obiecto, der Irrtum über die Identität der Person oder des Tatobjekts. In dieser Konstellation trifft der Täter zwar das von ihm anvisierte Tatobjekt, irrt sich jedoch über dessen Identität oder Eigenschaften.[205] Beim error in persona vel obiecto handelt es sich unproblematisch um einen beachtlichen Tatbestandsirrtum i.S.v. § 16 Abs. 1 S. 1 StGB, wenn vorgestelltes und tatsächlich angegriffenes Objekt tatbestandlich nicht gleichwertig sind.[206] Wenn also A den Hund seiner Nachbarn erschießt, den er in der Abenddämmerung für den Liebhaber seiner Frau gehalten hat, ist er nicht wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung (§ 303 Abs. 1 StGB) zu bestrafen, da sich sein Vorsatz nicht auf die Zerstörung oder Beschädigung einer fremden Sache bezog.
194Sind vorgestelltes und angegriffenes Tatobjekt tatbestandlich gleichwertig, liegt im Fall des error in persona vel obiecto demgegenüber ein unbeachtlicher Motivirrtum vor.[207] Daher ist A im folgenden Beispielsfall wegen vorsätzlich begangenem, vollendetem Totschlag (§ 212 Abs. 1 StGB) zu bestrafen: A will B töten. Er lauert ihm in der Dunkelheit auf, hält aber den herannahenden O, der B der Statur nach ähnlich sieht, für B. A schießt auf O, der auf der Stelle tot ist. – Anders als bei der aberratio ictus verfehlt A hier nicht das anvisierte Objekt. Vielmehr trifft er es, dieses hat nur eine andere als die vorgestellte Identität. Sein Vorsatz war aber auf das tatsächlich getroffene Objekt konkretisiert. Da sich der Vorsatz gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 StGB nur auf die Umstände des gesetzlichen Tatbestandes beziehen muss und es nicht auf die Beweggründe und Ziele des Täters ankommt, wirkt sich seine Fehlvorstellung an dieser Stelle nicht aus.
195Schwierigkeiten kann die Abgrenzung zwischen aberratio ictus und error in persona vel obiecto bereiten, wenn der Täter das angegriffene Objekt nicht optisch wahrnimmt.[208] Dies ist etwa in den viel zitierten Sprengfallen-Konstellationen der Fall: A will B durch einen Sprengsatz töten. Er bringt unter einem PKW, der vor der Garage des Hauses von B steht, eine Granate an, die beim Losfahren zünden soll. A geht davon aus, dass der PKW dem B gehört und von diesem benutzt wird. In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um das Fahrzeug von Bs Nachbarn O. Als O losfährt, zündet die Granate; |69|O wird dabei getötet.[209] – Zwar könnte man erwägen, einen Tötungsvorsatz des A abzulehnen, weil dieser die Gefahr, dass ein anderer als B den PKW nutzen würde, nicht erkannt hat. Doch liegt nur ein error in persona vor: A hat das getötete Opfer „durch das zur Sprengfalle umfunktionierte Fahrzeug mittelbar individualisiert“.[210] Es wurde der Vorstellung des A entsprechend derjenige getötet, der den PKW benutzt. Auf die Person, die sich dem geplanten Ablauf entsprechend verhält, ist der Tötungsvorsatz konkretisiert. In diesem Fall liegt bei fehlender optischer Wahrnehmung des angegriffenen Objekts eine als Motivirrtum unbeachtliche Identitätsabweichung vor. A handelt also mit Tötungsvorsatz bzgl. O. Ebenso wäre dementsprechend zu entscheiden, wenn eine Briefbombe von einer anderen Person als dem Adressaten geöffnet wird.
196Denkbar ist zuletzt auch ein Zusammentreffen von aberratio ictus und error in persona:[211] A möchte O töten und lauert diesem am Straßenrand auf. Als B sich dem A nähert, hält dieser ihn aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse für O und gibt einen Schuss ab. Der Schuss verfehlt jedoch den B, prallt an einer Straßenlaterne ab und trifft den O, der sich gerade dem Ort des Geschehens nähert, ohne von A wahrgenommen worden zu sein. – Obgleich A hier im Ergebnis diejenige Person getroffen hat, die er töten wollte, ist er nicht wegen eines vollendeten vorsätzlichen Tötungsdeliktes zu bestrafen. Im Zeitpunkt der Tathandlung (Abgabe des Schusses) war sein Vorsatz allein auf den B konkretisiert. Da er hinsichtlich eines Fehlgehens der Tat und der Tötung einer anderen Person nicht mit dolus eventualis handelte, liegt eine aberratio ictus vor, die trotz Gleichwertigkeit von anvisiertem und tatsächlich getroffenem Tatobjekt beachtlich ist (vgl. bereits Rn. 192). Somit ist A nur wegen eines versuchten Tötungsdeliktes in Bezug auf B und ggf. wegen einer fahrlässigen Tötung in Bezug auf O zu bestrafen. Treffen aberratio ictus und error in persona in einem Fall zusammen, ist dieser folglich nach den für die aberratio ictus geltenden Grundsätzen zu lösen.