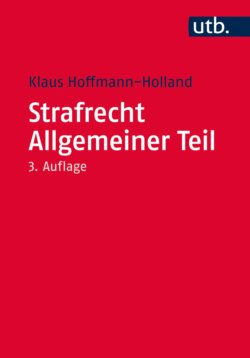Читать книгу Strafrecht Allgemeiner Teil - Klaus Hoffmann-Holland - Страница 68
VI. Exkurs: HIV-Fälle und strafrechtlicher Tatbestand
Оглавление202Besondere Schwierigkeiten bereitet in der Fallbearbeitung häufig die Behandlung der sog. „HIV-Fälle“, in denen der Täter in Kenntnis seiner HIV-Infizierung ungeschützten Geschlechtsverkehr mit seinem Sexualpartner hat, ohne diesen über seine Erkrankung aufzuklären. Problematisch ist bereits die Frage nach dem einschlägigen Tatbestand. In Betracht kommen sowohl Körperverletzungs- als auch Tötungsdelikte, die für eine Vollendungsstrafbarkeit jedoch voraussetzen, dass der Täter durch sein Verhalten ursächlich einen bestimmten Erfolg herbeigeführt hat. Somit wäre erforderlich, dass die Infizierung einer anderen Person mit dem HI-Virus nachweislich auf dem Geschlechtsverkehr gerade mit dem Täter beruht. Insbesondere in der Konstellation mehrfach wechselnder Sexualpartner ist es in der Praxis jedoch regelmäßig nicht möglich, die Infizierung auf einen ganz bestimmten Geschlechtsverkehr zurückzuführen. Zumindest bei Anwendung des in dubio pro reo-Grundsatzes wird die für die Vollendungsstrafbarkeit erforderliche Kausalität daher häufig zu verneinen sein. Möglich bleibt in diesem Fall jedoch eine Strafbarkeit wegen versuchter Körperverletzung bzw. Tötung.
203Da die Versuchsstrafbarkeit einen Tatentschluss und damit vorsätzliches Handeln voraussetzt (vgl. noch Rn. 621ff.), spielt bei den HIV-Fällen weiterhin die Abgrenzung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit eine erhebliche Rolle. Der BGH bejaht im Fall des ungeschützten Geschlechtsverkehrs bei Kenntnis der eigenen HIV-Infizierung in der Regel vorsätzliches Handeln des Täters, allerdings nur hinsichtlich eines Körperverletzungsdeliktes. Trotz der grundsätzlich sehr niedrigen Infektionsgefahr eines einzigen ungeschützten Sexualkontakts sei dieser dennoch geeignet, das Virus zu übertragen, was vom Täter billigend in Kauf genommen werde.[212] Jedoch sei ein |72|Tötungsvorsatz zu verneinen, da hinsichtlich der Tötung eines Menschen eine besondere innere Hemmschwelle bestehe und zu Gunsten des Täters davon ausgegangen werden müsse, dass er auf zukünftige – derzeit noch unbekannte – Heilungsarten vertraue oder gehofft habe, das AIDS-Virus werde bei seinem Partner überhaupt nicht ausbrechen.[213] Von dieser Annahme ausgehend ist in den HIV-Fällen in der Regel eine Strafbarkeit wegen versuchter Körperverletzung anzunehmen.
204In der Literatur wird die vom BGH vorgenommene Spaltung des Vorsatzes überwiegend abgelehnt. Eine Auffassung lehnt unter Berufung auf die minimale Infektionsgefahr eines einzigen ungeschützten Sexualkontakts (0,1–1 %) sowohl den Körperverletzungs- als auch den Tötungsvorsatz ab, da dem Täter nach allgemeiner Lebenserfahrung diese minimale Infektionsgefahr bewusst sei.[214] Andere bejahen sowohl den Körperverletzungs- als auch den Tötungsvorsatz, weil der Täter sich zur Erreichung seines Zieles („Geschlechtsverkehr“) mit der erkannten und ernst genommenen Gefahr einer tödlichen Infizierung des Partners abgefunden habe, weshalb nicht nachvollziehbar sei, entsprechend der Ansicht des BGH zwar den Vorsatz des Täters, das Opfer zu infizieren, zu bejahen, den Tötungsvorsatz aber zu verneinen.[215]